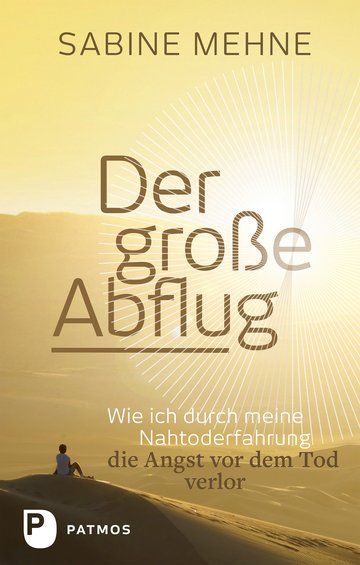2. Freiheit – keine Angst mehr vor dem Tod
Das Schwinden der Kraft, das langsame Immer-weniger-Werden und die Loslösung meiner Seele – ich nenne es jedenfalls erst einmal so – von ihrem Haus, meinem Körper, führte aus heutiger Sicht dazu, dass ich am 14. September 1995 eine Nahtoderfahrung machte. Dieses Erleben hatte neben allen Erfahrungen des Leidens und Abschiednehmens eine solche Intensität und Dichte, dass es mein Leben für immer verändern sollte.2
Diese Veränderungen spielten sich auf vielen Ebenen ab. Am einfachsten zu akzeptieren war für mich der grundlegende Verlust einer Angst vor dem Sterben und dem Tod. Es so radikal sagen zu können und wirklich bis in die letzte Faser meines Seins zu spüren, dass ich keine Angst habe, hat für mich etwas Köstliches. Dieses Wort passt zugegebenermaßen nicht unbedingt zu Sterben und Tod. Wir verwenden es eher bei einer Mahlzeit oder wenn wir uns bei einem guten Film amüsieren. Für mich ist es jedoch absolut köstlich, den Übergang zum Tod als eine Lebensphase zu erleben, in der alles, was wir empfinden können, in seiner vollen Dichte und Reife erfahrbar ist, so dass ich dies zu den Höhenpunkten eines Menschenlebens zähle.
Immer wieder taucht in mir ein Bild auf, das sich tief in mir eingeprägt hat. Diese eindrücklichen Bilder, vielleicht sind sie vergleichbar mit einer Art Vision, habe ich seit der Nahtoderfahrung recht häufig und sie erfüllen einen tieferen Sinn für mein Leben: Ich sehe ein Kind, das staunend auf einer Wiese steht und Blumen pflückt. Leuchtende, bunte, kleine Wiesenblumen, voller Saft. Dieser Teil steht für das pralle Leben, für den Beginn, für die Fülle, für alles Schöne. Dann sehe ich dieses Kind, wie es wieder über die Wiese geht, als die Blumen verblüht sind. Es pflückt eine davon, betrachtet sie und beginnt gedankenverloren die einzelnen verblühten Teile mit den Fingern abzuzupfen und zu Boden fallen zu lassen. Übrig bleibt das Innere der Blume, in dem die Samen angelegt sind, und das Kind lässt auch dies zu Boden fallen. Einfach so, ohne Angst, ohne Schuldgefühl, ohne Zögern. Dieser Teil des Bildes ist für mich das Ende des Lebens, das Verblühtsein, das Verwelken, das Zu-Boden-Fallen und wieder Zu-Erde-Werden. Möglicherweise, herrschen gute Bedingungen, gehen die Samen wieder auf. Es geschieht leicht, selbstverständlich, einfach so, es geschieht täglich hunderttausende Male überall auf der Welt. Rechne ich mit sieben Milliarden Einwohnern und einem Durchschnittsalter von siebzig Jahren, dann sind es rund 300 000 tägliche Geburten und Todesfälle auf der Erde.
Dass die verblühten Blätter abgezupft werden und nicht von alleine fallen, was ja am natürlichsten wäre, entspricht dem, wie ich Sterben in unserem Land erlebe. Es wird gezupft, es wird an uns gearbeitet, oft noch diagnostiziert und therapiert, um einer längst welken Blüte noch einen blühenden Anschein zu verleihen. Wir werden versorgt, weil wir eben keine Wiesenblumen in freier Natur sind, sondern Menschen – aufbewahrt in geschlossenen Räumen –, bei deren Verfall eine gewisse Ordnung, Sauberkeit und Fürsorge nötig ist.
Aber: Das Kind fühlt sich leicht und frei, und genauso fühle ich mich auch, wenn ich über diesen Teil des Lebens spreche, ob er sich nun auf mich oder andere bezieht. Ich habe keine Angst. Ich fühle Freude und Erleichterung, und das, obwohl Sterben auch schmerzlich und grauenvoll sein kann. Wie komme ich dazu? Durch meine Nahtoderfahrung, einer Grenzerfahrung, in der ich mir inmitten dieses Leids selbst nicht mehr ausweichen konnte. Dabei habe ich nicht nur mein Leben verabschiedet, sondern auch alle seltsamen Vorstellungen, die einem so beigebracht werden, damit man ein anständiger Mensch in einer zivilisierten Gesellschaft wird.
Die Situation, in der ich dieses Erlebnis geschenkt bekam, war, gemessen an den zuvor erlebten und geschilderten Dingen, eher unspektakulär. Es wurde eine Ultraschalluntersuchung meines Bauches durchgeführt. Ich hatte unsagbar starke Schmerzen, und das Ergebnis der Untersuchung zeigte den Grund: eine Blasenlähmung mit einer kindskopfgroßen, dem Platzen nahen gefüllten Blase. Während der Untersuchung war ich weder klinisch tot noch bewusstlos, obwohl es gut möglich ist, dass ich kurz das Bewusstsein verloren, es aber keiner bemerkt hatte. Ich kann diesen Umstand nicht eindeutig erinnern.
Nach zwanzig Jahren der eigenen Auseinandersetzung mit meinem Lebensthema, unzähligen Gesprächen mit Wissenschaftlern, die sich mit diesem Phänomen befassen, und anderen Nahtoderfahrenen sehe ich »meinen Tod« als eine folgerichtige Erfahrung. Mein Körper war so krank und zeigte alle Zeichen eines langen, mühsamen Sterbeprozesses. Jeden Tag ging etwas weniger gut als zuvor. Infolgedessen hatte ich es mir in meiner Kammer Nummer zwei so bequem gemacht, die Tür nach außen sogar verrammelt und die sichere Empfindung, keine Kraft mehr für mein Leben zu haben. Meine Seele saß quasi auf der Abschussrampe, bereit für ihren Abflug. Ich gebe nach, ich füge mich, ich lasse einfach los. Jeder Widerstand ist zwecklos. Sollen sie machen, was immer sie für richtig halten, ich habe keine Chance, dem zu entkommen. Das einzig Mögliche erschien mir, mich in mein Schicksal zu fügen. Biblisch gesprochen war ich an jenem Punkt angekommen, an dem es heißt: »Dein Wille geschehe.«
Leicht und schnell
Die Schnelligkeit, mit der ich aus meinem Körper ausgetreten bin, ist auch nach so langer Zeit für mich immer wieder faszinierend. Ich meinte, aus ihm hinauskatapultiert worden zu sein, eine Kraft gespürt zu haben, die mich regelrecht anzog, also eine Art Wechselwirkung, ein Spannungsfeld zwischen mir und einer Kraft außerhalb von mir. Die Stelle, an der ich meinen Körper verließ, war oben an meinem Kopf, dort, wo früher die Fontanelle war, eine Engstelle. Bei der Geburt ist es eng, beim Sterben ist es eng, dann kommt die Weite, in der es keinen Halt gibt, als neue Dimension. Es war mir, als würde mein Wesen auf das Format einer kleinen Kugel zusammengeschnurrt, um diese Engstelle zu passieren. Es gab nichts und niemanden, der mich hätte aufhalten können, und ich sage es gerne etwas spaßhaft, dass ich sogar den berühmten Tunnel ausgelassen habe, denn dafür hatte ich gar keine Zeit mehr. Es gab Wichtigeres, als mich noch durch einen Tunnel zu quälen, in diesem hatte ich in den Wochen zuvor lange genug festgesteckt.
Sobald ich den Körper verlassen hatte, dehnte ich mich wieder aus, wie eine Wolke. Und ebenso breitete sich die Erkenntnis in mir aus, dass dieses große Ich, das ich noch Ich nenne, existiert, wenn es sich außerhalb meines Körpers, nämlich oberhalb von ihm befindet. Es ist lebendiger als alles, was ich bis dahin für lebendig gehalten hatte. Ja, eine Existenz war für mich bis zu diesem Moment ohne einen Körper, also eine physische, materielle Substanz, unvorstellbar gewesen. Obwohl ich schon als Kind eine »kleine Nahtoderfahrung« durch Beinaheertrinken hatte und infolge dessen als Jugendliche öfters aus dem Körper ausgetreten bin, empfand ich diesen Moment nie als so endgültig. Jetzt aber merkte ich: Ich bin anders, völlig neu. Was bin ich, wer bin ich, wie bin ich? Die Klarheit und Präsenz, mit der ich wahrnehmen kann, ist nicht von dieser Welt, oder doch? Eine Sonderausstattung, die erst freigeschaltet wird, wenn man bereit ist, in diesen Bereich einzutreten, für den ich aber keine Begriffe habe, den ich nur staunend und völlig überwältigt als satte Realität erkennen kann?
Nach so vielen Jahren ist mir dieses Gefühl auch heute allgegenwärtig: Die Beziehung zu meinem Körper war mir egal, sie war bedeutungslos, unwichtig. Alles Bemühen der letzten Monate seitens der Ärzte und des Pflegepersonals, um diese Körpermaschine am Leben zu erhalten und die Fehlerquelle herauszufinden, war für mich schlagartig bedeutungslos geworden. Diesem Bemühen wurde ich regelrecht entrissen. Ich empfand nur eine große Erleichterung über diese einmalige und leichte Möglichkeit, alldem zu entkommen.
Meine Schilderungen können als Undankbarkeit gegenüber dem Bemühen der Ärzte und ihrer großen Fürsorge in dieser Zeit meines Lebens verstanden werden. So meine ich das aber nicht, im Gegenteil, mir war ihr Bemühen bewusst und ich spürte auch ihre Not, dass sie trotz allem, was sie taten, zu diesem Zeitpunkt noch keine verwertbare Erklärung bzw. Diagnose fanden. Manches Mal war ich selbst völlig verzweifelt. Trotzdem sei mir diese Frage gestattet: Welcher Aufwand wurde für diese Körperhülle getrieben, die jetzt ihren Frieden hatte? Es erschien mir in diesem Moment so unsinnig, für dieses bisschen Körper so einen Aufwand aufzubringen, auch wenn er sich, wie ich heute weiß, natürlich allemal gelohnt hat. Und immer, wenn ich mich in der Erinnerung ganz in dieses Hineinfühlen und -erleben begebe, so überkommt mich wieder und wieder eine gewisse Form des Rausches, denn es ist unsagbar schön, ohne einen Körper existieren zu können.
Über dieses Thema scheiden sich die Geister, ja, ich weiß. Die reduktionistisch-materialistisch orientierten Denker sagen, dieser Zustand sei reine Einbildung und subjektive Empfindung und einzig und alleine durch ein funktionierendes Gehirn hervorgerufen und zu erklären. Diejenigen, die sich ohne einen Gegensatz zwischen einer geistigen und materiellen Ebene positionieren, meinen, dass es durchaus möglich sei, auch mit diesem funktionierenden Gehirn den transzendenten Raum so zu erfassen und zu erfahren, dass es zu einer Trennung zwischen Körper und Geist kommen kann.
Für mich bleibt die Frage: Wie stark ist diese Trennung? Hierzu habe ich...