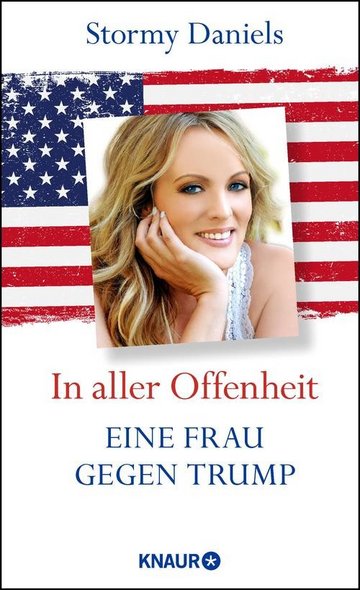Prolog
Mein Handy surrte und surrte, Nachrichten von Freunden, alle mit dem gleichen Text: »Happy Stormy Daniels Day!« Es war zwei Uhr, nur noch zwei Stunden, bis ich bei einer kleinen Open-Air-Feier auf dem Santa Monica Boulevard den Stadtschlüssel für West Hollywood überreicht bekommen sollte. John Duran, der Bürgermeister des Bezirks, hatte den 23. Mai zum Stormy-Daniels-Tag ausgerufen, und ich fand das mindestens so surreal wie alle anderen.
Ich schrieb allen zurück und trank eine Dose Red Bull leer. Keith und JD, meine schwulen Daddys, sorgen immer dafür, wenn ich bei ihnen in L.A. wohne, dass die Bude voll mit Energy-Drinks ist. Und mit Knabberzeug. Wer mit mir befreundet sein will, dem muss eins ganz klar sein: Knabberkram gehört dazu. Ein SUV mit meinen beiden Bodyguards hielt vor dem Haus. Brandon und Travis sind seit Anfang April, als die Morddrohungen gegen mich und meine Familie heftiger wurden, immer um mich herum, aber so nervös, wie sie jetzt mit einer Tasche auf die Tür zukamen, habe ich sie noch nie erlebt. Ich hatte sie in einen äußerst wichtigen Einsatz geschickt: »Fahrt zu Marciano und kauft mir was zum Anziehen für die Feier. Größe S, zurzeit«, hatte ich sie instruiert, »und nicht vergessen, ich hab Riesentitten.«
Brandon und Travis waren auf Nummer sicher gegangen und mit zwei Kleidern zurückgekommen, eins pfirsichfarben, das andere schwarz. Sie gaben sie mir zur Begutachtung. Ich kniff die Augen zusammen – Leute, die ich mag, ein bisschen zu triezen ist mein Lieblingszeitvertreib –, dann sagte ich leise: »Habt ihr klasse gemacht, Jungs! Seid ihr jetzt auch noch Stylisten?« Ich nahm das kleine Schwarze von Capella, ein Bandage-Kleid mit tiefem Ausschnitt, das perfekt saß und Donner und Blitz – meine Spitznamen für meine Brüste – in Schach hielt.
Ich glaube, ich hatte die Kleiderfrage vor lauter Aufregung über die Rede, die ich halten sollte, so lange vor mir hergeschoben. Ich bin es als Schauspielerin und Regisseurin in der Erotikfilmbranche und als Stripperin gewohnt, dass mich Leute, die ich treffe, mit der Frage löchern, wieso ich dies und jenes tue. Wie komme ich eigentlich dazu, Pornos zu drehen oder mich in Clubs auf der Bühne auszuziehen? Oder mich mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten anzulegen? Das Erstaunlichste für mich an diesem ganzen vergangenen Jahr dagegen ist die Entdeckung, dass ich vor Leuten reden kann. Auf der Scotlandville Magnet Highschool in meiner Heimatstadt Baton Rouge hatte ich zwar lauter Einsen, aber ich nahm lieber eine Sechs in Kauf, als mich vor die Klasse zu stellen und etwas vorzutragen. Ich war starr vor Angst, meine Stimme bebte, ich kam einfach nicht vom Stuhl hoch. Das erste Mal passierte das in der neunten Klasse – bei einem Referat über Louisa May Alcotts Roman Little Women. Natürlich hatte ich ihn gelesen – ich las damals alles, was ich kriegen konnte. Und die Figur der Jo March wäre das ideale Thema für mich gewesen, weil sie Schriftstellerin werden wollte, genau wie ich. Vor allem mit ihrer Frustration über das wenige, was die Welt jungen Frauen zuzugestehen bereit war, konnte ich mich identifizieren. Außerdem fand ich nicht, dass sie den alten Professor Bhaer heiraten sollte. (Entschuldigung, wenn das jetzt ein Spoiler ist, aber wenn Ihre nächste Lektüre auf dieses Buch oder Little Women zusammenschnurrt, sollten Sie sowieso mal Ihre Lebensentscheidungen überdenken.)
Aber ich bekam keinen Ton heraus. Ich kassierte eine Fünf minus, und zwar jedes Mal, wenn ich die Aufgabe hatte, vor anderen Menschen zu reden. Ich mochte es nicht, angestarrt zu werden. Beurteilt. Aber genau das passiert jetzt ständig, nachdem ich im März dem CBS-Politmagazin 60 Minutes ein Gratisinterview gegeben habe, das Millionen wert war. Ich wollte unbedingt als Erstes in einem seriösen, unparteiischen Sender gewisse Dinge richtigstellen, über Donald Trumps persönlichen Anwalt, über seine wiederholten Bitten, die Wahrheit über eine sexuelle Begegnung, die ich 2007 mit dem zurzeit amtierenden Präsidenten hatte, zu verschleiern. In 60 Minutes habe ich berichtet, was in dem Hotelzimmer gelaufen und wie ich später auf einem Parkplatz bedroht worden war. Aber das war nicht die ganze Geschichte – ich habe damals nicht erzählt, warum ich mich zum Reden entschlossen hatte und welchen Preis ich persönlich dafür bezahle. Noch immer schrieb und drehte ich Filme mit mir selbst als Star in L.A. und fuhr dann heim nach Texas, zurück in mein Vorstadtleben mit meinem Mann und meiner siebenjährigen Tochter. Das war mein Leben, so hatte ich es mir erträumt und hart dafür gearbeitet. Aber dieses Leben ist vorbei, das muss ich mir immer wieder klarmachen. Angesichts all dessen, was ich verloren habe, steht es mir doch wohl zu, mich zu verteidigen und sämtliche Fakten offenzulegen. Deshalb habe ich beschlossen, all das aufzuschreiben, was Sie gleich lesen werden.
Ich tue es auch für die vielen Menschen, die zu meinen Stripshows kommen und geduldig immer länger Schlange stehen, um ein Foto mit mir machen zu können und mir einen Augenblick nahe zu sein. Ich tanze in Clubs, seit ich 17 bin. In den zwei Jahrzehnten Film- und Bühnenarbeit ist meine Fangemeinde stetig gewachsen, demographisch gesprochen waren es meist weiße Männer in den mittleren Jahren, also zwischen 45 und 65 – vorwiegend Republikaner. Von denen habe ich etliche verloren. Okay, jeder hat die freie Wahl. Wir sind hier schließlich in Amerika.
Statt ihrer kamen jetzt Leute, die nicht weiß waren, Schwule, auch jede Menge weiße Frauen in den Vierzigern. Solche Leute waren bisher nie in Stripclubs gegangen, auch das will nämlich gelernt sein. Mein angestammtes Publikum hatte beste Manieren, vielen Dank noch mal. Wer in meine Shows kam, zeigte, dass er sich in der nicht jugendfreien Unterhaltungsbranche auskannte, wahrscheinlich schon auf Erotikmessen gewesen war oder zumindest einen anderen Pornostar in einem Stripclub gesehen hatte. Solche Leute wissen, wie man sich benimmt. Die knipsen nicht während der Show, die grapschen auch definitiv nicht nach mir, um mir Liebeserklärungen zu machen. Ich tanze nämlich auf sehr hohen Stöckelschuhen, und wenn jemand an mir herumzerrt, falle ich hin. Und er wird achtkantig vom Türsteher rausgeschmissen.
Wenn Ihnen der Begriff neues Geld etwas sagt, dann wissen Sie in etwa, wer die neuen Stripclub-Stammgäste sind. Die kommen jetzt in Massen in meine Shows.
Die schwulen Männer kann man in zwei Kategorien einteilen: Die einen wollen sich einfach amüsieren, die anderen Zeitgeschichte erleben – ich mag sie beide. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich von den Ersteren höre: »Das ist das erste Mal, dass wir Eintritt für einen Stripclub bezahlen – wo’s eine Vagina zu sehen gibt.« Viele haben extra Requisiten dabei für die Fotos hinterher, Chipstüten oder Hüte mit dem Spruch Make America Gay Again.
Die Schwulen der zweiten Gruppe sind emotionaler, sie erzählen mir nach der Show, wie sie sich gemobbt fühlen von einer Regierung, die ihre Ehen und ihre Freiheit offenbar nicht schützen will. Was sie mir anvertrauen, sind reale Ängste, sie beruhen auf echten Erfahrungen. Denselben, die auch meine schwulen Daddys immer wieder machen, meine Wahlfamilie, seit ich mit Mitte zwanzig meine biologischen Eltern für mich abgemeldet habe. Keith und JD gehören zu den ganz wenigen Menschen, die von meinem Geheimnis in Sachen Trump-Vorwahl wussten, und es gab einen Moment Ende 2016, in dem sie mir vor lauter Panik wegen ihrer bevorstehenden Heirat übelnahmen, dass ich nicht reinen Tisch machte und mein Leben auf den Kopf stellte, um ihrs zu retten.
Die Frauen, stellte ich fest, kamen in die Clubs, als es losging mit den verletzenden Facebook-Posts, die irgendwelche Leute morgens nach einer Show schickten. »Wir wollten dich eigentlich unterstützen, aber wir durften nicht rein!« Sie standen zu viert oder fünft vor dem Club, lauter Frauen, aber die Türsteher ließen sie nicht durch. Als heterosexuelle Frau kommt man normalerweise nur in männlicher Begleitung in einen Club. Wenn eine ohne Mann kommt, wird angenommen, dass sie nach Heiratskandidaten Ausschau hält oder anschafft. Bei mir weiß inzwischen jeder Clubbesitzer, dass er auch Frauen reinzulassen hat.
Die Frauen, denen ich während der Tourneen begegne, sind ziemlich wütend. Nicht auf mich, wie ich zuerst dachte. Ich hatte anfangs sogar ein bisschen Angst um meine Sicherheit in den Clubs. Aber nein, sie sind wütend auf Trump, anscheinend nehmen sie ihn als Stellvertreter für jeden Mann, der sie je schlecht behandelt hat. In Nashville, Shreveport, Baltimore … überall hieß es: »Du musst ihn drankriegen. Schnapp dir diesen Haufen orangene Scheiße.« Ganz oft warten sie eher still in der Schlange, um mit mir zu reden, und dann legen sie mir die Hand auf den Arm und erzählen von irgendeiner Frau, für die sie sich nicht eingesetzt haben. Oder einer Freundin, die sich umgebracht hat, nachdem sie vergewaltigt worden war. Oder von sich selbst, von dem Gefühl, keine Stimme zu haben, schutzlos zu sein. Und ich stehe da, eine junge Frau in schicken Klamotten, die vor ein paar Minuten noch auf einer Bühne Striptease gemacht hat. Sie übertragen ihre Energie komplett auf mich und gehen nach Hause, befreit von einer Last, die jetzt ich auf den Schultern habe.
Zum Abschied sagen sie: »Du wirst die Welt retten.« Im April gab es noch ein Upgrade, da hat mir eine Frau bei einem solchen Gespräch gleich den Job verpasst, das ganze Universum zu retten. Soll aber...