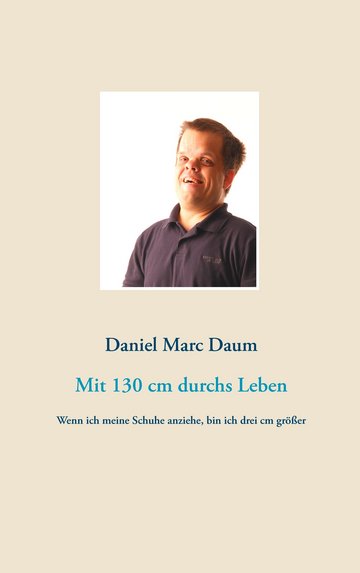KAPITEL 1
Gisela Daum
DANIEL
Zwei Wochen zu früh! Am späten Nachmittag des 19. Oktober 1970 setzten urplötzlich die Wehen ein. Unser zweites Kind wollte zur Welt kommen. Morgens war ich noch mit dem alten Fahrrad zur üblichen Kontrolluntersuchung gefahren. „Alles in bester Ordnung!“, hieß es. „Sie haben noch gut zwei Wochen Zeit bis zur Entbindung.“
„Prima“, freute ich mich, „dann kann ich noch Apfelmus einkochen und gründlich sauber machen.“ Wie bei unserem ersten Kind, hatten wir uns auch diesmal für eine „Praxisgeburt“ entschieden. Das bedeutete: Geburt in den Praxisräumen des Frauenarztes mit Hebamme und Ehemann. Anschließend zwei Stunden Ruhe und danach mit dem Krankenwagen ab nach Hause. Die darauffolgenden zehn Tage wurde man zweimal täglich durch die Hebamme betreut.
Die Wehen wurden stärker, die Abstände kürzer. Schwester Sophia kam, untersuchte mich kurz, packte mich samt werdendem Vater und vorbereiteter Tasche sofort in ihr Auto. Fünfzehn Minuten später bekam ich einen Einlauf, duschte und begann, in den Praxisräumen auf- und abzugehen, solange es eben ging. Danach hieß es „rauf aufs Bett“ und das Abenteuer „Geburt“ konnte beginnen. Vor dem Dammschnitt: Kurze Narkose, aufwachen, der erste Schrei des Kindes – und plötzlich war alles ganz anders. Augenblicklich spürte ich: Etwas ist hier nicht in Ordnung!
Die Stimmung war bedrückend, nicht freudevoll erlösend, wie nach der Geburt unseres ersten Sohnes. Das Schweigen des Arztes verstärkte düstere Ahnungen.
Unser Sohn, Daniel Marc, hatte das Licht der Welt am 20. Oktober 1970 in den frühen Morgenstunden erblickt. Er wurde untersucht, gebadet, angekleidet und ins vorbereitete Wärmebettchen gelegt. Doktor Jacob und meine Hebamme verließen schweigend den Raum. Meinem Mann Andreas wurde übel – übrigens das erste und einzige Mal bei acht Geburten. Warum wurde uns nicht gratuliert? Warum verließen Doktor Jacob und Schwester Sophia schweigend den Raum? Hastig bat ich Andreas: „Bitte gib mir das Kind!“ Rasch zog ich Daniel aus, schaute ihn von allen Seiten an, fand aber nichts Ungewöhnliches. Sicher, der Kopf war etwas mehr verdrückt als bei unserem ersten Kind, aber das soll schließlich vorkommen. Auch schienen Höschen und Jäckchen zu groß, trotz kleinster Konfektionsgröße.
Daniel schlummerte friedlich in seinem Bettchen. Angespannt lehnte ich mich zurück. Beruhigend streichelte Andreas meine Hände. Plötzlich betrat Doktor Jacob gemeinsam mit einem uns unbekannten Mann das Zimmer. Er wurde als örtlicher Kinderarzt vorgestellt.
Wieder wurde Daniel ausgewickelt und untersucht. Schweigen, undeutliches Gemurmel. „Lassen Sie Ihren Sohn zu Hause von Ihrem Kinderarzt noch einmal gründlich untersuchen“, meinte Doktor Jacob sachlich. Ohne zu gratulieren gab er uns die Hand, wünschte alles Gute, verabschiedete sich eilig.
Noch größere Unsicherheit und Beklemmung breitete sich aus. Obwohl die Geburt reibungslos und schnell verlaufen war, fühlte ich mich grenzenlos erschöpft und verunsichert. Nach zwei Stunden wurden wir mit dem Krankenwagen heimgefahren. Andreas duschte, aß eine Kleinigkeit und ging ins Büro.
Jetzt war ich mit unserem neuen Baby allein; David, unser ältester Sohn, war bei seiner Oma. Zum ersten Mal flossen Tränen. Ich fühlte mich einsam und hilflos, wie gelähmt, unfähig zu begreifen, was passiert war.
Noch am Vormittag kam Schwester Sophia, um Daniel und mich zu versorgen. Am Nachmittag traf unser Kinderarzt Doktor Mertens ein. Auch er untersuchte Daniel schweigend und fragte dann nach einer Weile sehr vorsichtig: „Gibt es in Ihrer Familie vielleicht auch kleine Menschen?“ Ich begriff nichts und meinte nur: „Die Leute in unserer Familie sind natürlich unterschiedlich groß.“ Der Gedanke an „Kleinwuchs“ war mir absolut nicht gekommen. Bedächtig packte Doktor Mertens seine Tasche und empfahl, Daniel demnächst in einer Klinik vorzustellen. Noch immer hatte ich keine Ahnung, was das alles bedeuten sollte. Vielleicht aus Angst vor der Wahrheit kam mir aber auch nicht der Gedanke, genauer nachzufragen. Damals war ich 23 Jahre alt, unerfahren und schüchtern.
Erst als Daniel vier Wochen alt war, fühlte ich mich imstande die Empfehlung unseres Kinderarztes zu befolgen und ihn in einer Klinik untersuchen zu lassen. Andreas besuchte zu dieser Zeit gerade das Ruhr-Kolleg in Essen, um auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur zu machen. Gleichzeitig arbeitete er jede freie Minute in seinem Beruf als Dreher und in den Ferien zusätzlich in einem Büro als Technischer Zeichner. Ich brachte Daniel allein in das nahe gelegene St. Josefs - Krankenhaus. Er wurde gründlich untersucht und geröntgt. Knapp zwei Stunden hat es gedauert, bis Professor Winter mir knallhart und ohne Umschweife mitteilte: „Ihr Sohn ist zwergwüchsig! Erwachsenengröße: Maximal 135 cm, Proportionen: Nicht ausgeglichen, Entwicklung: Normal, aber verzögert.
Kennen Sie „Klein Helmut“ vom Zirkus Krone?“ Professor Winter sah mich über seine schwarz geränderte dicke Brille abwartend an. „Genau so wird Ihr Sohn als Erwachsener aussehen!“ Er gab mir die Röntgenbilder, schüttelte energisch meine Hand und verabschiedete sich offensichtlich völlig ungerührt. Fluchtartig verließ ich das Krankenhaus.
Draußen war es bereits dunkel. Es regnete. Der kalte Novemberwind blies mir schneidend ins Gesicht. Ich verlor meine nur mühsam aufrechterhaltene Fassung und weinte verzweifelt.
Jetzt wusste ich also, was los war, und doch verstand ich es nicht. Andreas nahm mich zu Hause tröstend in die Arme und meinte: „Das werden wir gemeinsam schaffen!“ Nach und nach informierten wir unsere Verwandten und Freunde.
Reaktionen: Schweigen, Entsetzen, Fragen, unbeholfenes Trösten. „Das wird sich schon auswachsen“, meinten die einen. „Nichts wird so heiß gegessen wie’s gekocht wird“, sagten die anderen. Ich versuchte tapfer zu sein, obwohl ich mich betrogen und verunsichert fühlte. Hatten wir etwas falsch gemacht? Warum musste das ausgerechnet uns passieren? Ich haderte mit dem Schicksal, mit mir selbst, mit Gott und der Welt. Warum gerade unser Kind? Vielleicht ist es ja nichts wirklich Schlimmes – aber warum unser Sohn? Als Andreas und ich am 18. Oktober 1968 geheiratet hatten, war klar: Wir planen eine Großfamilie. Zehn Kinder sollten es werden.
Ein Haus auf dem Land mit viel Licht, Luft und Sonne. Am 23. August 1969 wurde unser erster Sohn, David Andreas, geboren. Ein gesunder, kräftiger Junge. Mit allen möglichen und unmöglichen Problemen hatte ich vielleicht gerechnet, aber ein behindertes Kind bekommen? Das stand eindeutig nicht auf meiner Liste. Auf meine Warums, Weshalbs und Wiesos konnte mir im Grunde niemand antworten.
DANIEL MEIN BEHINDERTES KIND
Ich war enttäuscht, zornig auf Gott und die Welt, spürte meine Ohnmacht, wehrte mich gegen das Schicksal und konnte meine Aufgabe nicht erkennen. Äußerlich war ich ruhig und wirkte ausgeglichen, im Inneren fühlte ich mich einsam und hatte das Empfinden, im Grunde von niemandem wirklich verstanden zu werden. Die meisten Leute sprachen mich erst gar nicht auf die Behinderung unseres Sohnes an, andere verbreiteten unbegründeten Optimismus, der absolut nicht angebracht war, aber niemand sprach mit mir über meine Gefühle. Andreas, mein lieber Mann, ein unkomplizierter und stets optimistischer Mensch, macht sich nie zu viele Sorgen, nimmt die Dinge grundsätzlich so, wie sie sind. „Gefühlssalat“ zu sortieren zählt nicht gerade zu seinen Stärken. Ich selbst neige dazu, erst einmal alles für mich zu klären und zu verarbeiten, bevor ich darüber sprechen kann. Dieser Weg ist oft lang, einsam und beschwerlich. Natürlich war ich fest davon überzeugt, alles im Griff zu haben. Schließlich hatte ich Verantwortung für meine Kinder und als Hausfrau war es mir wichtig, alles in bester Ordnung zu halten.
Nachdem uns mitgeteilt worden war, dass Daniels Behinderung in unserem Fall nicht erblich bedingt ist, dass es sich um Neumutation handelt und da auch das Wiederholungsrisiko bei nachfolgenden Geburten zu 99 % auszuschließen war, entschieden wir, weitere Kinder zu bekommen. Am 14. Dezember 1971 wurde unser dritter Sohn, Michael geboren.
Gesund, kräftig und sehr aktiv. Einerseits brachte die Geburt dieses Kindes wieder mehr Gleichgewicht in mein Leben, andererseits fühlte ich mich grenzenlos erschöpft. Warum konnte ich nicht mehr richtig schlafen? Warum war ich so abgrundtief traurig, obwohl ich einen lieben Ehemann, drei süße Kinder und ein einfaches, aber gemütliches Zuhause hatte?
Der Arzt diagnostizierte Erschöpfung, Depressionen. Er schickte mich zu einem Kuraufenthalt ins Sauerland. Ruhe, Entspannung, Erholung, allgemeine Gesprächstherapie. Auf Wunsch Einzelgespräche mit einem erfahrenen Psychotherapeuten. Ich brauche keine Gespräche mit einem Therapeuten. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin einfach nur müde und...