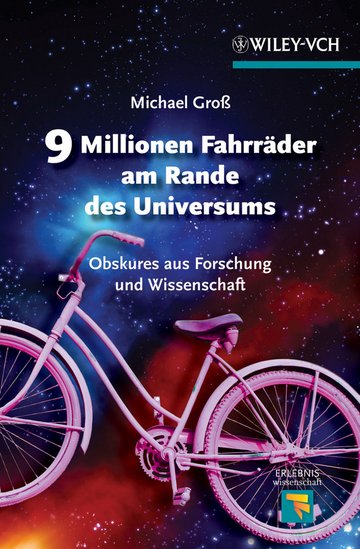2
Menschliches, Allzumenschliches, Zwischenmenschliches
Der Mensch muss natürlich im Mittelpunkt stehen. Also gilt der mittlere Teil des Buchs dem Hirnigen, Kinderkram, Zwischenmenschlichen und Sprachlichen, also allem was überwiegend mit dem Menschen an und für sich zu tun hat. Und da geben wir uns ganz wohlwollend und verständig, denn der Mensch ist ja gut, hat Erich Kästner gesagt. Nur die Leute, die sind schlecht. Und auf die kommen wir erst im letzten Teil.
Stoppt Alzheimer – spielt Schach!
Darwins Mitstreiter Thomas Huxley beobachtete dieses erschreckende Phänomen bereits im Tierreich: Wenn gewisse Meeresbewohner vom geistig anspruchsvollen Vagabundenleben Abschied nehmen und sich als Dauergäste auf einer Schiffsplanke niederlassen, wo sie lediglich das vorbeiströmende Wasser nach Nährstoffen filtrieren müssen, bauen sie die überflüssig gewordenen Teile des eigenen Hirns ab. Der Genetiker und Autor Steve Jones weitete diese Beobachtung in seinem Buch Almost like a Whale (deutscher Titel: Wie der Wal zur Flosse kam) auf den Menschen aus, als er konstatierte, dass manche Professoren auf die Erringung einer Dauerstelle (tenure) ähnlich reagieren.
Doch da Professoren keine eigene Spezies darstellen, ist Ähnliches möglicherweise für Homo sapiens ganz allgemein zutreffend. Nach den denkintensiven Jahren der Schul-, Universitäts- oder Berufsausbildung, sind manche froh, wenn sie sich auf ihrer Schiffsplanke niederlassen und die jeweils aktuelle Serie von Big Brother filtrieren können. Und wenn die ökonomischen Zwänge des Berufslebens sie zu geistiger Tätigkeit zwingen, neigen sie in der Freizeit besonders zum Abschalten.
Eine neue epidemiologische Studie aus den USA sollte allerdings zumindest denjenigen, bei denen die Hirnabschaltung noch reversibel ist, zu denken geben. Es war bereits vorher bekannt, dass hoher Bildungsgrad und anspruchsvolle Berufstätigkeit die Wahrscheinlichkeit verringern, an Alzheimer-Demenz zu erkranken. Nun fand die Arbeitsgruppe von Robert Friedland in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio heraus, dass diese Wahrscheinlichkeit (bei gleichem Bildungsgrad und Berufsstatus) in signifikantem Zusammenhang mit der Teilnahme an Freizeitbeschäftigungen im mittleren Lebensalter steht. Am besten »schützen« geistig anspruchsvolle Tätigkeiten wie Schachspielen, Sprachenlernen, und natürlich das Lesen meiner Bücher. Vielfältige sportliche und sogar passive Hobbys haben auch noch einen messbaren positiven Effekt, der ist allerdings geringer als bei intellektuell anspruchsvollen Beschäftigungen.
Wie das mit Statistiken so ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen, dass die Korrelation einen ursächlichen Zusammenhang enthüllt. Vielleicht schützt Schachspielen vor Alzheimer, vielleicht ist aber der Unwille zu geistiger Anstrengung in der Freizeit bereits das erste Symptom der Erkrankung, die erst Jahrzehnte später diagnostiziert wird. Oder beide Phänomene hängen von einer dritten, bisher nicht bekannten Variablen ab, etwa der Verfügbarkeit gesunder, nicht ausgelasteter Hirnzellen.
Wie dem auch sei, es ist zumindest denkbar, dass man sich mit geistigem Fitnesstraining vor Alzheimer schützen kann. Und selbst wenn der Kausalzusammenhang andersherum gelagert ist, wer wird sich schon durch offenkundige geistige Trägheit als zukünftiger Alzheimerpatient outen wollen? Also, keine Müdigkeit vorschützen! Sie und ich, wir haben ja schon einen Fitnesspunkt durch Lesen bzw. Schreiben populärwissenschaftlicher Bücher erworben. Nun lasset uns alle Schiffsplanken meiden und (gemeinsam mit der ZEIT) die Dummheit bekämpfen, ein neues Musikinstrument und eine zusätzliche Sprache erlernen, Schach spielen und Differenzialgleichungen lösen. Wer das im mittleren Lebensalter noch schafft, hat gute Chancen, sich im Alter noch daran zu erinnern. Und, liebe Frau Bundesgesundheitsministerin, vielleicht sollten Sie für solch lobenswerte Aktivitäten Bonuspunkte bei der Pflegeversicherung einführen.
(Spektrum der Wissenschaft Juni 2001)
Ins Hirn geschaut
Seit ich hauptberuflich Wissenschaftsjournalist und damit praktisch immer auf Themensuche bin, studiere ich die Aushänge im Institut besonders gründlich. Abgesagte Vorträge, alte Autos, Studentenzimmer … halt – da ist ein interessanter. Es werden Versuchspersonen für neuropsychologische Experimente im Kernspin-Tomographen gesucht. Wollte schon immer mal wissen, wie so ein Ding von innen aussieht. Und dito natürlich auch für mein Hirn. Praktischerweise gibt’s einen Schnipsel zum Abreißen und Mitnehmen, mit einer E-Mail-Adresse drauf.
Der Projektleiter ruft auch gleich zurück, innerhalb weniger Minuten ist alles geklärt – habe weder Klaustrophobie noch Metallteile im Körper, und das Experiment ist völlig nichtinvasiv. Magnetfelder sollte ich gerade noch aushalten, laut New Scientist machen sie sogar glücklich. Wenn das mal stimmt.
Knapp eine Woche später sitze ich dann in einem halbdunklen Labor am Computer, um den Idiotentest schon mal im Trockenen zu üben, während die zwei Hirnforscher ihren Magneten starten. Wenn ein Kreis kommt, muss ich mir merken, dass ich ein paar Sekunden später den linken Knopf drücken muss, aber erst, wenn mich ein weiteres Symbol mit einem Fragezeichen dazu auffordert. Es soll zwischen der Planung und der Ausführung einer Handlung unterschieden werden. Kommt ein Quadrat, dann muss ich nach Anforderung den rechten Knopf drücken, und bei einem Dreieck muss ich wie Schrödingers Katze im Zustand der Unentschiedenheit verharren, bis mir das Anforderungssymbol verrät, ob ich links oder rechts drücken soll.
Soweit ist mir das noch alles klar. Die Ursachen der Genialität werden die beiden mit diesem Test wohl nicht entdecken, aber vielleicht gibt’s ja wirklich einen Unterschied zwischen den Malen, wo ich zehn Sekunden lang »links, links, links« denke, und jenen, wo ich in freudiger Erregung auf das alles entscheidende Symbol warte.
Aber dann kommt noch eine kapitalistische Komponente hinzu. Ist die anfangs gezeigte geometrische Form rot ausgemalt, dann besteht eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass die richtige Antwort mit einem Geldbetrag belohnt wird. Ist sie hingegen blau, so beträgt diese Wahrscheinlichkeit nur 20%. Der Versuchsleiter bittet mich bestimmt zehn Mal, mich auf diesen Belohnungsaspekt besonders zu konzentrieren. Nun ja – wenn er das neurologische Korrelat der Geldgier sucht, dann wird er wohl bei mir nicht fündig werden. Aber ich bin ja kein Unmensch und bemühe mich um rote Symbole besonders, und sei es nur, weil ich die Farbe lieber mag.
Dann geht’s los: Plastikbrille statt meiner metallischen, zusätzlich Prismengläser, damit ich um die Ecke und aus der Röhre hinausgucken kann. Knöpfe zum Drücken in der rechten Hand, ein Blasebalg als Notbremse in der linken. Ohrstöpsel und Kopfhörer, denn die Maschine ist ziemlich laut. Warum, weiß keiner der Experten, das ist halt so. Dann werde ich in die Röhre geschoben, mein dicker Kopf mit Kopfhörern passt erst im fünften Anlauf, und schließlich wird das Gerät angeworfen. Die ersten zwanzig Durchgänge schaffe ich noch mit einiger Konzentration, aber danach beherrscht nur noch ein Gedanke das Objekt dieses Experiments: Wann hört dieser Lärm auf? Das Experiment soll etwa eine Stunde dauern, aber das Zeitgefühl ist unter diesen Bedingungen völlig abgeschaltet (zumal die Zeitintervalle in den Schritten des Experiments einer Zufallsvariation unterliegen).
Zu einem gewissen Zeitpunkt entschließe ich mich (immer in dem Bewusstsein, dass jeder Gedanke irgendwo auf einem Bildschirm ein verdächtiges Flackern auslösen kann), noch hundert Durchgänge des Idiotentests mitzumachen und dann den Blasebalg zu drücken. Das Zählen der Durchgänge hilft mir, bei halbwegs klarem Verstand zu bleiben, und nach etwa 50 Runden ist das Experiment dann tatsächlich zu Ende. (Abgesehen von weiteren fünf Minuten für ein Strukturbild, aber die sind schon fast Erholung.)
Im Anschluss bleibt nicht viel Zeit für wissenschaftliche Diskussionen, da der nächste Kandidat schon im Vorbereitungsraum ist. Ich bekomme immerhin noch einen dringend benötigten Kaffee im Großraumbüro mit Tageslicht und ohne Lärm. Ich versuche, zuhause anzurufen, kann mich aber zum ersten Mal in meinem Leben nicht an die eigene Telefonnummer erinnern. Liegt das jetzt an dem Idiotentest, am Lärm oder am Magnetfeld? Es gibt noch viel zu erforschen.
(Spektrum der Wissenschaft Januar 2001)
Aus dem Leben der Terien
Vielleicht wussten Sie noch nicht, dass Terien kein Tulett haben, aber meine naseweise Tochter hat das mit viereinhalb Jahren durch gezieltes Fragen herausbekommen. Es fing alles ganz harmlos damit an, dass sie wissen wollte, warum sie sich die Zähne putzen müsse. Damit die Bakterien nicht ihre Zähne anknabbern, sagte der unbedachte Vater. Ihre Leidenschaft für Mikrobiologie war von diesem Punkt an nicht mehr aufzuhalten. Was Terien gerne essen, wollte sie...