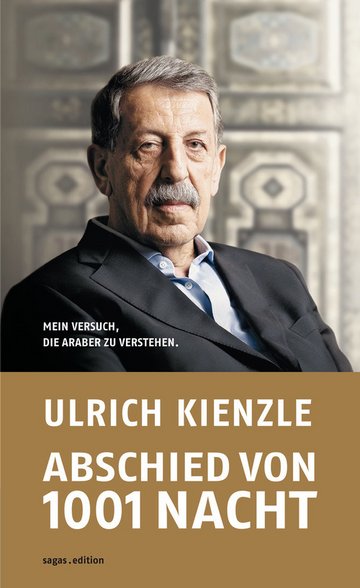MIT DEM TAXI IN DEN KRIEG
Der 6. Oktober 1973 ist ein ganz gewöhnlicher Samstag. Deutschland ist im Rolling-Stones-Fieber – zum ersten Mal nach drei Jahren ist die Band auf Europa-Tour, ein Fest für alle Hippies und Rock’n’Roller.
Der syrische Diktator Hafiz al-Assad feiert an diesem Samstag seinen 43. Geburtstag. Der ägyptische Präsident Muhammad Anwar as-Sadat macht seit Monaten Schlagzeilen: Spektakulär hat er 21000 russische Militärberater aus dem Land geworfen. Und zieht damit einen endgültigen Schlussstrich unter das Kapitel Sozialismus seines Vorgängers Gamal Abdel Nasser. Staatliche Firmen werden privatisiert, ein außenpolitischer Kurswechsel in Richtung USA zeichnet sich ab. Die Spannungen zwischen den Blöcken Ost und West haben wieder zugenommen.
Die islamische Welt begeht den Fastenmonat Ramadan, die westliche feiert die Götter des Rhythm and Blues. Kein Mensch rechnet an diesem Tag mit einem Krieg im Nahen Osten. Umso elektrisierender die Nachricht, die mich am frühen Nachmittag zu Hause erreicht: Mit einem Überraschungsangriff haben die ägyptische und die syrische Armee Israel auf dem Sinai und auf den Golanhöhen attackiert – ausgerechnet am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag.
Die Welt hält den Atem an. Die Russen reagieren verstört, weil sie fürchten, mit Ägypten einen langjährigen Verbündeten zu verlieren. Der neue Nahostkrieg stürzt die Welt, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, in eine gefährliche Krise.
Seit einigen Wochen war ich Auslandschef beim »SDR«-Fernsehen in Stuttgart, zuständig unter anderem für das Auslandsmagazin »Kompass« und die Arabische Welt. Ich fuhr sofort in den Sender. Wir mussten schnell entscheiden. Gerhard Konzelmann, der »SDR«-Nahostkorrespondent, saß in Beirut, von wo aus er die Entwicklung auf dem Golan verfolgte. Der Korrespondent des »Bayerischen Rundfunks«, Edmund Gruber, berichtete für die »ARD« aus Israel. Auf ägyptischer Seite war das »Erste Deutsche Fernsehen« nicht vertreten. Jemand musste nach Kairo.
Aber es gab ein Problem: Der Linienflugverkehr nach Ägypten war sofort nach Bekanntwerden der Kriegshandlungen eingestellt worden. Auch das Nachbarland Libyen wurde nicht mehr angeflogen. Erst am dritten Kriegstag hatten unsere Recherchen Erfolg: Eine russische Transport-maschine, die von Frankfurt nach Tripolis fliegen sollte, war bereit, uns mitzunehmen.
Das Team war längst zusammengestellt und so saßen »SDR«-Kameramann Mike Condé, ein Tontechniker und ich einige Zeit später in einem alten sowjetischen Militärtransporter auf dem Weg in den Nahen Osten. Die Maschine war aus Paris gekommen, mit Journalisten an Bord, vielleicht auch neuen russischen Militärberatern in Zivil, die in Kairo jetzt wieder gebraucht wurden. Eine Hundertschaft bunt zusammengewürfelter Passagiere saß fröstelnd in einem kalten russischen Flieger auf dem Weg in den Krieg. Der Flug kam mir endlos vor.
Tripolis, die heutige Millionen-Metropole, war zu dieser Zeit eine Provinzstadt mit gerade einmal 400000 Einwohnern. Viele Häuser waren noch im italienischen Kolonialstil erbaut, das Öl sprudelte erst seit wenigen Jahren. Die libysche Revolution war vier Jahre alt – und der selbsternannte Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi ein noch unbeschriebenes Blatt.
Tripolis war meine erste Begegnung mit der Arabischen Welt. Hier funktionierte so ziemlich alles anders. Telefonieren mit Deutschland? Ein Ding der Unmöglichkeit. Hotels? Fehlanzeige. Würden wir Kairo jemals erreichen? Zum ersten Mal erlebte ich hier auch arabische Geschäftstüchtigkeit, die Fähigkeit, in Ausnahmesituationen schnell und unbürokratisch zu reagieren. Wir brauchten kein Hotel. Wir verbrachten die Nacht im Taxi.
In Ermangelung öffentlicher Verkehrseinrichtungen hatten die libyschen Taxifahrer kurzerhand eine Taxibrücke nach Kairo eingerichtet. Sie fuhren ihre Passagiere bis nach Alexandria und reichten die Reisenden – Diplomaten, Geschäftsleute, Geheimdienstler, Journalisten – dort an ihre ägyptischen Kollegen weiter. Dieses Geschäftsabkommen bedurfte keiner Verträge.
Schon seit Tagen waren diese Fahrer unterwegs. Und in entsprechender Verfassung. Sie witterten das Geschäft ihres Lebens. Unser Taxifahrer schien mit seinem alten »Peugeot 404« in einer Art symbiotischer Trance verbunden zu sein. Er fuhr nicht, er glitt, wie von unsichtbarer Hand geführt. Immer im vierten Gang, langsam, um Sprit zu sparen, wie er uns versicherte. Der »Peugeot 404« war damals der Käfer Nordafrikas. Er lief und lief und lief. Verzweifelt versuchten wir, uns mit dem Mann zu verständigen. Er sprach kein Englisch, wir kein Arabisch. Seine Augen wurden immer glasiger, seit Kriegsausbruch war er unterwegs – und hatte kaum geschlafen. Schon den sechsten Tag. Tripolis, Tobruk, El-Alamein, Alexandria. Immer hin und zurück. 1600 Kilometer eine Strecke, über löchrige Straßen und Sandpisten. Wie die meisten seiner Kollegen hielt er sich mit Haschisch bei Laune.
Wenige Stunden nach unserer Abfahrt tauchte das erste Wrack am Straßenrand auf. Unser Fahrer lachte und stieß ein unverständliches »Aouthbillah!« aus. Wie ich später erfuhr, ein beliebtes arabisches Stoßgebet, das »Gott bewahre!« bedeutet. Gottes Hilfe konnten wir gut brauchen. Immer wieder sahen wir ausgebrannte Fahrzeuge. Die völlig übermüdeten Fahrer waren von der Strecke abgekommen und verunglückt. Damit uns kein unheroisches Ende drohte, ließen wir unseren Fahrer nicht mehr aus den Augen. Was macht er? Schläft er ein? Wir versorgten ihn mit Wasser und Tee. Wir unterhielten ihn. Schwäbische Witze schienen ihn aufzuheitern. Aber wahrscheinlich hatte auch ich auf der langen Fahrt begonnen, zu halluzinieren.
Schließlich erreichten wir Salloum, die Grenzstation zu Ägypten. Stunden später erschien El-Alamein am Horizont, ein kleines Nest am Mittelmeer, wo die Wüste bis ans Meer heranreicht. Ein geschichtsträchtiges Stück Erde. Ich musste an Erwin Rommel denken, den »Wüstenfuchs«, meinen schwäbischen Landsmann, Vater des späteren Stuttgarter Oberbürgermeisters. Rommel war hier in der Wüste stecken geblieben, eine der kriegsentscheidenden Niederlagen während des Zweiten Weltkriegs. Der »Peugeot 404«, zum Glück, lief und lief. Jahrelang hatte das ägyptische 6000-Seelen-Städtchen mit seinen britischen und deutschen Soldatenfriedhöfen vom Kriegsgräbertourismus gelebt – bis 1966 Erdölvorkommen gefunden wurden, die dem Ort einen beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwung bescherten.
Jetzt lagen noch 110 Kilometer vor uns bis Alexandria, der Millionenstadt am Mittelmeer, eine der ältesten Städte der Menschheit. Im Altertum war Alexandria eine strahlende Metropole. Kleopatra, die letzte Pharaonin, regierte von dort aus Ägypten und führte ihr wüstes Leben mit Mord, Inzest und blutigen Machtspielen. Mehrere hunderttausend Schriftrollen, die in der weltberühmten großen Bibliothek und im Museion gelagert waren, begründeten den Ruf Alexandrias als Stadt des Wissens und machten sie zum geistigen Zentrum – aber auch zum begehrten Spielball der Mächte. Alle, die am Mittelmeer einmal die Macht hatten, sind hier gewesen. Die Griechen, die Römer, die Kreuzritter, die Türken, zuletzt die Briten. Und bei jeder Eroberung gingen historische Denkmäler verloren. London und New York schmücken sich heute noch mit den beiden einst unter Kleopatra erbauten Obelisken, die den Vorplatz des Kaisareions zierten.
Alexandria steht für die große Geschichte und die große Tragik der Arabischen Welt. Und selbst an das laszive Alexandria der 1950er-Jahre, das Lawrence Durell in seinem Alexandria-Quartett beschrieben hatte, erinnerte nichts mehr. Damals lebten Juden und Ägypter noch friedlich zusammen. Eine Metropole des Glamours. Jetzt war die Stadt nur noch ein Schatten ihrer selbst. Dazu passte, dass die alte, von Nasser abgehalfterte Elite hier ihrem Ende entgegendämmerte. Sie lebte vom Verkauf ihrer alten Empiremöbel-Kopien an europäische Antiquitätenhändler. Dunkle Figuren organisierten diese dubiosen Geschäfte.
Mir aber stand der Sinn nicht nach Historischem. Die Gegenwart war verwirrend genug. Alles kam mir merkwürdig vor – die Menschen, der Verkehr, die Gerüche. Wenig begriff ich von dem, was um mich herum passierte. Ich sprach kein Wort Arabisch und konnte die Schrift nicht lesen. Verzweifelt versuchte ich, Informationen über den Kriegsverlauf im Sinai und auf dem Golan zu bekommen – und stieß überall auf taube Ohren. Das Misstrauen gegenüber Ausländern war groß, jeder konnte ein israelischer Spion sein. Alles wurde immer unheimlicher.
Am frühen Abend starteten wir zur letzten Etappe, den letzten 200 Kilometern nach Kairo. Als es dunkel wurde, begann für uns ein Abenteuer der besonderen Art: Das ägyptische Taxi fuhr ohne Licht! Die ägyptischen Behörden hatten Verdunklung angeordnet, es war streng verboten, die...