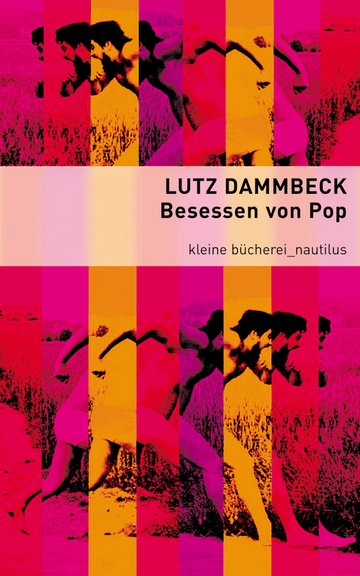I Kindheit
Langsam kam das Dröhnen und Rasseln näher. Ich kletterte auf die kleine Fußbank unter dem Wohnzimmerfenster und schaute auf die Adolf-Hitler-Straße, die nun schon seit acht Jahren Karl-Liebknecht-Straße hieß. In langen Kolonnen zogen russische Panzer in die Leipziger Innenstadt. Sie sollten dort den Aufruhr beenden, der am 17. Juni 1953 in Leipzig und anderen Städten der sowjetischen Besatzungszone aufgeflackert war. Auch mein Vater war mit einigen Jockeys von der Rennbahn am Leipziger Scheibenholz in die Innenstadt gelaufen, um sich das anzuschauen.
Mein Vater war Trainer für Rennpferde. Seit ich acht war, half ich in den Sommerferien im Stall aus. Ich führte die ruhigen Pferde zum Morgentraining, rieb sie danach mit Stroh trocken, fütterte sie und half bei der sommerlichen Heuernte. Mittags nahm mich mein Vater mit ins Café. Das lag im Barfußgäßchen in der Leipziger Innenstadt nahe dem Alten Rathaus. Dort trafen sich an den Wochentagen Jockeys, Trainer, Pferdebesitzer und Zocker, und ab und an gesellten sich auch hübsche und stark geschminkte junge Frauen dazu. Mir gefiel diese Mischung aus Sport, Zirkus und Geschäftemachen. Die Gespräche am Caféhaustisch drehten sich meist um den nächsten Renntag, um die Gewinnchancen für dieses oder jenes Pferd, aber oft auch um den verlorenen Krieg. Einer der Pferdebesitzer, Inhaber einer orthopädischen Werkstatt, wollte die Jockeyblusen seines kleinen Rennstalls in den Farben des Regiments gestalten lassen, in dem er bis zum Kriegsende als Leutnant gedient hatte. Ihm wurde von der Runde am Cafétisch abgeraten. Da gehst du ab nach Sibirien, hieß es, da verstehen die Russen keinen Spaß.
In den 1950er Jahren sorgten bald Gesetze und Verordnungen für das Verschwinden des sogenannten Mittelstands. Danach gab es kaum noch private Besitzer von Rennpferden. Stattdessen wurden »volkseigene« Rennställe gegründet, die Phantasienamen erhielten, was eine Vielfalt vortäuschen sollte, die nicht existierte. Auch das Pferderennen in der DDR war nun in einem einzigen volkseigenen Betrieb organisiert.
Einer der ehemaligen Pferdebesitzer, ein Bankbeamter, war mit einer Opernsängerin liiert. Die Sängerin war eine dramatische Erscheinung, die mich durch ihr üppiges schwarzes Haar und ihre riesigen angeklebten schwarzen Wimpern faszinierte. Sie schenkte meiner Mutter zwei Freikarten für eine Aufführung von Peer Gynt im Leipziger Schauspielhaus. Die weibliche Hauptrolle spielte eine der Leipziger Diven, Marilou Poolmann, die in einer Szene nackt unter einer Art Gazevorhang auftrat. Am nächsten Morgen betrachtete meine Mutter besorgt das Produkt meiner fiebrigen Jünglingsphantasien, das ich nächtens mit Hilfe des Schulmalkastens angefertigt hatte, und meldete mich in einem privaten Zeichenzirkel an.
Der wurde geleitet von einer ehemaligen Bauhausschülerin, Frau Gödel-Schütze, und fand in deren geräumiger Altbauwohnung statt. Dort trafen sich einmal in der Woche Kunstinteressierte verschiedenster Altersgruppen und Milieus, die zeichneten und aquarellierten. Frau Gödel-Schütze, die Käthe Kollwitz frappierend ähnlich sah, gab Korrekturen, wobei sie jedes Mal ihren mächtigen Busen an mich drückte. Ich war der Jüngste. In den Arbeitspausen wurden Schallplatten aufgelegt und über die Musik diskutiert. Meist war das Jazz, aber auch moderne Musik etwa von Olivier Messiaen. In den hohen, alle Wände des Malzimmers bedeckenden und bis unter die Zimmerdecke reichenden Regalen standen Kunstbände und Bücher von Böll und Grass, die man sich auch ausleihen durfte. Die mit Kunstwerken und Wohnutensilien zugemüllte und dunkel verhangene Wohnung war eine Klause, die mich eine erste Ahnung vom Geist der Kunst lehrte.
Während der Schulferien fuhr ich mit meiner Oma in ihr Heimatdorf in Oberfranken, das direkt hinter der Zonengrenze lag. Einer ihrer Cousins leitete dort eine Edeka-Filiale. Ich bekam während der vier Ferienwochen ein eigenes Zimmer. Das war ein kleiner Verschlag hinter einem Vorhang zum Laden, in dem ein altes Sofa stand und zahlreiche Lebensmittelkisten abgestellt waren. Allerdings war darunter auch ein kleiner Schatz: eine Rama-Kiste mit zerlesenen Westernheften, die ich bis tief in die Nacht im Schein meiner Taschenlampe schmökerte. Mit den Dorfkindern ging ich oft zu dem immer frisch geharkten Sandstreifen vor dem Stacheldrahtzaun, wo wir auf die Jeeps mit den amerikanischen Soldaten warteten, die uns Schokolade und Kaugummis schenkten. Im kleinen Gasthof des Ortes stand einer der wenigen Fernseher, dort sahen wir uns 1960 die Übertragungen von den Olympischen Spielen in Rom an.
Fuhr ich mit meinen Eltern an die DDR-Ostsee, machten wir in Westberlin Station und wohnten beim Bruder meines Vaters im Hansaviertel. Meine Mutter traf sich dann manchmal in einem der großen Hotels am Kudamm mit der Witwe ihres ehemaligen Arbeitgebers in Leipzig, dem Musikverleger Wilhelm Zimmermann. Während mir vom Zimmerkellner ein riesiges Wiener Schnitzel serviert wurde, tauschten die beiden Frauen Erinnerungen aus. Wilhelm Zimmermann galt nach den Nürnberger Rassegesetzen als Vierteljude. 1934 wurde er in die Reichsmusikkammer aufgenommen, aber später als »Nicht-Arier« wieder ausgeschlossen und stand dann im »Juden ABC der Musik«. Dass und wie er eine Arisierung wieder rückgängig machen und den Verlagsbetrieb bis Kriegsende in Leipzig am Laufen halten konnte, war oft Gegenstand von Gesprächen und Vermutungen bei Familientreffen gewesen. 1954, nach dem Tod des Verlegers, wurde der Verlag dann von Leipzig nach Frankfurt am Main verlagert.
Das Verhalten der Erwachsenen gegenüber dem Westen war für mich als Kind rätselhaft. Im neuerbauten Leipziger Zentralstadion, das hunderttausend Zuschauer fasste und in dem später die Massenübungen der Turn- und Sportfeste abgehalten wurden, spielte 1956 eine ostdeutsche Mannschaft gegen den 1. FC Kaiserslautern. Fast alle im Stadion unterstützten lautstark die Gäste aus dem Westen. Als Fritz Walter, einer der Helden von Bern, mit einem Fallrückzieher die Lauterer zum Sieg schoss, tobte das Stadion. Ich verstand das nicht. Das waren doch nicht Unsere, das waren doch Fremde! Aber die sind aus dem Westen, wurde ich von meinem Vater belehrt. Scheißkommunisten. Fast jeden Sonntag hörte sich die Familie gemeinsam nach dem Mittagessen eine Radiosendung im Rias an. Meist waren es Reden und Ansprachen von Politikern, die den Landsleuten im Osten versprachen, dass sich bald für sie etwas ändern würde. Reden, reden, immer nur reden, tut endlich was, schimpfte mein Vater. Es war das einzige Mal, dass ich ihn weinen sah. Schweigend löste sich die Familienrunde auf.
Es dauerte lange, bis wir einen eigenen Fernseher besaßen. Meist ging ich zu einem Schulfreund, um dort Westfernsehen zu gucken. Dieser Fernsehapparat wurde nun fast jeden Nachmittag zum regelmäßigen Treffpunkt nach der Schule, um Fury, Lassie, Texas Rangers, Wyatt Earp anzuschauen, abends war dann Richard Kimble auf der Flucht. An den Wochenenden waren wir oft bei einer ehemaligen Schulfreundin meiner Mutter eingeladen, um den neuen Durbridge oder Kulenkampff zu sehen. Als wir dann ein eigenes Gerät hatten, sahen wir im Familienkreis Familie Hesselbach, die Aktuelle Schaubude oder den Blauen Bock mit Heinz Schenk. Niemand aus meiner Klasse schaute sich die Sendungen im Ostfernsehen an, ausgenommen die Tochter eines Volkspolizisten, die deshalb von allen bemitleidet wurde.
Irgendwann in den 1950er Jahren begannen meine Eltern, zwei Zimmer unserer Wohnung an Messegäste zu vermieten. Die kamen aus dem Rheinland, eine Familie aus Gummersbach, Herr und Frau Schumacher, zwei Söhne, zwei Vertreter und ein Chauffeur. Die wohnten dann zum Teil in unserer Wohnung und auch bei anderen Familien im Haus, was meine Mutter organisierte. Zunächst handelte Herr Schumacher mit Stahldraht. Als die Firma in Insolvenz ging, vertrat er Canada Dry, und in unserer Wohnung stapelten sich unzählige Limonadenkisten. Dann handelte er wieder eine Zeit lang mit Schrauben, die er in der DDR und ČSSR produzieren ließ und dann im Westen verkaufte.
Die Firma Schumacher brachte alles, was für einen Messestand und dessen Betrieb nötig war, in großen Holzkisten mit, einschließlich einiger Fässer Kölsch. Die riesigen Kisten standen zunächst in unserer Wohnung, ehe sie zum Messegelände transportiert wurden. Zum Ritual, das zweimal im Jahr stattfand, gehörte, dass ich am Ankunftstag mit dem aus Weidenruten geflochtenen Wäschekorb meiner Mutter ins Wohnzimmer ging, wo Herr Schumacher in einem Sessel neben einer der geöffneten Kisten saß.
Ich hielt den Korb hin, und er griff in die Kiste und warf in schneller Folge Sardinenbüchsen, Schokolade, Zigaretten, Flaschen mit Wein, Whiskey und Campari, Dosen mit Würstchen und Gulaschsuppe, Kaffeebüchsen, Filtertüten und vieles mehr, was es im Osten nicht gab, hinein. Alles war bunt und roch gut.
Zur Frühjahrsmesse schauten sich Schumachers und meine Eltern gemeinsam die Übertragungen des Kölner Karnevals im Fernsehen an. Dazu trug man Hütchen, dekorierte mit Luftschlangen und tanzte...