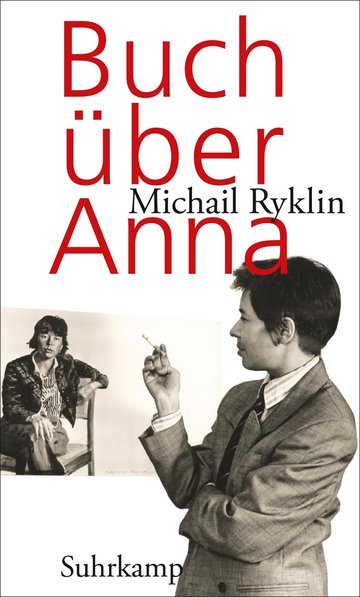I Tod in Berlin
19. März 2008. Früher Morgen im Berliner Flughafen Tegel. Verschlafene Passagiere trinken Kaffee aus Pappbechern.
Wir fliegen so früh, weil der Südwestrundfunk mich in eine Sendung gebeten hat, die um zehn Uhr beginnt.
In Stuttgart holt uns eine junge Frau vom Touristenbüro mit dem Auto ab, und während ich im Sender mit dem Moderator Wolfgang Heim spreche, zeigt sie Anna die Stadt.
Dann erwartet uns eine einstündige Fahrt nach Gschwend, wo am Abend mein Auftritt im »bilderhaus«, dem örtlichen Kulturverein, stattfinden soll.
Wir wohnen im »Romantikhotel Schassberger am Ebnisee«, einem kleinen, halbfamiliären Hotel, und Anna Altschuk und ich haben aus irgendeinem Grund das »Hochzeitszimmer« bekommen, das offensichtlich für Frischvermählte gedacht war. Als ich meiner Frau ins Russische übersetze, wie unser Zimmer heißt, lacht sie nervös auf. Das Zimmer ist gemütlich, sogar elegant: in Pastelltönen gehalten, die Sessel weiß bezogen, schwere Gardinen vor den Fenstern, Seeblick.
Als wir 1975 heirateten, machten wir keine Hochzeitsreise im klassischen Sinn, wir fuhren einfach für eine Woche zu Verwandten nach Leningrad; wenn wir die vorletzte Nacht in Annas Leben wie Jungvermählte in einem Hochzeitszimmer verbrachten, scheint sich der Kreis unseres gemeinsamen Lebens auf sonderbare Weise zu schließen.
Ich denke, Anna hatte das Symbolische der Situation genau erfasst.
Der Auftritt im »bilderhaus« verlief, wie solche Veranstaltungen über Russland üblicherweise verlaufen: am Beispiel der Ausstellung »Achtung, Religion!« ging es zum wiederholten Mal um die Unterstützung, die der Staat dem orthodoxen Fundamentalismus gewährt. Ich schloss mit den Worten: »Russland wird auf jeden Fall ein demokratisches Land werden, schade nur, wenn das ohne die Unterstützung Europas geschieht« – wofür ich Applaus erntete.
Nach dem Auftritt kamen zwei alte Damen, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, zu uns und erzählten, dass während der Veranstaltung ein sonderbarer Unbekannter (in diesem Klub kannten die Leute einander fast alle) im Saal gewesen sei; er sprach mit – wie sie meinten, slawischem – Akzent, benahm sich aggressiv, empörte sich lautstark, und als man, um ihn zu besänftigen, fragte, wer er sei, stellte er sich als unser Personenschutz vor.
Natürlich haben wir nie Personenschutz gehabt.
Die Bühne war hell erleuchtet, sodass ich die hinteren Reihen nicht erkennen konnte. Aber den Mitarbeiterinnen kam dieser Typ gefährlich vor, sie wiederholten mehrfach »Seien Sie vorsichtig!«. Ich nahm die Sache scherzhaft auf: »Das Schlimmste kann man über mich im Internet lesen.« Und Anna, der das Gespräch übersetzt wurde, lachte und sagte: Mit erbosten Leuten kann man uns nicht in Erstaunen versetzen, wir haben die letzten Jahre in Moskau ganz andere Dinge gesehen.
Nach unserer Rückkehr ins Hochzeitszimmer liebten wir uns wie »Jungvermählte«; einer flüchtigen Bemerkung Anjas am nächsten Morgen entnahm ich, dass sie sich an nichts erinnerte. Ich zuckte innerlich zusammen.
Vor dem Frühstück badeten wir im Swimmingpool und freuten uns an den blauen Lichtreflexen, die an der gläsernen Decke spielten. Dann fuhr uns die Künstlerin Brigitte Marquardt in ihrem Auto nach Stuttgart, wir liefen den ganzen Tag durch Ausstellungen, und schließlich nahm sie uns mit in ihr Atelier, um uns ihre Arbeiten zu zeigen. In einem Café im Stadtzentrum aßen wir zu Mittag.
Auf der Rückreise war ich so müde, dass ich auf dem Stuttgarter Flughafen meinen Schal verlor und in Berlin die Wollmütze.
Am 21. März wachten wir gegen Mittag auf. Ich schaltete einen Moskauer Radiosender ein: ein Interview mit einem Soziologen, den ich als gebildeten Menschen und guten Übersetzer kannte; jetzt sang er ein Loblied auf Stalin, verlangte die Einführung einer religiös-patriotischen Erziehung an den Schulen und schimpfte auf die Demokraten.
Zugegeben, wir hatten uns an solche »Überraschungen« gewöhnt, aber die Stimmung hoben sie nicht.
Vor dem Frühstück fing Anna plötzlich damit an, wie schlecht sie sich vor einer Woche auf der Buchmesse in Leipzig gefühlt habe, wie schlecht es ihr überhaupt gehe. Bis dahin hatte sie die kurze Reise gelobt, alles hatte ihr gefallen, und jetzt … Meine Laune ging in den Keller, und während des Frühstücks schwieg ich gekränkt.
Dann sprach Anna plötzlich von zwei Frauen, die den Kontakt zu ihr gesucht hätten, sie habe sie zurückgestoßen, und heute tue es ihr sehr leid. In den letzten Monaten bekam das, was sie sagte, überhaupt etwas Neues, rätselhaft Endgültiges, als ob sie einen Punkt setzen, Bilanz ziehen wollte. »Wir werden auch in einem Jahr in Berlin leben …« – »Nein, du wirst in Berlin leben«.
Und nun, nach der Erwähnung der beiden Frauen, sagte Anja, dass sie sich an keine weiteren Handlungen erinnere, die ihr heute leid täten, dass sie im Leben niemanden gehasst habe … Ich fuhr aus der Haut: »Du hasst mich!« Sie zuckte zusammen, wie von einem Stromstoß getroffen, ihr Gesicht verzog sich wie nach einem schweren Schlag. Danach sprachen wir wenig.
Wir brauchten eine Überdecke für unser Bett und fuhren zum »Zillehof« in die Fasanenstraße, wir hatten auf diesem Trödelmarkt schon oft für wenig Geld alle möglichen Kleinigkeiten gekauft. Dass Karfreitag war und alle Geschäfte geschlossen hatten, wussten wir nicht.
Auf der Rückfahrt im Doppeldeckerbus blieb Anna unten sitzen. Als ich zum Aussteigen herunterkam, fiel mir auf, dass sie wie ein Spatz zusammengekauert hockte, sehr angespannt, als wollte sie eine Entscheidung treffen. Nicht zum ersten Mal in diesen Wochen hatte ich ein ungutes Vorgefühl.
Zu Hause stürzte sie zum Telefon und rief zwei Freundinnen an, um sich zu verabreden. Aber die eine litt nach ihrer Strahlentherapie an Fieber, die andere hatte Grippe. Ich saß auf dem Ledersofa im Wohnzimmer und hörte aufmerksam zu. Die letzten Wochen verfolgte ich Anna ständig mit dem dritten Auge, einem Organ, das sich unweigerlich meldet, wenn das Verhalten deiner Nächsten plötzlich unberechenbar wird. Das Gespräch schien mir ganz unverdächtig – mit der einen Freundin verabredete sich Anna für den übernächsten Tag, mit der anderen für Anfang der kommenden Woche.
Dann machte sie sich ein paar Minuten im Flur zu schaffen, kam wieder herein und erklärte, sie werde zu »Kaiser’s« gehen und etwas zu essen einkaufen, außerdem hätten wir kein Waschpulver mehr.
Als nach Anja gesucht wurde, zerbrachen sich die Journalisten den Kopf darüber, wohin denn »diese sonderbare Russin« am Karfreitag gegangen sein könnte – es war ja alles zu; russische Journalisten stellten sich vor, sie sei in einen nahe gelegenen russischen Laden gegangen, denn das orthodoxe Osterfest lag später.
In Wirklichkeit war alles ganz simpel: Wir lebten das erste Jahr in Deutschland, waren spät in der Nacht aus Stuttgart zurückgekommen, völlig übermüdet, und weder sie noch ich hatten überhaupt begriffen, dass Feiertag war und alles ringsum geschlossen.
An dieser scheinbaren Kleinigkeit lässt sich ablesen, in welchem inneren Zustand wir uns befanden.
Den Satz »Ich gehe zu ›Kaiser’s‹ Waschpulver kaufen« sprach sie vollkommen natürlich aus, er weckte bei mir keinen Verdacht.
Ich blieb auf dem Sofa sitzen und las. Dass es ihre letzten Worte gewesen waren, kam mir erst drei Wochen später zu Bewusstsein.
Die drei Stunden nach Anjas Weggehen war ich in mein Buch vertieft.
Ich wunderte mich nicht – Anja hatte in Berlin viele Freunde, die ich zum Teil gar nicht kannte: Vielleicht war sie zu ihnen gegangen, wie sie es schon ab und zu getan hatte.
Ich schrak erst auf, als ich merkte: sie hatte ihr Handy dagelassen, und auf dem Küchentisch lagen ein paar nachlässig zerknüllte Zehneuroscheine.
Ich begann überall anzurufen – sie war nirgends.
Verzweifelt rannte ich hinunter zum S-Bahnhof vor unserem Haus. Das Wetter war entsetzlich, Schneeregen, starker Wind; in meinem Kopf trudelte aus irgendeinem Grund Puschkins »Alles war Nacht und Wirbelsturm«1. Ich stand lange auf dem Bahnsteig, und als ich schließlich vor Kälte schlotterte, ging ich nach Hause, um mich aufzuwärmen. Ich lief um den Lietzensee, versuchte Anna im Finstern, beim trüben Licht der wenigen Laternen auszumachen und dabei die unerträgliche Spannung loszuwerden oder wenigstens ein klein wenig abzubauen.
Dann wieder der Bahnsteig, wieder der Lietzenseepark, vier Stunden rannte ich hin und her.
Warum habe ich nicht gleich die Polizei gerufen? Erstens aus tief sitzendem Misstrauen gegenüber Vertretern des Staates, Menschen in Uniform – ihre Hilfe nimmt man als gelernter Sowjetbürger nur im Extremfall in Anspruch. Zweitens war niemand da, mit dem ich mich hätte beraten können – ausgerechnet an diesem Tag war keiner meiner nächsten...