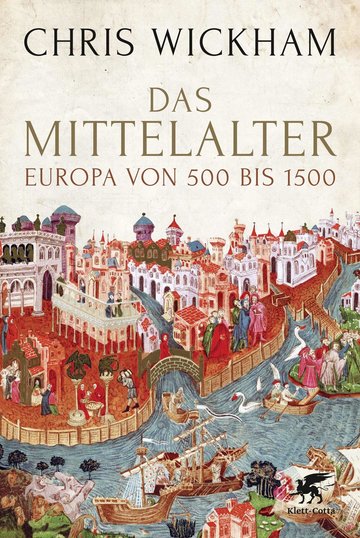2
Rom und seine Nachfolger im Westen, 500–750
Warum ging das Römische Reich unter? Die Antwort lautet kurz gesagt: Es ging überhaupt nicht unter. Die Hälfte des Reichs, die östliche Hälfte (der heutige Balkan, die Türkei, die Levante und Ägypten), die von Konstantinopel aus regiert wurde, bestand während der Phase des Zusammenbruchs des Reichs und der Eroberung durch von außen kommende Völker in der Westhälfte (dem heutigen Frankreich, Spanien, Italien, Nordafrika und Britannien) im 5. Jahrhundert unangefochten fort; das Reich im Osten überlebte sogar, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, die massiven Angriffe im 7. Jahrhundert. Ostrom – wir bezeichnen es im weiteren Verlauf als das byzantinische Reich, obwohl diejenigen, die dazugehörten, sich bis zu seinem Ende Römer nannten –, Ostrom also hatte weitere tausend Jahre lang Bestand, bis zur Eroberung der letzten Überreste durch die osmanischen Türken im 15. Jahrhundert. Anschließend arbeiteten die Osmanen mit vielen steuerlichen und verwaltungstechnischen Strukturen der römischen beziehungsweise byzantinischen Vergangenheit am Aufbau ihres eigenen Staates weiter, ausgehend von ihrer neuen Hauptstadt Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Es wäre in gewisser Hinsicht gar nicht falsch zu sagen, dass das Römische Reich bis zum Ersten Weltkrieg – bis zum Zusammenbruch des osmanischen Staats – überdauerte.
Ich möchte damit nicht das Bild einer Vergangenheit heraufbeschwören, die sich nie verändert; in der Gegenwart gibt es immer Elemente aus der Vergangenheit, was aber nicht ausschließt, dass gewaltige Veränderungen stattfanden – natürlich vollzogen sich im byzantinischen Reich manche solcher Veränderungen. Es geht aber um etwas anderes. Wenn wir es mit hoch bedeutsamen Ereignissen zu tun haben – dem Ende des Friedens in Europa im Jahr 1914, dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 –, dann tendiert die Zunft der Historiker dazu, sich zu spalten in diejenigen, die in der Katastrophe eine Unvermeidlichkeit sehen, mit strukturellen, häufig schon lange vorliegenden Gründen, die nun einfach in einem plötzlichen Umschwung aufeinandergetroffen sind, und auf der anderen Seite diejenigen, welche die Ereignisse als reinen Zufall betrachten, als Ergebnis kurzfristiger, fast beiläufiger politischer Entscheidungen; oder, wenn sie differenzierter urteilen, in solche, die in der vorliegenden Mischung aus strukturellen und politischen Gründen mehr Gewicht auf ersteren, und in solche, die mehr Gewicht auf letzteren Bereich legen.
Ich persönlich neige größtenteils eher zur strukturellen Seite. Wenn wir uns allerdings das Römische Reich im 5. Jahrhundert anschauen, dann funktionieren Langzeit-Erklärungen für den Zusammenbruch des Reichs im Westen nicht sonderlich gut, weil sie so offensichtlich die andere Hälfte der römischen Welt gar nicht betreffen. Einige strukturelle Antworten können zwar gegeben werden: Der Westen könnte im Vergleich zum Osten fragiler gewesen – oder geworden – sein, wäre also stärker für Invasionen anfällig gewesen; die Tendenz, welche bereits im 3. Jahrhundert eingesetzt und sich im 5. Jahrhundert allgemein durchgesetzt hatte, das Reich als zwei separate Hälften zu regieren, weil dies logistisch praktischer war, diese Tendenz könnte sich schädlich ausgewirkt haben auf den Zusammenhalt innerhalb des Reichs und auf die Fähigkeit, auf diese Bedrohung angemessen zu reagieren. Faktisch wurde im Kontext der über zweihundert konkurrierenden Erklärungen für Roms »Untergang« jedes dieser Argumente von irgendjemandem mit einer je eigenen Plausibilität angeführt.1 Doch in diesem speziellen Fall sind zufällige Entscheidungen, manchmal schlichte menschliche Irrtümer, überzeugender. Unser Ausgangspunkt in diesem Buch ist das Jahr 500, also ungefähr der Beginn des Mittelalters, wir könnten daher im Prinzip den im 5. Jahrhundert gerade noch römischen Westen einfach auslassen, weil er für unser Vorhaben in eine zu frühe Periode fällt. Doch sollten wir zu Beginn doch besser einen Schritt zurück tun, um zumindest einen kurzen Blick auf einige dieser Entscheidungen zu werfen, da sie sich auf das, was später geschah, so gravierend auswirkten. Und eine wichtige Konsequenz ergibt sich aus dieser Sachlage dennoch: Hätte es im westlichen Reich im Jahr 400 keine ernsthaften strukturellen Schwächen gegeben, dann hätten viele Elemente der Reichsstruktur sehr wahrscheinlich die Krise des 5. Jahrhunderts überstanden. Das war in der Tat der Fall, und wir werden diesen Sachverhalt im weiteren Verlauf dieses Kapitels näher beleuchten.
Die Nordgrenze des Römischen Reichs zog sich quer durch das heutige Europa, entlang der Flüsse Rhein und Donau, in Britannien entlang des Hadrianswalls. Durch sie entstand ein scharfer Kontrast zwischen dem Norden und dem Süden, nicht nur hinsichtlich der politischen Zugehörigkeit, sondern auch in den Bereichen Kultur und Wirtschaft: ein Kontrast, der das Ende des Reichs im Westen noch auf Jahrhunderte hinaus überlebte. Die römische Welt war bei aller internen Vielfältigkeit in gewisser Hinsicht auch erstaunlich homogen: Sie wurde durch ein Netzwerk von Straßen zusammengehalten, das Städte miteinander verband, in denen häufig bemerkenswert ähnliche öffentliche Gebäude, überwiegend aus Stein, standen.
»Städtischkeit« (Civilitas) mit all den Untertönen von Kultiviertheit und Zivilisation, die das lateinische Wort auch heute noch vermittelt, definierte das Selbstbild der römischen Oberschicht; eine Ausbildung in klassischer lateinischer Literatur (griechischer Literatur im griechischsprachigen östlichen Teil des Reichs) und die Fähigkeit, sich formvollendet auszudrücken, waren Bestandteil des Aristokraten-Status. Ähnlich römisch war eine extreme soziale Ungleichheit; es gab in der römischen Welt immer noch viele Sklaven, große Unterschiede zwischen Reich und Arm und damit einhergehend einen starken Standesdünkel. All das gehörte in jeder Periode des Römischen Reichs zu dessen Komplexität. Mittlerweile hatte sich im Imperium zumindest in der herrschenden Klasse das Christentum durchgesetzt, und zu dieser Mischung gesellte sich jetzt auch noch christliche religiöse Literatur. Bischöfe begannen nun, der Senatoren-Aristokratie den Rang streitig zu machen, doch im Hinblick auf die sozialen Ungleichheiten änderte sich nicht viel (nur wenige christliche Theologen kamen beispielsweise trotz der Gleichheit proklamierenden Vorstellungen des Neuen Testaments auf die Idee, dass Sklavenhaltung falsch sein könnte).2
Der Unterschied zu dem, was die Römer als die »barbarische« Welt im Norden bezeichneten, war beträchtlich. Die wirtschaftlichen Strukturen waren dort sehr viel weniger entwickelt, dasselbe galt für die lokale materielle Kultur. Auch politische Gruppierungen waren viel kleiner und einfacher, häufig auch sehr instabil; die Identitäten änderten sich je nach der Verfassung der gerade herrschenden unterschiedlichen Familien. Unmittelbar nördlich von Rhein und Donau sprachen die meisten dieser Gruppierungen germanische Sprachen, wobei dieser Umstand weder von ihnen selbst noch auch von den Römern als Kennzeichen einer entscheidenden Gemeinsamkeit angesehen wurde. (Die Wörter »barbarisch« und »germanisch« verwende ich im Folgenden nur der Einfachheit halber.) Natürlich waren die »barbarischen« Völker, vor allem deren Anführer, sehr am Reichtum Roms interessiert und versuchten, für sich selbst etwas davon zu sichern – entweder durch Überfälle auf römisches Gebiet oder sogar Invasionen, oder aber indem sie sich in den bezahlten Dienst des römischen Heers stellten. Entlang der Grenze erstreckte sich eine Grauzone: stärkere römische Militärpräsenz auf der...