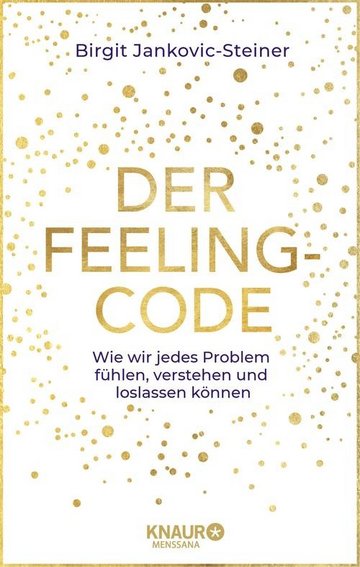Einleitung
»Ich weiß einfach nicht, was ich noch tun soll!«
Marina Schneider sah mich an. Die Augen meiner Klientin waren weit aufgerissen und glänzten. An ihrem Hals hatten sich nervöse Flecken gebildet. Ich seufzte innerlich. Denn auch ich war mittlerweile mit meinem Latein am Ende.
Seit einem Jahr kam Marina Schneider nun schon zu mir in die psychosoziale Beratung, um mit mir über ihr schwieriges Verhältnis zu Männern zu sprechen. Die gestandene Businessfrau hatte ein Problem: Sie wurde in nahezu jeder Partnerschaft betrogen. Immer und immer wieder. Seit Jahren.
Zu Beginn unserer Treffen war ich zuversichtlich gewesen, dass die eigentlich sehr selbstsicher auftretende Mittvierzigerin bald schon die Kurve kriegen würde. Klar, über Nacht ändert niemand sein Beziehungsverhalten. Und aus vielleicht sogar über Jahrzehnte antrainierten Beuteschemata auszubrechen, das fällt keinem leicht. Aber ich war mir sicher gewesen, dass sie, nachdem wir ihrem Problem einmal auf den Grund gegangen waren, bald schon Mittel und Wege finden würde, um sich künftig andere Männer auszusuchen.
Doch nun, ein Jahr und Dutzende Sitzungen später, war ich genauso ratlos wie meine Klientin selbst. Sie hatte in der Beratung mit mir die zerbrochene Beziehung zu ihrem Ex-Mann, das schwierige Verhältnis zu ihrem früh verstorbenen Vater, ihre Kindheit, die Themen, die sie mit ihrer Mutter hatte, und die größten Krisen ihres Lebens besprochen und aufgearbeitet. Sie war selbstkritisch und ehrlich gewesen und hatte nie ein Blatt vor den Mund genommen. Wir hatten eine Familienaufstellung gemacht, systemische Maßnahmen besprochen, ich hatte sie sogar zu einem Hypnosetherapeuten geschickt – und dennoch zog sie die untreuen Männer an wie der Honig die Bären. Selbst die nettesten Kerle, die auf den ersten, den zweiten und sogar auf den dritten Blick wie die perfekten Schwiegersöhne wirkten und allem Anschein nach keiner Fliege etwas zuleide tun konnten, gingen nach wenigen Wochen fremd. Und weil Marina Schneider mittlerweile hinter jeder Ecke einen Seitensprung witterte, bekam sie es jedes Mal mit und zerbrach beinahe daran.
Ich war ehrlich verzweifelt. Denn ich wollte ihr so gern helfen. Sie weinte oft in unseren Sitzungen, und ich spürte ihren innigen Wunsch, endlich einen Menschen zu finden, auf den sie sich wirklich verlassen konnte. Da war etwas, das spürte ich intuitiv, was sie davon abhielt, sie selbst zu sein – doch es verbarg sich vor mir. Und vor ihr. Ich kam zu dem Schluss, dass Marina Schneider selbst gar nicht wusste, was sie so blockierte. Vielleicht war es etwas, an das sie sich nicht erinnerte – weil ihre Seele es so gut in ihrem Unterbewusstsein versteckt hatte, um nicht mehr davon verletzt zu werden. Doch wie kam ich an diese Erinnerung heran? Wie konnte ich meiner Klientin zu mehr Glück in ihren Beziehungen und ihrem Leben verhelfen? Wie konnte ich ihr wirklich helfen?
Natürlich wusste ich, dass mir in gewisser Hinsicht die Hände gebunden waren, denn letztendlich konnte ich sie auf dem Weg der Erkenntnis nur begleiten und vielleicht ein Lichtlein halten, nicht jedoch die entscheidenden Schritte machen. In meiner Hilflosigkeit suchte ich mir Rat bei anderen Therapeuten und besprach das Dilemma auch in der Supervision.
»Es gibt eine unbestimmte Traurigkeit in meiner Klientin, die ich einfach nicht zu fassen kriege. Meine Intuition sagt mir, dass diese Traurigkeit, dieses Gefühl des Nicht-Genügens, etwas damit zu tun hat, dass sie immerzu betrogen wird. Aber ich weiß nicht, was ich noch tun kann.«
Auch meine Kollegen waren überfragt. Sie empfahlen mir erneut die Hypnose, rieten mir, mich mit noch erfahreneren Therapeuten zusammenzuschließen, doch letztendlich waren sie genauso ratlos wie ich.
Nun saß Marina Schneider vor mir, das Gesicht in den Händen vergraben, und schüttelte verzweifelt den Kopf. »Immer gerate ich an die Falschen. Ich sollte aufhören, irgendjemanden an mich heranzulassen, dann werde ich auch nicht mehr verletzt. Es ist wie ein Fluch, der auf mir liegt!« Plötzlich richtete sie sich auf, wischte sich die verschmierte Wimperntusche aus den Augenwinkeln und sagte: »Frau Jankovic-Steiner, Sie haben mich nun so intensiv begleitet. Aber ich denke darüber nach, den Rat meiner Freundin zu befolgen. Sie war bei einem Alternativmediziner, der ihr geholfen hat … Vielleicht hat der ja eine Idee.«
»Ja, vielleicht«, erwiderte ich zögerlich. Ich bin grundsätzlich dafür, alle Register zu ziehen, wenn es um das Seelenheil meiner Klienten geht. Gleichzeitig hatte ich eine Ahnung, dass es sich für Marina Schneider nicht auszahlen würde, ihre Sorgen zu einem Kollegen zu tragen. Hieß es nicht, dass viele Köche den Brei verdarben? Andererseits: Ich kam ja auch nicht weiter! Und es ging ihr schlecht – das war unübersehbar.
Als Marina Schneider gegangen war, grübelte ich noch lange über ihre Worte nach. Auf der einen Seite fand ich es schrecklich, wie viele Menschen in der Hoffnung auf Heilung, sei es von psychischen oder physischen Erkrankungen, von Pontius zu Pilatus rennen. Doch im Grunde werden immer nur die Symptome behandelt, selten die Ursachen, vor allem dann, wenn man andauernd den Therapeuten und die Behandlung wechselt. Denn die Hoffnungslosen fühlen sich oft gezwungen weiterzumachen, wenn eine Methode nicht klappt – nur eine Therapiestunde noch, nur einmal mehr eine Tür aufstoßen, einen Versuch noch wagen, und dann kommen sie vielleicht endlich ihrem Lebensglück ein Stück näher.
Aber kaum einer wird geheilt. Stattdessen geht es den Menschen, die derart verzweifelt auf der Suche sind, sogar schlechter. Denn mit jedem Mal, wenn die Resultate ausbleiben, die Therapie nach einer Erstverbesserung am Anfang nicht mehr anschlägt oder die Wirkung des Seminars nach nur drei Tagen nachlässt, werden sie hoffnungsloser. Wieder ein Rückschlag! Wieder keine Besserung in Sicht. Und am Ende verdienen vor allem die Therapierenden.
Die besten Therapeuten sind doch jene, dachte ich, als ich am Abend mit einem Glas Wein auf dem Sofa saß und über Marina Schneiders Verzweiflung nachdachte, denen das Leben ihrer Klienten wirklich am Herzen liegt. Die sie uneigennützig begleiten und ihnen sagen: »Suchen Sie nicht im Außen, was Sie im Innen finden müssen. Kein anderer weiß, wie es sich anfühlt, in Ihrer Haut zu stecken. Nur Sie selbst können dafür sorgen, dass es Ihnen gut geht.«
In diesem Moment, als ich in all meiner Selbstgerechtigkeit und Zufriedenheit in meiner schicken Wohnung auf dem nicht gerade günstigen Sofa saß und einen sehr guten Rotwein genoss, wurde mir schlagartig klar, dass auch ich nur deshalb ein so schönes Leben genießen konnte, weil es Menschen gab, die voller Hoffnung in meine Praxis kamen und sich von mir behandeln ließen. Menschen, die in mir, dem Außen, nach einer Lösung für die Probleme in ihrem Inneren suchten. Menschen wie Marina Schneider.
Mit einem Mal schmeckte der Rotwein schal. Ganz langsam stellte ich das Glas auf den Couchtisch, während die Rädchen in meinem Kopf zu rotieren begannen. Ich übte meinen Beruf mit Freude aus und zog viel Befriedigung daraus, wenn ich sah, dass es meinen Klienten am Ende einer Sitzung oder Therapie besser ging als zuvor. Und ja, ich genoss auch die Position, die ich im Leben einiger Menschen einnahm, da ich als Beraterin in vielen Situationen fungierte. Ich hatte immer eine Idee oder Inspiration, wie meine Klienten ihr Leben anders gestalten oder einen Konflikt lösen konnten.
Aber verteilte ich nicht auch Ratschläge wie die »Weisheit in Person«? Als hätte ich schon alles gefühlt und erlebt? Wie weit war es um meine Fähigkeiten als Beraterin überhaupt bestellt, wenn ich einer Frau wie Marina Schneider nicht helfen konnte, ein glücklicheres Leben zu führen? War ich eigentlich in der Lage, über die Situation anderer Menschen zu urteilen, wenn ich nicht wusste, wie es sich anfühlte, in ihrer Haut zu stecken?
Tief in meinem Inneren wusste ich die Antwort auf meine Fragen: Kein Mensch, auch wenn er noch so viele psychologische, pädagogische oder medizinische Ausbildungen absolviert hat, kann wissen, wie sich das Leben eines anderen anfühlt. Natürlich kann es wichtig und nützlich sein, sich in bestimmten Lebenslagen, vor allem an Weggabelungen und vor großen Entscheidungen, Meinungen von außen einzuholen. Aber wer war ich, diese Person sein zu wollen?
Ich ging an diesem Abend mit einem unguten Gefühl ins Bett, das sich in den kommenden Tagen noch verstärkte und mich auch nach Wochen noch nicht losließ. Die Beratungssitzungen fielen mir immer schwerer; die Zweifel, ob das, was ich meinen Klienten anbot, für sie überhaupt von Nutzen war, erdrückten mich. Schließlich entschied ich, die Arbeit als psychosoziale Beraterin für einige Monate einzustellen. Ich verspürte den dringenden Wunsch, etwas in meinem Leben und meinem Arbeiten zu verändern. Und auch wenn ich keine Ahnung hatte, was diese Veränderung sein oder bewirken konnte, wusste ich: So, wie ich es bislang getan hatte, kam ich nicht mehr weiter.
Aus einem Impuls heraus beschloss ich, für ein paar Tage in ein Naikan-Retreat zu gehen, eine Art japanisches Schweigekloster. Denn immer wieder kam mir ein Satz in den Sinn, den ich zu Beginn meiner Krise gedacht hatte: »Such nicht im Außen, was du im Innen finden willst.« Und wo könnte ich besser zur Ruhe und zu meinem Inneren finden als in einer vollkommen stillen Umgebung?
Als ich vor dem alten Bauernhaus stand, irgendwo weit weg von allem, kam mir meine Idee allerdings gar nicht mehr so gut vor. Mein Handy hatte ich zu Hause gelassen. Ich fragte mich, wie es mir möglich sein sollte, ohne Kommunikation zur Außenwelt, ohne Bücher und ohne meine geliebten...