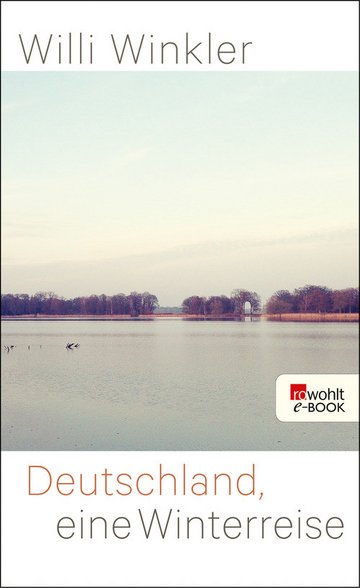4
Im Nachbarort Eschede hat sich 1998 das furchtbare Eisenbahnunglück ereignet; 101 Menschen starben, als der ICE 884 gegen die überführende Brücke donnerte. Ein Denkmal erinnert daran. Eine Zeitlang hat der ICE aus Respekt vor den Toten bei der Durchfahrt gebremst, aber das ist länger her. Die Druckwelle der gut zweihundert Stundenkilometer bricht sich an den Kiefern am parallel laufenden Weg. Der Tag hat im Regen begonnen, was endgültig ausschließt, dass sich sonst noch jemand draußen aufhält. Irritierend nur das selbsterzeugte Dauergeräusch der Plastiküberhose. Die Öde oder doch die Heide verschlingt mich.
Jeder Mensch sollte wenigstens einmal im Leben in Bargfeld gewesen sein, diesem Nicht-Ort in der südlichen Heide, in dem Arno Schmidt die letzten einundzwanzig Jahre seines Lebens zubrachte, ehe er in Celle starb, 1979. Für den gesteigerten Bedarf oder zur Irreführung allzu neugieriger, aber nicht hundertprozentig kartensicherer Schmidt-Leser gibt es Bargfeld sogar zweimal und nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Im richtigen Bargfeld (hundertachtundachtzig Einwohner, Stand 2005), zwanzig Kilometer südöstlich von dem Nicht-Ort Unterlüß, kaufte sich Arno Schmidt 1958 von seinen Rundfunkhonoraren ein Heidehäuschen und versteckte sich dort vor der Welt, die ihn eben als großen Autor wahrzunehmen begann. Inzwischen hat es «der bekannte Schriftsteller», der er nie war und bestimmt nie sein wollte, auf eine amtliche niedersächsische Wandertafel mit erstaunlich vielen Rechtschreibfehlern gebracht. Arno Schmidts Haus steht sicher verwahrt hinter efeuumrankten Bäumen: blaugrau gestrichenes Holz, klein, sehr klein. Unter einem Findling, in einer leicht böcklinschen Szenerie, liegt er begraben.
Hier in Bargfeld hat er «Zettel’s Traum» geschrieben (der Schriftsteller Stephan Wackwitz nennt das Werk kurz und brutal «Große Kunst und kompliziert ausgearbeiteter Dachschaden»), hinter «6 Fuß hohem Zaun – Maschendraht, mit 2 Schnüren Stacheldraht darüber», der ihm die Sicherheitsverwahrung garantierte, und wenn ihm nach Urlaub vom Schreibtisch war, ging er mit Fernglas und Frau, die das regelmäßig im Foto dokumentierte, in den Wald, in die nicht furchtbar wirtliche Südheide, und fand das offenbar abenteuerlich oder doch erholsam genug, dass er gleich wieder an den Schreibtisch zurückkehrte und weiterschrieb, selbstverständlich nie, ohne der Welt, von der er sich so radikal verabschiedet hatte, bei jeder zweiten Gelegenheit mitzuteilen, wie wenig sie seinen dichterischen Ansprüchen genügte. In den Fünfzigern beschimpfte er Adenauer und Goethe, verlangte, was ihn praktisch zum Kommunisten machte, Gespräche mit der gottseibeiunsigen «DDR» und fürchtete den allfälligen Weltuntergang durch die atomare Hochrüstung. Als er trotzdem den Goethe-Preis erhielt, höhnte er über die «40-StundnWöchner», seine Arbeitswoche habe immer ihre gut hundert Stunden betragen. Allein, versorgt selbstverständlich von einer gutwilligen Frau, wenn auch manchmal nur mit einer Diät auf der Basis von «Maggi pur» und dem einen oder anderen Schluck «Alte Kanzlei», einem für Nichtniederdeutsche ungenießbaren Branntwein, wirkte er im Verborgenen, ein Teil der Heide, selbst für größte Verehrer kaum ansprechbar. Rudolf Augstein soll ihn heimlich aufgesucht haben, Günter Herburger schnallte sich Ski unter und kam durch die Heide und den Schnee, um hier niederzuknien und anzubeten. Dies demonstrative Einsiedlertum, während die wirkliche Welt draußen ihn bis knapp vor den Nobelpreis hochfeierte, hat etwas ungeheuer Rührendes. «Die ‹Wirkliche Welt›? : ist, in Wahrheit, nur die Karikatur unsrer Großn Romane!» Wenn’s nur so wäre!
Eine Motorsäge sägt aufmunternd durch das sonst erstorbene Dorf. Der Platz in der Mitte ist für Größeres bestimmt, das aber längst fort ist oder einfach nie kam. In der Gaststätte Bangemann, stolze Adresse «Unter den Eichen», ist es lähmender Samstagmittag. Rauch hängt in der Luft von einer Weihnachtsfeier am Vorabend. Auf Nachfrage gibt es nur eine üble Currywurst. (Fände einen jemand, wenn man danach mit einer Kolik im Wald zusammenbricht?) Aber es ist kalt, ich habe Hunger, es muss sein. Der Wirt steht rauchend im Nebenraum, hakelt mit seinem nörgelnden Sohn um ein neues Handy und kann es nicht erwarten, strengste Schmidt-Schule, dass ich wieder verschwinde.
Das ist tiefes Niedersachsen, immer noch das erste Bundesland seit Hamburg. Schneller geht es aber nicht. Selbst wenn ich mit morgenfrischer Kraft und einer Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde losmarschiere, werde ich vom Asphalttreten so müde, dass es sich zum Abend hin auf vier Kilometer verlangsamt. Das sind pro Tag, denn der Tag ist im Winter kurz, fünfundzwanzig, dreißig, fünfunddreißig Kilometer. An guten, also an besonders schlimmen Tagen werden es mehr als vierzig: dann nämlich, wenn sich im nächsten Dorf kein Zimmer findet, aber vielleicht im übernächsten, zehn Kilometer weiter.
Im nächsten Ort gebe es eine Raststätte, verspricht die Frau, in der habe es Zimmer. Es ist längst dunkel, der Tag war lang, regen- und schmidtreich, ich habe allmählich genug von der Heide, aber Hohne noch nicht genug vom Weihnachtsmarkt. Die freundliche Frau will eben ihr Café schließen, es komme jetzt doch keiner mehr. Und nein, in Hohne selbst gebe es leider nichts. Aber sie telefoniert für mich herum, weil sie sich, ist doch Advent, meiner erbarmt. Man erwarte mich in der «Heidequelle». «Das ist nicht mehr weit; am besten gehen Sie gleich durch den Wald.» Im Nebenzimmer fertigt sie Gestecke und flicht die saisonal fälligen Zierkränze. «Sind Sie auf Pilgerschaft?», fragt sie vage interessiert und setzt das übliche «Bei diesem Wetter!» hinzu. Das Wetter muss ich nun doch verteidigen, es ist gar nicht so schlecht, vor allem nicht besonders kalt. Außerdem, kann ich auftrumpfen, gibt es im Winter wesentlich weniger Niederschläge als im Juli oder August. «Pilgern, das machen doch jetzt viele», weiß ihr Mann, der mittlerweile dazugekommen ist. «So wie der vom Fernsehen, der mit der Königin Beatrix.» Danke sehr, aber offenbar gebe ich Anlass zu Missverständnissen. Der Mann sieht nach echter Arbeit aus, wie soll ich ihm meinen winterlichen Müßiggang erklären?
Auch er rät zum Weg durch den Wald, das sei besser als das Gehen auf der Hauptstraße. Und so kommt die Stirnlampe, mit der ich wahrscheinlich wie die Grubenarbeiter vom Wunder von Lengede aussehe, aber trotzdem nicht wie Heino Ferch, zum ersten Mal zum Einsatz. Am Dorfrand sitzt die Dorfjugend im Schein ihrer Mopeds und raucht dorfjugendlich. Gelächter. Mit Leuchtstreifen an den Beinen und Schülerlotsen-Kreuzbändern sieht man wirklich aus wie ein Vollidiot.
Es sind noch mal neun Kilometer, zwei Stunden in bereits völliger Dunkelheit. Ein paar hundert Meter weiter links verläuft die Hauptstraße mit regelmäßig passierenden Scheinwerfern, die mir jetzt zum Glück erspart bleiben. Im Wald ist niemand. Aber das kann nur behaupten, wer so ahnungslos drauflosmarschiert wie ich. Der Wald ist voll fremden Getiers. Die Löwen, die Giraffen und die Wasserbüffel schlafen zwar schon, doch im Schein der Grubenlampe treiben allerlei nachtaktive Insekten ihr seltsames Spiel. Es ist ein tumultuarisches Hin-und-her-Gefliege, Gebrumme und Gesumme, als hätte grad vor einer halben Stunde die sehnlich erwartete Balz- und Brunftzeit begonnen. Einmal angenommen, es ginge hier keiner durch, sie wären ganz unter sich, die Viecher, was würden sie dann machen? Hat sie das unverhoffte Licht aufgeschreckt, oder treiben sie es immer so bunt? Sind sie bloß nachts aktiv oder auch am Tag, wenn keiner sie bemerkt? Fragen über Fragen.
Zuletzt übersehe ich beinah das riesengroße Schild, das auf meine Rast- und Lagerstätte vorn an der Straße verweist. Das Treppensteigen fällt mir schwer, vor allem die Stufen wieder nach unten, aber wenigstens bin ich untergebracht. Die Wirtsstube ist Treffpunkt der alten Herren. Mit der Gewissenhaftigkeit von Steuerprüfern besprechen sie, wie erfolgreich ihre Söhne und Enkel die ihnen übertragene Firma führen. Das geht natürlich nicht ohne längeres Referat der eigenen Erfolgsgeschichte. So hat der eine über Jahrzehnte seine Spedition aufgebaut, solide gewirtschaftet, den Gewinn nicht entnommen, sondern jeweils in neue Lastwagen investiert. Die großen Aufträge blieben dennoch aus. Zum Glück begleitete einmal ein VW-Vorstand seinen Sohn zum Fußball und sah dabei zufällig den neben dem Bolzplatz liegenden Betriebshof: die Wagen alle gewaschen und in Formation aufgestellt, die Werkstatt aufgeräumt, kein Tropfen Öl am Boden der Zapfstelle, alles sauber. «Warum», so fragte der Mann aus Wolfsburg den Spediteur, «warum fahren Sie eigentlich nicht für VW?» Seitdem transportiert die Firma für VW Maschinen und Ersatzteile durch halb Europa. Er hat das Geschäft längst seinem Sohn übergeben, an dessen Führungsstil er wenig auszusetzen hat, dafür umso mehr an seinem Privatleben. Der Sohn hat selber erwachsene Kinder, sich jetzt scheiden lassen und eine Neue. «Wir haben doch auch mal irgendwas gehabt, aber deswegen nicht gleich geheiratet!», sagt er und schüttelt den Kopf über diese moderne Welt. Das Gespräch wendet sich nach Art alter Männer längst vergangenen Sekretärinnen zu, wobei wehmütig Erinnerungen ausgetauscht werden. Umso größer das Unverständnis für die neue Schwiegertochter, also für den Sohn. «Und er sagt zu mir: ‹Das verstehst du nicht, Vadda, das ist Liebe.› Ach was, Liebe!», schimpft der Vadda. «Die ist doch nur auf sein Geld aus, und der Dösbaddel merkt es...