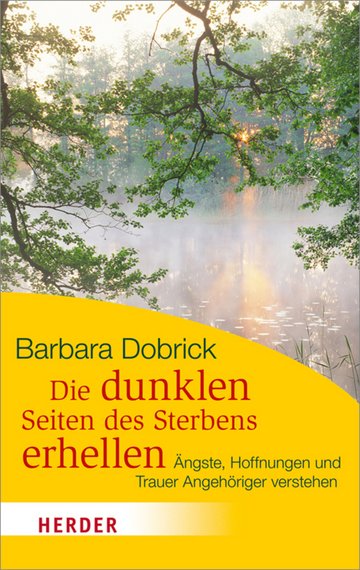Was ist ein guter Abschied vom Leben? Fantasien, Idealvorstellungen und die Wirklichkeit
Wer hätte das gedacht, dass ich mein Leben trotz einer Krebsdiagnose ohne jede Hoffnung bis zum Schluss genießen würde? Sollte mir das nicht reichen? Was sollte ich denn sonst noch wollen?
Tiziano Terzani1
»Hab ich mir gedacht. Phase eins«, sagt Jack Nicholson zu Morgan Freeman in dem amerikanischen Spielfilm »Das Beste kommt zum Schluss« von 2007. Die beiden Krebspatienten sind mit ihren Infusionsständern auf dem Krankenhausflur unterwegs. »Was?«, fragt Morgan Freeman. Nicholson antwortet: »Die fünf Phasen!« Freeman versteht sofort, was sein Zimmergefährte meint, und die beiden zählen abwechselnd die Phasen des Sterbens auf, die Elisabeth Kübler-Ross beschrieben hat: nicht wahrhaben wollen, Zorn, Verhandeln, Depression, Zustimmung. Diese fünf Phasen sind so bekannt, dass sie ohne Weiteres in einem populären Kinofilm erwähnt werden können.
Die aus der Schweiz stammende Ärztin Kübler-Ross hat 1969 folgende Entwicklung beschrieben: Wenn Patienten erfahren, dass sie bald sterben werden, durchleben sie fünf Phasen. Zunächst wollen sie die Information nicht wahrhaben und ziehen sich zurück; wenn sie sie jedoch realisieren, werden sie zornig; später hoffen sie, den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen zu können; sie erleben eine Zeit der Depression; schließlich akzeptieren sie ihren bevorstehenden Tod.2
Der Dialog zwischen Nicholson und Freeman zeigt, zu welchen Vorstellungen das berühmte Buch übers Sterben geführt hat: Todkranke absolvieren psychisch eine Art Parcours, nehmen die Hindernisse mehr oder weniger gekonnt, um schließlich das Ziel zu erreichen – ein friedliches Sterben. Das klingt beruhigend und tröstlich: Zum Schluss können wir annehmen, was nicht abzuwenden ist. Zum Schluss sind wir fähig zu einem versöhnlichen Abschied von unseren Liebsten und Nächsten und vom Leben selbst. Zum Schluss finden wir innere Ruhe und deshalb einen würdevollen und so weit wie möglich selbst bestimmten Tod.
Jack Nicholson und Morgan Freeman lassen es, ehe es so weit ist, noch einmal richtig krachen. Sie arbeiten eine »Löffelliste« ab, eine Liste mit allen Wünschen, die sie sich erfüllen möchten, bevor sie den Löffel abgeben. Sie reisen um die Welt, aber dabei auch nach innen. Sie sehen sich die Pyramiden und das Taj Mahal an, essen in Paris Kaviar und liefern sich ein Autorennen – und sie sprechen über den Tod und über Konflikte, die der eine mit seiner Frau, der andere mit seiner Tochter hat. Diese Konflikte lösen sie in letzter Minute und sind so schließlich fähig, in Frieden mit sich und ihren Mitmenschen zu sterben. Das Berührende an diesem Film ist, dass die beiden Protagonisten am Ende ihres Lebens eine tiefe Freundschaft zueinander entwickeln und dadurch persönlich reifen. Das aber ist die Voraussetzung für die Bewältigung ihrer Probleme. Der zynische Jack Nicholson wird erlöst aus Liebesunfähigkeit und Einsamkeit und der aufopferungsgewohnte Familienvater Morgan Freeman findet auf der Weltreise zu weitreichender Autonomie.
Auch der deutsche Film »Marias letzte Reise« hat eine starke Hauptfigur. Monica Bleibtreu spielt eine Krebskranke, die sich eigensinnig gegen die Zumutungen eines Krankenhausbetriebs und eines Chefarztes wehrt und mithilfe einer einfühlsamen Krankenschwester zu Hause in ihrem eigenen Bett stirbt. Zuvor besuchen sie die Menschen, die ihr wichtig waren. Innere Ruhe findet die Heldin aber erst, als auch ihr verlorener Sohn aus dem Ausland zurückgekommen ist, sie den untergründig schwelenden Konflikt mit ihrem zweiten Sohn gelöst hat und die Söhne sich untereinander ausgesprochen haben. Auch dies ist ein wunderbarer Film mit einem Happy End im doppelten Wortsinn. Beide Filme erzählen vom versöhnten Sterben und stützen die idealisierenden Vorstellungen, die sich verbreitet haben.
Als ich »Marias letzte Reise« sah, musste ich an Rotraud denken, eine Frau, deren Sterben ich aus nächster Nähe miterlebte, obwohl ich sie zuvor nur flüchtig gekannt hatte. Rotraud starb kurz nach ihrem fünfzigsten Geburtstag an einem Hautkrebs, den sie längst überwunden geglaubt hatte, denn ihre erste Erkrankung lag über zehn Jahre zurück, als sich Metastasen rasant in ihrem Körper ausbreiteten. Auch Rotraud starb in einem alten Haus auf dem Land, gut versorgt in ihrem eigenen Bett. Rotrauds Sterben erschien mir körperlich nicht qualvoll. Ihr Lebensgefährte gab ihr alle vier Stunden eine Morphiumspritze; nachts stellte er sich dafür den Wecker. Rotraud hatte weder schlimme Schmerzen noch dauerhafte Ängste oder Panikattacken.
Unsere Ängste vor dem Ende unseres Lebens speisen sich aus unterschiedlichen Quellen: aus der archaischen Angst vor dem Tod, die jeder von uns bewusst oder unbewusst hat; aus dem Erleben und Bewältigen von Ängsten in der Kindheit, das uns geprägt und insbesondere auch unserer Angst vor dem Tod eine individuelle Form gegeben hat. Darüber hinaus sind aber auch die Vorstellungen, die durch spätere Erfahrungen, durch Lektüre, Gespräche und Filme hervorgerufen werden, von Bedeutung.
Als Kind habe ich miterlebt, dass eine Freundin meiner Mutter jahrelang krebskrank war. Von Qualen war immer wieder die Rede, von schrecklichen Operationen, von langem Siechtum, und ich sah das Mitgefühl und den Kummer meiner Mutter. Meine eigenen Beobachtungen bestätigten, dass die Mittdreißigerin sehr krank war, und es blieb mir nicht verborgen, dass sie nach und nach die Kontrolle über ihren Körper verlor. Die Freundin meiner Mutter pupste fortwährend. Das war für mich als Kind, das vor gar nicht langer Zeit gelernt hatte, seine Körperfunktionen zu kontrollieren und Pupse in Anwesenheit anderer zu unterdrücken, beunruhigend und peinlich.
Als die Freundin meiner Mutter gestorben war, sprach meine Mutter mehrfach darüber, dass die Verstorbene ihrem Mann das Versprechen abgenommen hatte, nie wieder zu heiraten. Meine Mutter empörte das, gleichzeitig aber nahm sie dieses »auf dem Totenbett« geforderte Versprechen überaus ernst. Zum ersten Mal hörte ich davon, dass Angehörige auf unzumutbare Weise belastet werden können – sogar weit über den Tod hinaus.
1972 sah ich den Film »Schreie und Flüstern« von Ingmar Bergmann. Die Bilder dieses Films sind für mich unvergesslich. Die Schreie einer im 19. Jahrhundert unter Qualen sterbenden jungen Frau gellen durch das schwedische Herrenhaus, in dem die Krebskranke dem Tod entgegen leidet. Ihre beiden Schwestern sind vor Entsetzen starr. Sie bringen es nicht über sich, der Kranken die Berührungen und Worte zu schenken, nach denen sie sich verzehrt. Nur die Hausangestellte Anna hilft, pflegt die Kranke und beruhigt, tröstet sie durch Zärtlichkeiten, wie eine Mutter sie ihrem kleinen Kind gibt. Der Arzt will der Kranken nichts Schmerzlinderndes verabreichen oder hat nichts dergleichen.
Ganz anders als der Hausarzt, der Rotraud vorbildlich versorgte. Dennoch verstörten mich die letzten Lebensmonate von Rotraud. Nach der Diagnose hatte sie meinen Rat gesucht. Sie wollte ihr Vermögen einer Stiftung zukommen lassen, die den Zweck haben sollte, alleinerziehende Mütter zu unterstützen, und sie bat mich, zu recherchieren, was für eine Stiftungsgründung nötig sei. In unseren langen Gesprächen wurde zunehmend deutlich: Geld war für Rotraud überaus wichtig; sie war aber erst kurze Zeit zuvor durch zwei Erbschaften wohlhabend, wenn auch keineswegs reich geworden. Eigentlich wollte Rotraud ihr Geld mitnehmen, und da das nicht möglich war, wollte sie es Frauen zugutekommen lassen, die genau so lebten, wie sie einst gelebt hatte. Ihr Leben als berufstätige, alleinerziehende Mutter hatte sie als Unglück empfunden, das sie nachträglich mildern wollte. Gleichzeitig aber hätte sie sowohl ihre Tochter als auch ihren Lebensgefährten bestraft, die ja leer ausgegangen beziehungsweise nur mit ihrem Pflichtteil bedacht worden wären. Rotraud war sehr stolz auf ihren Besitz, obwohl sie ihn nicht selbst erarbeitet hatte. Aber sie hatte ihn verdient, denn sowohl ihre Mutter als auch ihr kinderloser Onkel – ihre beiden Erblasser – hatten sie schlecht behandelt, und ihre Mutter hatte Rotraud schon in Kindertagen genötigt, sich dem ekelhaften Erbonkel gegenüber ja freundlich zu verhalten, weil diese Freundlichkeit sich eines Tages bezahlt machen würde.
Rotrauds Gedanken kreisten immerzu um die Möglichkeit, wie sie die Bilanz ihres Lebens – sie sagte, ihr Dasein sei von Anfang bis Ende ohne Glück gewesen – mithilfe ihres so bitter »verdienten« Geldes verbessern könnte. Ich hatte den Eindruck, dass sie die Macht genoss, die damit verbunden war. Nun war sie diejenige, die etwas zu hinterlassen hatte, nun war sie diejenige, die strafen oder belohnen konnte. Nun war sie diejenige, der gegenüber man sich willfährig verhalten musste, wenn man in den Genuss...