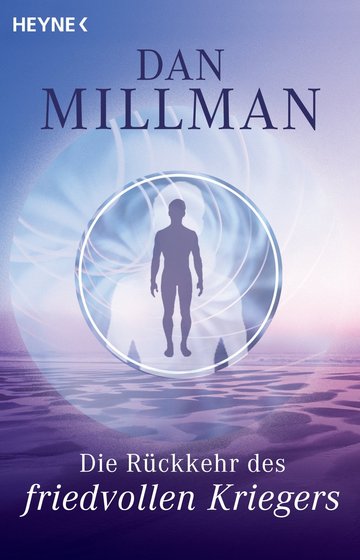1
IM SUMPF DES ALLTAGS
Erleuchtung heißt nicht nur, daß man leuchtende Gestalten und
Visionen sieht, es bedeutet, daß man Licht in die Dunkelheit bringen
muß. Letzteres ist schwieriger und daher nicht so beliebt.
C. G. JUNG
In meiner Hochzeitsnacht weinte ich. Ich erinnere mich noch genau daran. Linda und ich hatten in meinem vierten Studienjahr an der Universität in Berkeley geheiratet. Ich erwachte kurz vor Morgengrauen, unerklärlich deprimiert, schälte mich leise aus den zerknüllten Bettlaken und trat hinaus in die kühle Morgenluft. Die Welt war noch in Dunkel gehüllt. Ich schob die Glastür hinter mir wieder zu, um meine Frau nicht zu wecken. Dann stieg plötzlich ein Schluchzen in mir auf. Ich weinte lange, hatte aber keine Ahnung, warum.
Weshalb war mir so elend zumute, obwohl ich doch eigentlich allen Grund haben sollte, glücklich zu sein? fragte ich mich. Die einzige Antwort, die mir einfiel, war eine vage Ahnung, die mich zutiefst beunruhigte: daß ich irgend etwas Wichtiges vergessen hatte, daß ich irgendwie vom richtigen Kurs abgekommen war. Dieses Gefühl sollte unsere ganze Ehe überschatten.
Nach meiner Abschlußprüfung ließ ich den Erfolg und die Ovationen hinter mir, mit denen ein Starathlet verwöhnt wird, und mußte mich an ein relativ anonymes Leben gewöhnen. Linda und ich zogen nach Los Angeles, und ich mußte mich zum erstenmal im Leben den Verantwortungen des täglichen Lebens stellen. Ich besaß eine bewegte Vergangenheit, einen Universitätsabschluß und eine schwangere Frau. Es war höchste Zeit, mich nach einer Stellung umzusehen. Nachdem ich ohne großen Erfolg versucht hatte, Lebensversicherungen zu verkaufen, ein Engagement als Stuntman in Hollywood zu bekommen oder über Nacht Schriftsteller zu werden, bekam ich schließlich eine Stellung als Sporttrainer an der Stanford University.
Trotz dieser glücklichen Fügung und der Geburt unserer süßen Tochter Holly quälte mich immer wieder das Gefühl, etwas Wichtiges zu versäumen. Linda gegenüber konnte ich dieses Gefühl unmöglich rechtfertigen; ich brachte es nicht einmal fertig, ihr davon zu erzählen. Und da mir auch Socrates’ leitende Hand fehlte, schob ich meine Zweifel einfach beiseite und versuchte die Rolle eines »Ehemanns« und »Vaters« zu spielen, obwohl ich mir dabei vorkam wie in einen zu engen Anzug gezwängt.
Vier Jahre vergingen. Vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs, der ersten Mondlandung und der Watergateaffäre lief mein unbedeutendes kleines Leben ab – Universitätspolitik, berufliche Pläne, familiäre Verpflichtungen.
Während des Studiums war mir mein Leben viel einfacher vorgekommen. Aber jetzt hatten die Regeln sich geändert; meine Prüfungen mußte ich im täglichen Leben bestehen, und diesen Lehrer konnte ich nicht zum Narren halten, auch wenn ich es noch so geschickt anstellte. Zum Narren halten konnte ich nur mich selbst, und das tat ich mit entschlossener Beharrlichkeit.
So gut es ging, fixierte ich mich also auf die Ideale eines weißgestrichenen Gartenzauns und zweier Autos in der Garage, gestand mir meine vagen Sehnsüchte nicht ein und beschloß, es zu etwas zu bringen. Schließlich war Linda in jeder Hinsicht eine vorbildliche Ehefrau, etwas ganz Besonderes. Und ich mußte ja auch an meine kleine Tochter denken.
So verbarrikadierte ich mich in der »Realität«, die um mich her allmählich hart und starr wurde wie Beton. Meine Erlebnisse mit Socrates und die Lektionen, die ich bei ihm gelernt hatte, begannen zu verblassen wie Bilder in einem alten Fotoalbum. Sie wurden zu nebelhaften Eindrücken aus einer anderen Zeit und einem anderen Reich. Von Jahr zu Jahr kamen mir Socrates’ Worte von der Frau auf Hawaii, der Schule in Japan und dem Buch in der Wüste unwirklicher vor – bis ich sie schließlich ganz vergaß.
Ich bekam eine Stellung am Oberlin College in Ohio und verließ die Stanford University in der Hoffnung, daß diese Ortsveränderung meine Beziehung zu Linda verbessern würde. Aber in der neuen Umgebung wurde uns nur noch klarer, daß wir völlig verschiedene Vorstellungen vom Leben hatten. Linda kochte z. B. gern und liebte Fleisch; ich bevorzugte rohe vegetarische Kost. Sie wollte unsere Wohnung mit möglichst vielen Möbeln vollstellen; ich war mehr für zen-buddhistische Schlichtheit und hätte mich am liebsten mit einer Matratze auf dem Fußboden begnügt. Sie liebte Partys und wollte immer Menschen um sich haben; ich arbeitete lieber. Sie war eine typische amerikanische Ehefrau. Ihre Freunde hielten mich für einen esoterischen komischen Kauz, und ich zog mich immer mehr in mein Schneckenhaus zurück. Sie fühlte sich wohl in ihrer konventionellen Welt, die mich abstieß; und trotzdem beneidete ich sie um ihre Zufriedenheit.
Linda spürte, wie unwohl ich mich fühlte, und wurde immer frustrierter. Schon nach einem Jahr lag mein Privatleben in Scherben, meine Ehe wurde von Tag zu Tag schlechter. Ich konnte nicht mehr die Augen davor verschließen.
Und ich hatte gedacht, meine Ausbildung bei Socrates würde mir das Leben leichter machen! Aber es schien alles nur immer schlimmer zu werden. Die Wogen von Arbeit, Familienleben, Fakultätssitzungen und privaten Sorgen hatten fast alles davongespült, was ich bei Socrates gelernt hatte.
Trotz seiner Mahnung: »Ein Krieger muß für alles offen sein, wie ein Kind«, lebte ich nur in meiner eigenen Welt und hatte mich in einen schützenden Kokon zurückgezogen. Ich hatte das Gefühl, daß niemand mich wirklich kannte oder verstand – auch Linda nicht. Ich fühlte mich isoliert und war keine angenehme Gesellschaft mehr, nicht einmal für mich selbst.
Und obwohl Socrates mir beigebracht hatte, »alle Gedanken loszulassen und nur im Jetzt zu leben«, dröhnte und brodelte es immer noch in mir: Zorn, Schuldgefühle, Reue und Sorgen ließen mich nicht zur Ruhe kommen.
Socrates’ befreiendes Lachen, das früher wie ein Kristallglockenspiel in meinem Inneren nachgeklungen hatte, war jetzt nur noch ein dumpfes Echo, eine blasse Erinnerung.
Gestreßt und aus den Fugen geraten, hatte ich kaum mehr Zeit und Energie für meine kleine Tochter. Ich hatte zugenommen, und das beeinträchtigte nicht nur meine Sportlichkeit, sondern auch meine Selbstachtung. Und was am allerschlimmsten war: Ich hatte den Faden verloren, den tieferen Sinn meiner Existenz.
Auch meine Beziehungen zu anderen Menschen sah ich plötzlich in einem sehr fragwürdigen Licht. Ich hatte mich stets als Mittelpunkt der Welt gesehen und nie gelernt, anderen Menschen Aufmerksamkeit zu schenken. Ich war es immer nur gewohnt gewesen, selbst im Rampenlicht zu stehen. Wahrscheinlich wollte ich jetzt meine Ziele und Prioritäten nicht für Linda und Holly oder irgendeinen anderen Menschen opfern, oder ich konnte es einfach nicht.
Allmählich ging mir auf, daß ich vielleicht egozentrischer als alle Menschen war, die ich je kennengelernt hatte. Das beunruhigte mich, und ich klammerte mich noch hartnäckiger an mein einstiges Selbstbild. Aufgrund meiner Unterweisung bei Socrates und all meiner früheren Leistungen sah ich mich immer noch als eine Art Ritter in glänzender Rüstung. Ich wollte nicht wahrhaben, daß die Rüstung inzwischen gerostet war.
Socrates hatte einmal zu mir gesagt: »Verkörpere stets das, was du lehrst, und lehre nur das, was du auch verkörperst.« Aber ich tat immer noch so, als sei ich der kluge, ja sogar weise Lehrer, und fühlte mich innerlich wie ein Scharlatan und Narr. Das wurde mir immer schmerzlicher bewußt.
Trotzdem konzentrierte ich mich ganz auf meine Arbeit als Trainer und Lehrer, die mir wenigstens noch so etwas wie Erfolgserlebnisse gab. Um die frustrierende Arena der zwischenmenschlichen Beziehungen, der ich mich am dringendsten hätte widmen müssen, machte ich einen großen Bogen.
Linda und ich entfernten uns innerlich immer mehr voneinander. Sie suchte sich Liebhaber, und ich suchte mir Freundinnen, bis das immer dünner werdende Band, das uns noch zusammenhielt, schließlich riß und wir beschlossen, uns zu trennen.
An einem kalten Tag im März zog ich aus. Der Schnee war gerade zu Schneematsch geworden. Ich verfrachtete meine wenigen Habseligkeiten in einen Lieferwagen, den ich mir von einem Freund geliehen hatte, und suchte mir ein Zimmer in der Stadt. Mein Verstand redete mir ein, das sei das beste für mich, aber mein Körper sprach eine ganz andere Sprache: Magenbeschwerden plagten mich, und ich bekam Muskelkrämpfe, die ich früher nie gekannt hatte. Selbst kleine Wunden – z. B. wenn ich mir die Haut an einer scharfen Papierkante oder einem vorstehenden Nagel aufriß – entzündeten sich.
In den nächsten Wochen funktionierte ich allein deshalb, weil ich noch den vergangenen Alltagstrott in mir hatte. Mechanisch ging ich meiner täglichen beruflichen Routine nach. Aber meine Identität, das Leben, das ich für mich geplant hatte – all das war in sich zusammengestürzt wie ein Kartenhaus. Ich fühlte mich elend und verloren und wußte nicht, wohin.
Doch eines Tages, als ich in meinem Postfach im Institut für Sport und Körpererziehung nachsah, ob etwas für mich gekommen war, rutschte mir ein Rundschreiben meiner Fakultät aus den Händen und fiel geöffnet auf den Boden. Während ich mich bückte, um es aufzuheben, überflog ich die Mitteilung: »Alle Mitglieder unserer Fakultät sind herzlich eingeladen, sich um ein Powers-Auslandsstipendium zu...