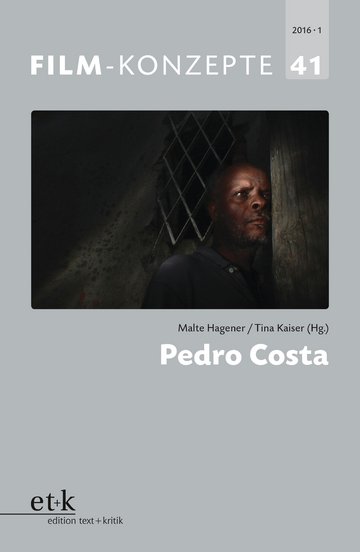[2|3] Georg Klein
Rainer Werner Fassbinders Fernsehzweiteiler »Welt am Draht«
Dekorierte Räume
Der Film hebt an, aber sein Held lässt auf sich warten. Jener Fred Stiller, dessen Such- und Irrgang wir eine Handvoll Handlungstage lang begleiten werden, hat sich, das erfahren wir beiläufig, eine Auszeit von seiner Welt genommen. Immerhin sein Name fällt. Aber gute achteinhalb Minuten sind wir, ohne uns auf eine Hauptfigur fokussieren zu können, also ohne identifikatorischen Halt, am Hauptort des kommenden Geschehens, im Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung.
Wir verfolgen die Interaktion von fünf Männern in Anzügen. Ihre Dialoge weisen sie als Funktionsträger, als Ministerialbeamte und leitende Institutsmitarbeiter aus. Eine Interessenkonstellation wird umrissen. Der technische Direktor des Instituts verhält sich auffällig, offensichtlich hat er mit psychischen Problemen zu kämpfen. Er verliert die Kontrolle, es kommt zu einem tödlichen Stromunfall im Rechnerbereich des Gebäudes.
Recht konventionell sind damit Eckpunkte der kommenden Handlung gesetzt. Ein Spannungsmoment greift, ein Konflikt wird angedeutet. Der Plot nimmt auch ohne zentralen Protagonisten an Fahrt auf. Die Darsteller spielen das alles so routiniert, wie sie es andernorts, im untergegangenen bundesdeutschen Trivialkino und auf der Bühne, gelernt haben. Aber man müsste blind sein, um dies für die dominante Illusionsleistung des Filmanfangs zu halten.
Die entscheidende erste Überwältigung, die der Zuschauer einst vor dem Röhrenfernseher genießen durfte und heute vor dem weit schärferen Flachbildschirm erleiden darf, vollzieht sich nicht in der Anteilnahme am Spiel der Figuren und in den Erwartungen, die eine geläufige Spannungsmechanik suggeriert. Der zwingende Zugriff auf die Phantasie des Betrachters geschieht, wortlos und das Geschehen grundierend, durch die Visualisierung des Handlungsraums. Denn wo sind wir eigentlich? Soll dieses seltsame Institut ernstlich ein Gehäuse technologischer Zukunft darstellen?
Wenig kann in den notorisch erzählenden Künsten, also in der Literatur und im Film, so ernüchternd altbacken und illusionsbrechend wirken wie der Versuch, die kommenden Dinge, also die Mode, die Möbel und vor allem die zukünftigen Apparate, in Szene zu setzen. Die literarische Vorlage [3|4]von »Welt am Draht«, der Roman »Simulacron-3« aus dem Jahre 1964, ist in diesem Punkt längst vom Gang der tatsächlichen Entwicklung überholt worden. Wie sich der amerikanische Science-Fiction-Autor Daniel F. Galouye (1920–1976) exemplarische Gerätschaften einer kommenden Lebens- und Arbeitswelt vorgestellt hat, wirkt heute in nicht wenigen Fällen unfreiwillig komisch. Denn gerade was als zukünftiges Ambiente imaginiert wird, offenbart fast zwangsläufig das prognostische Ungeschick des Genres.
Der Film übernimmt, abgesehen von den im Institut benutzten Videotelefonen, keine der im Roman beschriebenen futuristischen Errungenschaften. Wahrscheinlich haben Fritz Müller-Scherz und Rainer Werner Fassbinder, die Autoren des Drehbuchs, allein schon aus Kostengründen von Plattformen, die die Schwerkraft unterdrücken, von den im SF-Film fast obligatorischen Flugautos und von den aufwendigen Rollbandsystemen abgesehen, die bei Galouye die ganze Stadt durchziehen. Wichtiger als dieser Verzicht ist aber, wie »Welt am Draht« dem Haupthandlungsort, den Innenräumen des Instituts, entschieden offensiv eine eigentümliche Aura verleiht.
Kurt Raab hat als Ausstatter aus vorgefundenen Locations, ergänzenden Bauten und einer Fülle von kleinteiligem Dekor ein Interieur geschaffen, das beständig zwischen einer großspurigen Weite und einer beklemmenden Verstelltheit pendelt. Was da prunkt, glitzert und spiegelt, kann bereits durch sein schieres Arrangement eine bühnenartige Wirkung zeitigen und wird durch die aufwendige Kameraarbeit von Michael Ballhaus vollends zu einer Wirklichkeit eigenen Rangs.
Das Realismus-Konzept, das hier erfolgreich greift, evoziert allerdings keinerlei Zukünftigkeit. Stattdessen erlebt der Zuschauer eine kunstreich, fast verkünstelt arrangierte Gegenwart, deren im Einzelnen durchaus vertraute Elemente sich zu einem Gehäuse exklusiver Natur fügen. Wer mag, kann sich dem einfach hingeben und die exquisiten Details und die geschmeidig fließende Raffinesse ihrer Bildwerdung genießen. Aber die visuelle Immersion, das filmische Eingesaugtwerden, offenbart nach und nach auch einen Preis. Wer Ja zu diesem Kunstraum sagt, wird allmählich spüren, wie den Figuren des Films dieses hochdekorierte Ambiente, die dingliche Verdichtung ihrer Welt, klaustrophobisch zu schaffen macht.
Missliche Körper
Fred Stiller tritt auf, und der Bildraum füllt sich auf eine neue Weise mit Körpern. Die Routiniers des Anfangs werden um ein gutes halbes Dutzend Haupt- und Randfiguren ergänzt, deren Darsteller sich nicht mehr an die Regeln eines gängigen psychologischen Realismus halten. Stattdessen spie[4|5]len sie mehr oder minder à la Fassbinder, und wer als Zuschauer keine älteren Filme dieses Regisseurs kennt, wird sich instinktiv oder mit bewusster Denkanstrengung irgendeinen Reim auf dieses unerwartet bizarre Agieren machen müssen, um nicht unversehens aus dem siebten Himmel der Illusion zu stürzen.
Das apathische Vor-sich-hin-Sprechen, das träge, fast somnambule Gebaren und das statuarische Nichts-als-Herumstehen werden ein Stück weit von der Szenerie aufgefangen. Denn der Ort, an dem Stillers Chef Siskin eine Party gibt, lässt zumindest eine gewisse Exzentrik plausibel erscheinen, irgendein situationsbedingtes Sonderverhalten, das mit Drogeneinwirkung oder den Anforderungen des hier üblichen, gedämpft sexualisierten Rollenspiels zu tun haben könnte.
Aber die Artifizialität, die Ausstattung und Kamera weiterhin grandios kompakt gewährleisten, wird in der Führung der Darsteller nicht mit der gleichen Konsequenz durchgehalten. Einige der Akteure stecken unübersehbar fest im Niemandsland zwischen ihrem außerfilmischen So-Sein und dem allenfalls skizzierten Spielraum einer fiktiven Figürlichkeit. Sie fallen nicht aus irgendeiner Rolle, aber sie finden auch nicht glaubwürdig in eine solche hinein und verharren folglich, quälend unentschieden, im Feld des darstellerischen Dilletantismus. Wer Wert auf ästhetische Kohärenz legt, hat nun unter Umständen das Pech, sich, freundlich oder zunehmend ungnädig, über den Regisseur dieses Lichtspiels und seine Mutwilligkeiten wundern zu müssen.
Dieses Dilemma, die schwankende Konsistenz von Fassbinders Realismus-Konzept, wird im Weiteren auf eine paradoxe Weise durch seinen Hauptdarsteller Klaus Löwitsch aufgehoben. Fred Stiller ist, so behauptet es die weitgehend getreu aus dem Roman übernommene Handlung, ein hochkarätiger Computerfachmann, ein genialer Programmierer und Systementwickler. Er arbeitet und lebt seit Jahren für ein hyperkomplexes mathematisch-kybernetisches Projekt. Er müsste also jener Typus von Intelligenzbestie sein, den man später, irgendwann in unserem jetzigen Jahrhundert, einen Nerd zu nennen begonnen hat.
Schon physiognomisch scheint Löwitsch für einen derart hochspezialisierten Kopfmenschen eine eklatante Fehlbesetzung zu sein. Und die Art, wie er seine Rolle interpretiert, nimmt vollends Abstand von allem, was die behauptete Profession an Habitus erwarten lässt. Dieser Stiller gibt sich ausgesprochen kerlig, derb, bisweilen fast roh. Seine Mimik ist holzschnittartig, seine Intonation bellend rau. Und in schnellem Takt spiegeln ihm mehrere der weiblichen Figuren, dass sie sein vulgäres Gebaren als sexuelles Signal aufnehmen und seine animalische Attitüde attraktiv finden.
Im Lauf des Geschehens ist Löwitsch/Stiller dann derjenige, der regelmäßig nackte Haut, vor allem seinen durchtrainierten Oberkörper präsentieren [5|6]darf. Er rennt, schwimmt, klettert, gibt den agilen Muskelmann, aber er raucht und säuft auch, sobald sich eine Gelegenheit hierzu bietet. Er schlägt einen Mann zu Boden und der Frau, die er angeblich liebt, ins Gesicht. Fast comicartig plakativ steht er für maskuline Energie in ruheloser Bewegung, und diesem Klischee des dynamischen Kraftprotzes sind Frauenfiguren beigesellt, die eine träge, schläfrige, halb paralysierte, manchmal morbide oder sogar moribunde Sinnlichkeit zelebrieren.
Die Stilisierung des körperlichen Ausdrucks wird von Maske, Frisur und Kostüm gesteigert und nicht selten bis ins Groteske überzeichnet. Ein Großteil der Figuren wirkt, gemessen an dem, wie man sich eine Sekretärin, einen Kriminalbeamten, eine Kellnerin oder einen Koch vorzustellen bereit ist, falsch oder gefälscht, ohne dass sich ein Konzept offenbaren würde, das dieses Verkehrt-Sein mit dem Geschehen, den genregetreu mysteriösen Ereignissen um den Großcomputer Simulacron, synchronisieren würde.
Die Kluft zwischen der manchmal fast surrealen Zurichtung der Gestalten und den Anforderungen des Plots kann der Aktionismus der Figur Stiller nicht logisch, weder psychologisch noch handlungslogisch, schließen. Aber das Körperspiel von Löwitsch, der immer häufiger schwankt, schließlich stürzt, um sich wieder hochzurappeln, stiftet dennoch, gleich den ruhelosen Bewegungen eines Taumelkäfers auf einer Wasseroberfläche, eine hypnotische Art von Fortgang, ein alogisch zwingendes Nacheinander. Von Stillers erstem Auftreten an gibt es keinen Handlungsstrang, der ohne seine Teilhabe verläuft, und fast keine Szene, in der er nicht auftritt. Sein krisenhafter...