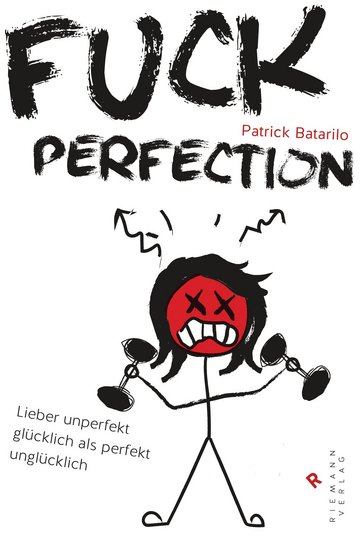1 Lächle oder stirb. Die Diktatur der guten Laune
Vor ein paar Jahren habe ich eine deutsche Freundin in Istanbul besucht. Tine hatte in der Türkei ein Erasmus-Jahr verbracht, war dann nach Berlin zurückgekehrt, lebte – nach einem kurzen Intermezzo erst in ihrer schwäbischen Heimatstadt, dann in Singapur – nun doch wieder am Bosporus. Eine ganz normale Endzwanziger-Nomaden-Existenz, deren Herzstück ein Laptop ist, sowie eine externe Festplatte mit genügend Fotos und Musiktiteln, um noch ein Gefühl von Heimat zu vermitteln – auch wenn die Heimat meist nur noch aus dem besteht, was unter dem Skype-Logo auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Tine ist zierlich, betont nachlässig, macht gerne große Augen und bestimmt am Ende des Abends immer, wo es langgeht. Emir, der türkische Schauspieler, mit dem sie zusammen war, ist ein »Mann-Mann«, wie sie sagt. Einkaufstüten-Tragen und Bohrmaschinen-Handhaben gehören quasi zu seiner Männlichkeits-DNA. Aber etwas an Emir schien nicht zu dieser gestandenen Männlichkeit zu passen. Am deutlichsten empfand Tine das in der Zeit, als sie in Berlin lebte und Emir in Istanbul. Beide waren sie unzufrieden mit der Situation, beide hatten sie zu wenig Geld, um auf die Jobs zu verzichten, die sie gerade an ihren jeweiligen Wohnorten ausübten. Wenn sie beim Skypen allzu schwarz sahen, reagierte Tine, indem sie einfach das nächste Wiedersehen in Istanbul oder Berlin plante. Irgendein billiger Flug musste doch zu finden sein! Kurz: Sie suchte nach Lösungen. Außerdem: So eine Fernbeziehung hat doch auch Vorteile? Zeit für eigene Pläne, die Vorfreude auf das nächste Treffen … Doch statt gemeinsam mit ihr über Möglichkeiten und Lösungen nachzudenken, lehnte sich Emir auf dem Bett zurück, auf dem er mit seinem Laptop saß. Schweigend starrte er an die Decke, bis irgendwann, wie in einer nicht enden wollenden Zeitlupe, eine große Träne seine stoppelige Wange hinabkullerte. Emir weinte. Er versteckte seine Tränen nicht. Im Gegenteil: Er genoss seine Trauer. Warum sonst die hingebungsvoll-herzerweichenden Seufzer, der leidend der Kamera zugewandte Blick?
In der Türkei existiert eine Form von Melancholie, die uns fremd ist. Sie ist das Gegenteil der guten Laune, die wir uns täglich als Wundermittel gegen alle Widrigkeiten des Lebens verschreiben. In den Straßen von Istanbul kann man der Melancholie überall begegnen. Man muss nur ein bisschen am glänzenden, westlich-optimistischen Firnis kratzen und sich in die Viertel jenseits der Party- und Businessmeilen um den Taksim-Platz wagen. Zum Beispiel den Vorhof einer Meyhane betreten, eines traditionellen Fischmarkts. Dort sieht man sie dann zusammensitzen, zu zehnt, zwölft, an eng zusammengestellten Tischen. Natürlich wird viel getrunken, meist Raki, Anisschnaps; und es wird gegessen, genüsslich. Während hinter ihnen die dampfenden Fliesen gefegt werden, singen sie traurige Lieder von verlorener Liebe und Tod. Und wenn sie nicht singen, klagen sie über ihr eigenes Leben, jammern, wissen nicht mehr weiter – und sagen am nächsten Tag, dass sie einen wunderschönen Abend gehabt haben. Die türkische Melancholie ist nichts, was sich verstecken müsste. Sie hat sogar einen Namen: Hüzün. Orhan Pamuk, der türkische Nobelpreisträger, spricht in seinem Buch Istanbul davon, dass Hüzün in Istanbul überall zu sehen sei – wie ein hauchdünner Dunst über den Wassern des Bosporus, wenn an Wintertagen die Sonne durchbricht. Die Melancholie einer ganzen Stadt – nicht versteckt, sondern stolz empfunden. 3
Als ich mich in Istanbul nach Hüzün umgesehen habe, nach dem Gespräch mit Tine, hat mich vor allem eins überrascht: wie leicht die Menschen in der Türkei von Trauer zu Freude wechseln können. Die Leichtigkeit, mit der sie Gefühle verbinden, die für mich absolute Gegensätze sind. Wenn ich traurig bin, freue ich mich nicht. Wenn ich mich freue, bin ich nicht traurig. Ein türkischer Freund, der Theatermacher Bahtiyar, der selbst als Kind in Deutschland gelebt hat, hat es mir so erklärt: »Ich glaube, ohne Melancholie gibt es kein Gefühl in der Welt. Ohne Melancholie gibt es kein Leben. Manchmal vermisse ich Hüzün. Wo gibt es hier ein bisschen Melancholie? Man braucht es manchmal. Sonst wird man wie eine Maschine.«
Wieso kommt uns das so fremd vor?
Wir leben in einer Gute-Laune-Diktatur. Smile or die, lächle oder stirb, so hat die amerikanische Autorin Barbara Ehrenreich ihr Buch über den Zwang zur strahlenden Fassade genannt. Wir sind angehalten, alles positiv zu sehen – das Glas auch dann noch für halbvoll zu halten, wenn es zerschlagen auf dem Boden liegt.4 Gute Laune, so hören wir überall, ist der Schlüssel zur Selbstoptimierung: Wer gut drauf ist, ist nicht nur zufrieden, er hat auch mehr Freunde, ist erfolgreicher, gesünder, ja er lebt sogar länger. Wer möchte bei solchen Versprechungen noch jammernd in der Ecke stehen? In den Einkaufspassagen unserer Städte werden uns so viele Gute-Laune-Produkte verkauft, dass man sich fragt, wieso überhaupt noch irgendjemand nicht strahlt: Es gibt Gute-Laune-Tassen und Gute-Laune-Pflegeschaumbäder, Gute-Laune-Kräutertee und – etwas Kontrast muss sein – Gute-Laune-Drops mit »leicht saurer prickliger Füllung«. Der Smiley, dieser neongelbe Grinseterrorist, ist eine der berühmtesten und lukrativsten Marken der Welt geworden – auf Augenhöhe mit dem Haken, den ein berühmter Sporthersteller unter seine Erfolgsbilanzen setzt (»Just do it«), oder den goldgelben Bögen des amerikanischen Frikadellenbraters, der uns den Satz »Ich liebe es« für immer mit Frittier-Assoziationen ruiniert hat.
Alles, so wird uns gesagt, ist eine Frage der Einstellung. Wenn Sie die Welt positiv sehen, dann ist sie es auch – jetzt und für immer. Hunderte von Gute-Laune-Glücksratgebern haben dieses Mantra verinnerlicht und veräußern es mit Erfolg. Darunter finden sich zum Beispiel das Hasen-Yoga für gute Laune (das »niedlichste Anti-Stress-Buch seit der Erfindung des Yoga«), Anleitungen zum Gute-Laune-Häkeln (die »schönsten, lustigsten und herzigsten Häkelideen«) oder auch Das ganz persönliche Gute-Laune-Orakel (mit »besonders flauschigem Stoffbeutel«). Und natürlich dürfen Rezepte für gute Laune nicht fehlen – schließlich muss man zwischen Hasen-Yoga und Gute-Laune-Häkeln auch mal ein Häppchen essen. Fassen wir es mit dem Titel eines anderen Ratgebers zusammen: Ganz viel gute Laune für dich!
Die Psychologie hat in den letzten Jahren einen ganzen neuen Zweig entwickelt, die »positive« Psychologie. Die Positive Psychologie beschäftigt sich nicht mehr mit »negativen« psychischen Zuständen wie Neurosen, Ängsten oder anderen psychischen Krankheiten – sondern mit »positiven« Emotionen wie Glück, gute Laune oder Optimismus. Martin Seligman, ein US-amerikanischer Psychologe, hat diesen Forschungszweig quasi im Alleingang erfunden. Dass Seligman als Coach bei seinen Seminaren Hunderten von Menschen gleichzeitig Optimismus beibringt, zu einem Preis von 2000 Dollar pro Person, dass er große Unternehmen berät, wie sie ihre Mitarbeiter zu effizienterer Arbeit antreiben und ihren Absatz steigern können, dass er auf einer kommerziellen Website Glück (in Form von Übungen) gegen Bares verkauft5, all das spricht nicht gegen Seligman. Warum sollte er sich selbst die gute Laune verderben?
Sagen wir es deutlich: Gegen Glück und gute Laune ist selbstverständlich nichts einzuwenden. Ehrlich gut drauf zu sein ist etwas Wunderschönes. Niemand will die altdeutsche Knurrigkeit zurück, das verbissene Herumreiten auf Mängeln, die ständige Angst vor Fehlern. Der Miesepeter lebt schlechter, freudloser – und ist auch nicht näher an der Wahrheit. Etwas mehr Gute-Laune-Kompetenz kann also nicht schaden. Schwierig wird es nur, wenn ein bestimmter Zug alle anderen dominiert. Wenn für die unvermeidlichen Ängste, Schwächen und Hilflosigkeiten, das ganze existentielle Marschgepäck des Lebens, kein Platz mehr ist. Wenn das Echte an uns unter Generalverdacht gerät: Lächle – oder stirb.
Auch die Amerikaner waren übrigens nicht immer die auf Knopfdruck lächelnden Zwangsoptimisten, als die sie heute vielerorts gelten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert herrschte in den gerade erst unabhängigen Vereinigten Staaten noch eine ganz andere Gefühlslage. Der Calvinismus, die prägende religiöse Strömung der Zeit, predigte vor allem eins: Härte gegen sich selbst. Die sadistische Grundannahme war, dass nur einige Auserwählte nach ihrem Tod in den Himmel kommen. Der calvinistische Gott lässt sich nämlich nicht durch menschliches Blendwerk wie gute Taten oder Gebete beeinflussen, denn wer sich manipulieren lässt, ist nicht allmächtig. So nehmen wir an einem Spiel teil, in dem die Sieger schon feststehen: Gott hat alles vorherbestimmt. Nur, woher wissen wir, dass wir zu den Siegern gehören? Und nicht zu denen, die dem göttlichen Plan B zufolge automatisch in ewiger Verdammnis landen? Ganz einfach: Wer Schwäche zeigt, sich unmoralisch verhält oder auch nur unmoralische Gedanken hat, der zeigt eben dadurch, dass er nicht zu den Siegern gehört. Dagegen sind Wohlstand und beruflicher Erfolg klare Indizien dafür, dass Gott uns auserwählt hat. Man darf nur nicht in Versuchung geraten, die Früchte seines Erfolgs schon auf Erden zu genießen – denn das wiederum wäre ein Zeichen, dass man doch eher fürs Team Hölle aufgestellt ist. Der Calvinismus der USA war, wie Barbara...