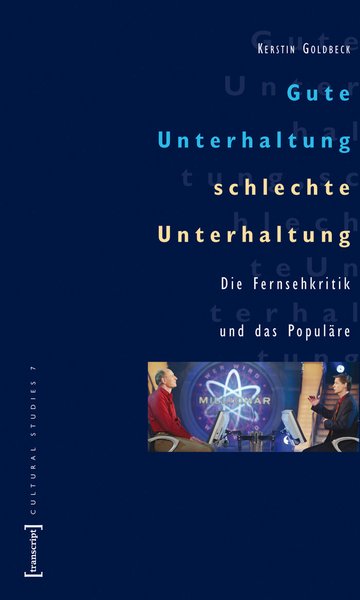| Cover Gute Unterhaltung, schlechte Unterhaltung | 1 |
| Inhalt | 6 |
| Danksagung | 10 |
| Vorwort | 11 |
| Einleitung | 14 |
| Teil 1: Eine positive Perspektive: Cultural Studies und Populärkultur | 24 |
| 1. Kurze theoretische Skizzierung der Cultural Studies | 26 |
| 1.1 Schwer zu fassen: das Projekt der Cultural Studies | 26 |
| 1.2 ›Kultur‹ in den Cultural Studies | 29 |
| 1.3 Kulturanalysen in den Cultural Studies | 33 |
| 1.4 Cultural Studies und Populärkultur | 37 |
| 1.4.1 Exkurs: Was ist Unterhaltung? | 38 |
| 1.4.2 Fiske und Populärkultur | 41 |
| 1.4.3 Populäre Hierarchien? | 45 |
| 1.5 Cultural Studies und populärkulturelle Texte: Zentrale Studien | 47 |
| 1.5.1 Janice Radway: »Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature« | 48 |
| 1.5.2 Ien Ang: »Watching Dallas« | 50 |
| 1.5.3 Dorothy Hobson: »Crossroads« | 52 |
| 1.5.4 David Morley/Charlotte Brunsdon: »Everyday Television: Nationwide« | 53 |
| 1.5.5 Seiter, Kreuzner, Borchers und Warth: »Soap Operas im amerikanischen Fernsehen« | 57 |
| 1.5.6 Mary Ellen Brown: »Soap Operas and Women’s Talk. The Pleasure of Resistance« | 58 |
| 1.6 Zur deutschsprachigen Rezeption der Cultural Studies | 59 |
| Teil 2: Fiske und ›populäre Texte‹ | 64 |
| 1. Die Offenheit populärer Texte | 66 |
| 1.1 Verortung Fiskes in den Cultural Studies | 66 |
| 1.2 Ecos früher Blick auf Populäres | 70 |
| 1.3 Fiskes ›populäre Texte‹ und ihre Eigenheiten | 74 |
| 1.3.1 Undisziplinierte Texte: Populäre Texte und Textoffenheit | 74 |
| 1.3.2 ›Inescapable intertextuality‹ | 80 |
| 1.3.3 Genre als populäre Form horizontaler Intertextualität | 82 |
| 2. Grenzen der Bedeutungsfreiheit: Lesarten | 86 |
| 2.1 Bedeutungsreservoirs: Konnotation und Denotation bei Barthes | 87 |
| 2.2 Bedeutungsproduktion und Lesarten in Halls Encoding/Decoding-Modell | 91 |
| 2.2.1 ›A model which has to be worked with and developed and changed‹ | 93 |
| 2.2.2 Impulse für die Forschung | 96 |
| 2.2.3 Kritik an Halls Modell | 97 |
| 2.3 Fiskes Lesarten: Bedeutungsfreiraum versus Ideologie | 101 |
| 2.3.1 Kurze Vorbemerkung zu ›Ideologie‹ und ›Hegemonie‹ | 101 |
| 2.3.2 Ideologische Fesseln: Codes of Television | 105 |
| 2.3.3 Textuelle Kontrolle: Realismus als ideologisches Konzept | 108 |
| 2.3.4 Vergnügen in den Cultural Studies | 111 |
| 2.3.5 Widerständiges Vergnügen bei Fiske | 114 |
| 2.4 Die Revisionismusdebatte | 119 |
| 2.4.1 Die Cultural Studies und der ›neue Revisionismus‹ in der Populärkulturforschung | 119 |
| 2.4.2 Fiske im Zentrum der Kritik | 122 |
| 3. Anbindung populärer Fernsehtexte an Diskurse | 130 |
| 3.1 Fiskes Diskursbegriff | 131 |
| 3.2 Fiskes Diskursanalyse(n) | 135 |
| 3.2.1 Diskursive Charaktere | 137 |
| 3.2.2 Wissen als diskursives Instrument | 138 |
| 3.2.3 »Media Matters« | 141 |
| 3.2.4 Populäre Texte aus diskursanalytischer Sicht | 144 |
| 3.3 Was charakterisiert Fiskes Blick auf Populäres? | 145 |
| Teil 3: »Wer wird Millionär?« und »GZSZ« im Diskurs der Fernsehkritik | 150 |
| 1. Inhaltliche Rahmung: Fernsehkritik, Soaps und Quizshows | 152 |
| 1.1 Zur Fernsehkritik | 153 |
| 1.2 Soaps und Quizsendungen in Deutschland | 158 |
| 1.2.1 Quiz Shows – ›Dinosaurier‹ der deutschen Fernsehunterhaltung | 160 |
| 1.2.2 »Wer wird Millionär?« (RTL) | 164 |
| 1.2.3 Daily Soap Operas – ein Neuling im deutschen Fernsehen | 168 |
| 1.2.4 »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« (RTL) | 172 |
| 2. Methode | 177 |
| 2.1 Begrifflichkeiten | 177 |
| 2.2 SZ, FAZ und die diskursive Zirkulation von Bedeutungen | 179 |
| 2.3 Das ausgewählte Analysematerial | 181 |
| 2.4 Methodisches Vorgehen | 182 |
| 3. Der Diskursstrang »GZSZ« in der Fernsehkritik | 187 |
| 3.1 Inhaltliche Schwerpunkte in der Bewertung von »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« | 187 |
| 3.2 Erster Fokus: Die Produktion | 189 |
| 3.2.1 Argumentationsstrang: »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« als Produkt der Kulturindustrie | 189 |
| 3.2.2 Argumentationsstrang: Soaps als Indikator für eine Negativentwicklung des deutschen Fernsehens | 194 |
| 3.3 Zweiter Fokus: Die Darstellerinnen und Darsteller | 201 |
| 3.3.1 Argumentationsstrang: Keine SchauspielerInnen bei »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« | 202 |
| 3.4 Dritter Fokus: Die Handlung | 208 |
| 3.4.1 Argumentationsstrang: Handlung nach Plan | 209 |
| 3.4.2 Argumentationsstrang: Wo ist der Bezug zur Realität? | 213 |
| 3.5 Vierter Fokus: Die ZuschauerInnen | 220 |
| 3.5.1 Argumentationsstrang: Passive RezipientInnen | 221 |
| 3.5.2 Argumentationsstrang: Handelnde Fans | 227 |
| 3.6 Zusammenfassung des Diskursstrangs zu »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« | 231 |
| 3.7 Cultural Studies oder ›Kulturindustrie‹? Zwei Blickwinkel auf »GZSZ« | 235 |
| 3.7.1 Parallelen zum Diskurs der Cultural Studies? | 236 |
| 3.7.2 »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« und die ›Kulturindustrie‹ | 242 |
| 3.8 »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« und Diskurse zum dualen Rundfunk | 246 |
| 3.8.1 Die Konvergenzhypothese | 246 |
| 3.8.2 ›Private ownership‹- versus ›public service‹-Diskurs | 249 |
| 4. Der Diskursstrang »Wer wird Millionär?« in der Fernsehkritik | 251 |
| 4.1 Zentrale inhaltliche Schwerpunkte | 251 |
| 4.2 Erster Fokus: Das Konzept von »Wer wird Millionär?« | 253 |
| 4.2.1 Argumentationsstrang: »Wer wird Millionär?« als perfekte ›Quizmaschine‹ | 254 |
| 4.2.2 Argumentationsstrang: »Wer wird Millionär?« als Ausdruck des Populären | 263 |
| 4.3 Zweiter Fokus: Die Produzenten | 269 |
| 4.3.1 Argumentationsstrang: Kein gutes Haar an den Produzenten | 269 |
| 4.4 Dritter Fokus: Der Moderator Günther Jauch | 274 |
| 4.4.1 Argumentationsstrang: Das Phänomen Jauch | 274 |
| 4.4.2 Argumentationsstrang: Schatten auf der weißen Weste | 280 |
| 4.4.3 Argumentationsstrang: Jauch zwischen Unterhaltung und Information | 285 |
| 4.5 Vierter Fokus: Die KandidatInnen | 291 |
| 4.5.1 Argumentationsstrang: ›Ungeniertes Unwissen‹ – die wahren Motive der KandidatInnen | 291 |
| 4.6 Fünfter Fokus: Die ZuschauerInnen | 300 |
| 4.6.1 Argumentationsstrang: »Wer wird Millionär?« als perfekter Publikumsanreiz | 301 |
| 4.7 Zusammenfassung zum Diskursstrang »Wer wird Millionär?« | 305 |
| 4.8 Cultural Studies oder Kulturindustrie? | 311 |
| 4.8.1 Parallelen zum Diskurs der Cultural Studies | 311 |
| 4.8.2 Der Diskurs der Kulturindustrie bei »Wer wird Millionär?« | 315 |
| 4.9 Diskurse zur Situation des Rundfunks | 318 |
| 4.9.1 Der Diskurs um Senderkonkurrenzen als Krise der öffentlich-rechtlichen Fernsehunterhaltung | 318 |
| 4.9.2 Was ist legitime Fernsehunterhaltung? | 320 |
| 4.9.3 Der Diskurs um Authentizität in der Mediengesellschaft | 322 |
| Resümee | 328 |
| Literatur | 338 |