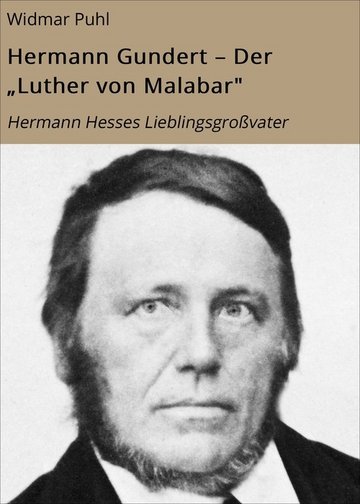Warum Missionar?
Wer sich fragt, warum Hermann Gundert sich am Ende trotz aller Zweifel und Alternativen für den Beruf des Theologen und Missionars entschied, stößt auf mehrere Antworten. Im Neuen Testament (Johannes 21,18) sagt der auferstandene Jesus zu dem Apostel Petrus, den er zu seinem geistigen Testamentsvollstrecker macht: „Ich sage dir: Als du jung warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest; bist du aber alt geworden, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst“.
Das Missionsblatt „Nachrichten aus der Heidenwelt“, das Ludwig Gundert im Stuttgarter Bibelhaus für die Basler Mission redigierte, erwies sich als erste nachhaltige Begegnung des Sohnes mit der Welt außerhalb der engen Grenzen, die er von daheim kannte. Schon als Gymnasiast hatte er gelegentlich etwas für diese Zeitschrift übersetzt. Nun schickt ihm der Vater regemäßig Artikel aus Ostindien, Afrika und Neuseeland zum Übersetzen aus dem Englischen. Hermann macht diese Arbeiten gern und schreibt 1832 an den Vater Sätze, die man aus heutiger Sicht durchaus prophetisch nennen möchte: „Darin stimme ich gern überein, dass Europa allmählich daran muss, gerechte Strafe zu erleiden für sein Unterdrückungssystem über die Erde. Ich mag das alte Europa mit seinem Mittelalter nicht mehr bedauern. Ich glaube bald selbst an eine ziemlich komplizierte Reaktion. Doch wird’s, denke ich, für alle wieder Morgen, und zwar ist er für Asien vielleicht so fern nicht mehr; ich passe besonders auf – Ostindien“. Er beschäftigt sich mit dem Versuch, den alten Glauben mit der Vernunft zu vereinen, und versucht eine Position in der Mitte zwischen den streitenden Parteien zu finden, zweifelt aber schon, ob der Mittelweg richtig oder eine Lauheit ist.
Mit den Freunden gibt es keine weltanschaulich tiefergehenden Auseinandersetzungen. Die Sorgen der Mutter um seinen rechten Weg kann er mit einfachen, kindlichen Worten immer wieder beruhigen. Das Studium geht flott voran. Zu Anfang ist die Arbeit an den „Nachrichten aus der Heidenwelt“ für Hermann sicher auch eine Art intellektueller Verführung: Geschickt, vielleicht instinktiv, nutzt der Vater Hermanns literarische, historische und sprachwissenschaftliche Ambitionen, um ihn mit der Verbreitung des Glaubens und dadurch auch mit der Frömmigkeit selbst zu beschäftigen. Aber er will mehr – und erreicht dieses Ziel. Seine Haltung, die beharrliche Ablehnung aller intellektuellen Experimente, wird mehr und mehr eine Herausforderung besonderer Art für Hermann. Johannes Hesse schreibt: „Er bringt das schönste aus der Philosophie, durch fleißige Aneignung in verständliche Sprache übersetzt. Der Vater weiß Besseres. Er holt aus der Schatzkammer der Poesie, was nur ein Menschenherz erreichen kann. Der Vater weiß Schöneres. Er sucht ihn heimisch zu machen in den Kreisen derer, für die er aus Liebe hätte sterben mögen, - der Vater hilft, wo es Not tut, und freut sich mit den Fröhlichen, aber sein Herz ruht in einem ganz anderen Zentrum und tut daraus die ruhigen, wunderbaren Atemzüge, die den Sohn reizen, abstoßen und doch immer wieder anziehen“. Was sollte er machen?
Am 20. Januar 1833 stirbt die Mutter, und Hermann reagiert mit tiefer Trauer und zugleich mit einem besonderen Gefühl der Betroffenheit und Verantwortung. Er beginnt damit, als Trost für seinen Vater aus den Briefen seiner Mutter „Christianens Denkmal“ zu schreiben – eine Art Familienchronik über das fromme und segensreiche Leben dieser Frau, dem wir viele Selbstauskünfte Hermann Gunderts verdanken. Er sah den weinenden Vater, der aber im Schmerz auch davon sprach, dass die Tote nun gottlob befreit und selig sei. Um die gleiche Zeit verliert Hermann seinen Freund Sattler, dessen Tod den Ernst in dieser Lebensphase des jungen Hermann zusätzlich verstärkt.
Zwei Jahre lang verbrachte er jede freie Minute mit der Niederschrift des „Denkmals“. Das gelang ihm so gut im Sinne seines Vaters, dass der gerührt schrieb: „Du hast mir mit diesem Denkmal einen Schatz geschenkt, bei dessen Genuss ich mir vorstellen mag, wie die altchristliche Welt zur Verehrung von Heiligen gekommen ist“. Dabei hatte der Vater 1834 zum zweiten Mal geheiratet – Emilie Mohl, die der Familie einen neuen Mittelpunkt gab und Ludwig Gundert noch einmal fünf Kinder gebar.
Im Sommer 1833 folgte den Zeiten revolutionärer Begeisterung eine Selbstmordwelle unter den Tübinger Studenten. Johannes Hesse: „Vergiftungsversuche und andere Ausgeburten des Wahnsinns kamen nacheinander zum Vorschein. Es sind damals schauerliche Tage und Nächte durchlebt worden“. Dieser erste Biograph bescheinigt Hermann, er habe „einen festen Willen und Besonnenheit bewahrt“.
Einer der Studienkameraden lief aus der Universität fort. Gundert reiste dem Komilitonen auf Bitten von dessen Mutter nach, aber der weigerte sich zunächst, mitzukommen, und pflegte weiter seine Selbstmordgedanken. In seinen autobiographischen Aufzeichnungen schreibt Gundert später: „Ich wollte einen Verzweifelnden halten und erlag, bis ich in stillen Tränen dahinlaufend mich ans Beten wagte – nicht für mich, nur für den Freund – und Erhörung fand. Es geschah dies mit törichten Ansichten vom Gebet als einer magischen Kraft, aus unverstandenen Jugenderinnerungen geschöpft. Weil ich aber doch unleugbar arm und elend war, ließ mich der Herr Gewissheit finden, dass ich meine Bitte haben solle, zugleich ließ der Regen nach, der Abendhimmel erheiterte sich, und ich meinte, es tue sich mir eine Aussicht auf aus unserem toll bewegten Treiben in eine stille geordnete Tätigkeit für das Himmelreich – als Missionar in Indien. Wie gerade der Name aufkam, kann ich nicht erklären; doch hatten wir manche indische Elemente in unserem damaligen Traumleben, und von früher her war ich mit Missionsblättern und dergleichen vom Bibelhaus aus bekannt“.
Man sollte diese Aussage, die Gundert als alter Mann zu Papier brachte, nicht überbewerten; der Gundert-Kenner Albrecht Frenz ist der Auffassung, dass dies nur der erste Anstoß war und beileibe noch kein klarer, gar kein endgültiger Entschluss.
Im August 1833 besuchte Hermann zum ersten Mal die Erbauungsstunde der pietistischen Studenten. Aber wie er später gestand, schämte er sich lange Zeit der nicht sonderlich intellektuellen „Brüder“. Die Ausnahme war ein gewisser Joseph Josenhans, dem Hermann einen stark ausgeprägten Charakter und eine priesterliche Seele bescheinigte, mit der er die anderen stützte. Der innere Kampf ging noch eine Zeitlang weiter, doch vor Ostern 1834 entschloss sich Hermann, dem Wahnsinn nahe wegen seiner seelischen Zersplitterung, in die Pietistenstube „Luginsland“ zu ziehen. Wochenlang lag er dort noch mit einem „Nervenfieber“ im Bett, kam aber langsam mit sich ins Reine und genas. Im Frühjahr 1835 betrachtete er sich als „bekehrt“, freute sich über eine ähnliche Entwicklung bei seinem Freund Hermann Mögling und ließ Strauß und die alten Freunde von nun an ihre eigenen Wege gehen.
Die Trennung beschleunigte sich unfreiwillig durch einen typischen Vorfall jener Zeit: Einer der alten Freunde wurde erschossen im Wald gefunden, und es stellte sich heraus, dass es Selbstmord gewesen sein musste. Während das ganze Stift zum Begräbnis ging, blieben nur die acht bis zehn Bewohner der Pietistenstube weg, „damit sie ihre höhere Heiligkeit durch Fernbleiben vom Grabe eines Selbstmörders an den Tag legen“, wie Johannes Hesse berichtet. Hermann aber war nur wegen Krankheit im Bett geblieben. Dennoch richtete sich der Hass der Übrigen auf ihn. Er hielt innere Einkehr und vertiefte trotzig seinen Umgang mit den Pietisten, vor allem mit Mögling, Josenhans und Otto Hermann, der ihn auch in die „Stunde“ eingeführt hatte. Mögling und Josenhans sollten in Gunderts späterem Leben noch eine große Rolle spielen. Jetzt kam Hermann in ganz neue Kreise.
„Die Gläubigen“, wie sich die engagierten Tübinger Pietisten nannten, um sich bewusst gegen alle Andersgläubigen abzugrenzen, pflegten Kontakte zum alten Gottlieb Wilhelm Hoffmann, dem Gründer der Korntaler Brüdergemeinde, den Zöglingen aus dem Basler Missionshaus und anderen Gleichgesinnten. Vor allem der Naturforscher und Erweckungsprediger David Spleiß, den Hermann im September 1834 hörte, machte wegen seiner holzschnittartig einfachen, aber charismatischen Worte einen tiefen Eindruck auf ihn. Durch Spleiß und dessen „rechte Geistesdiät“ kam er auf die Schriften von Friedrich Christoph Oetinger, die in den nächsten Jahren großen Einfluss auf Gunderts theologisches Denken hatten.
Sein zweites geistiges Leuchtfeuer war der bekannte Pietist Johann Albrecht Bengel. Hermann Gundert traf sich noch gelegentlich mit alten Freunden. So berichtet etwa Johannes Hesse: „Am 10. Dezember speiste er bei Uhland mit zwei anderen Dichtern, Lenau und Kurz, und mit Eduard Zeller, dem Primus der Promotion, zur Nacht. Aber der geistige Austausch mit diesen ging nicht mehr tief, war eher menschlich und überdies Gelegenheit, unter den jüngeren Studenten zu missionieren“. Am 30. Januar 1835 schrieb Hermann an seinen Freund Theodor Oehler im Haus der Basler Mission: „Denk nur, ich und Christoph Hoffmann haben schon helinge (insgeheim) bei einander entdeckt, dass wir große Lust hätten, Missionare zu werden“. Ende März kam daraufhin ein Brief von Oehler mit der Anfrage, ob er nicht Lehrer für die Söhne des Missionars Anton Norris Groves werden wolle, der sich auf die Reise nach Indien vorbereitete. Der Gedanke an die Mission setzte sich immer mehr fest, wenn sich Gundert auch noch...