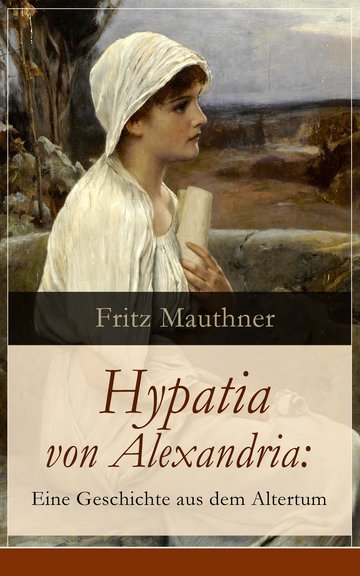1. Die Jugend der Hypatia
Unter der Pflege einer treueren Amme, einer ehrlichen braunen Fellachin, war Hypatia ein Jahr alt geworden und zum Geburtstag hatten sich viele Kollegen Theons und viele Beamte aus der Stadt mit hübschen und kostbaren Geschenken eingefunden. Das Patenkind des Kaisers, da es so schön und ernst und glücklich in seiner Wiege lag, wurde wie eine Prinzessin bedacht. Auf das Wort des Kaisers hin hatten griechische Hexen und ägyptische Pfaffen, sowie jüdische Kabbalisten dem kleinen Fratzen eine glänzende Zukunft vorausgesagt. Da war keiner unter den Gratulanten, welcher nicht an die Zauberei seiner Religion oder an die Macht des Kaisers Julianos geglaubt hätte. Und so erhielt die kleine Hypatia hundert Gaben, die sie nicht verstand, darunter viele geheimnisvolle Mittel gegen Krankheit und Not, Amulette, welche so ein Glückskind doch niemals brauchen konnte. Und die Blüte der heiligen Lilie, welche der Philosophenstorch mühsam genug aus dem innersten Gärtlein des Ammontempels für das Kind geholt hatte und welche er ihr nach einem Fluge von vielen Meilen bei Sonnenaufgang durch das Fenster vor die Wiege warf, wurde von achtlosen Männern zertreten.
Auf seinem mächtigen Fluge nach der heiligen Lilie erfuhr der traurige Marabu schlimme Neuigkeiten von anderen weitgereisten Vögeln, von Adlern und Geiern. Doch er mußte schweigen, denn man hätte ihm doch nicht geglaubt. So saß er denn Tag und Nacht trübselig da und verschmähte die leckersten Fische. Sechs Wochen später kam das schreckliche Gerücht zu Fuße nach Alexandria, so unsicher und ängstlich freilich, daß die Parteien der Stadt stumm und tatenlos sich gegenüberstanden. Kaiser Julianos sei tot!
Wieder vier Wochen später war es kein Gerücht mehr. In der glühenden Wüste jenseits des Tigris hatte sich das römische Heer aufgerieben im Kampfe gegen die feindliche Natur. Julianos war vielleicht ein guter Soldat gewesen, ein großer Feldherr war er nicht. Oder die Perser mußten aus der Umgebung des Kaisers beraten gewesen sein. Nichts gelang, nirgends stellte sich der Feind zur Schlacht, Armee und Volk von Persien mit allem Vieh und allen Vorräten zogen tiefer und tiefer ins Innere des Landes und ließen das kaiserliche Heer allein in einer Wüste. Wo eine Stadt eingenommen wurde, da schlugen wenige Stunden später die Flammen an allen vier Enden empor.
Und dann kam der furchtbare Tag im Engpaß, wo der Kaiser bei der Nachhut überfallen wurde, wo er wie ein Rasender der Überzahl entgegenritt und mitten im Gedränge von der Seite den tödlichen Schuß empfing. In der Todesnot hatte der gelehrte Libanios ausgehalten neben ihm, und sein Bericht verkündete der Welt die letzten Worte des letzten römischen Kaisers. Das hervorquellende Blut wollte Julianos mit der rechten Hand zurückhalten, bald aber warf er es dem Himmel entgegen, als wollte er sich selbst dem Zorn des neuen Gottes als Menschenopfer darbieten. Dann sank er zurück, graue Todesblässe überzog sein Antlitz und er flüsterte: »Galiläer, jetzt hast du gesiegt.«
Libanios fügte seinem Berichte verdammende Worte über die Mörder seines Herrn hinzu.
Ein neuer Kaiser stieg auf den Thron und bald wieder ein neuer. Doch in Alexandria hörte man nur ihre Namen und fragte immer nur noch nach den Mördern des Kaisers Julianos. Es hieß, der König von Persien hätte demjenigen seiner Soldaten, der sich rühmen könnte, den römischen Kaiser getroffen zu haben, ein Vermögen versprochen. Aber kein Perser machte sein Recht geltend. Man erzählte, der erste Schuß des Treffens hätte dem Kaiser gegolten, und dort, woher der Schuß kam, standen keine Perser. Zwei Tage lang wagte der Erzbischof von Alexandria nicht sein Haus zu verlassen. Denn der Pöbel drohte ihn zu steinigen und nannte ihn laut den Mörder des Kaisers. Doch wieder kam aus Konstantinopel ein Schiff, mit Gold für die Kirche von Alexandria und mit neuen Verordnungen, welche den Kaiser Julianos einen Abtrünnigen und Gotteslästerer nannten. Da zog der Erzbischof frei vor allem Volk in seine Kathedrale und las ein Hochamt; der Pöbel von Alexandria stand am Wege und verhöhnte die armen Soldaten, die nun aus dem unglücklichen Feldzuge heimkehrten, krank und in Fetzen, Krüppel und Invaliden.
Einer von den rückkehrenden Soldaten, der degradierte Fahnenträger eines Reiterregiments von der Donau, beichtete lange im Privatzimmer des Erzbischofs Athanasios. Man kannte ihn nicht, nicht ihn und nicht das fürstliche blonde Weib an seiner Seite; aber man nannte ihn den Mörder des Kaisers und wollte ihn nicht dulden in der Stadt. Der alte Fähnrich aber warf stolz die schwarzen Flechten in den Nacken, strich sich trotzig den geflochtenen Schnurrbart und betete in allen Kirchen und suchte sich ein Heim für das Weib, das er irgendwo in Germanien erbeutet hatte. Er fand endlich ein Obdach in dem verlassenen Gespensterhaus, einem burgartigen Bau, hinten an der Stadtmauer, zwischen den ägyptischen Museumsanlagen und den Friedhöfen, zwischen dem Serapeum und der Totenstadt.
Was der Marabu vor ihrem Fenster klapperte und was der Vater vor ihrer Wiege traurig immer wieder sagte: »Galiläer, du hast gesiegt!« das schien der kleinen Hypatia gleich drollig. Denn sie lächelte, wenn der Vater neben ihr stand, und sie lachte, wenn der Philosophenstorch durch das offene Fenster ungeschickt zu ihr hineinspazierte, um ihr die Zeit zu vertreiben.
Es war einsam geworden in der Akademie seit dem Tode des Kaisers. Monatelang ängstigten sich die Professoren vor dem Übermut des Erzbischofs Athanasios, und auch später, als von Konstantinopel der Befehl gekommen war, nichts an dem Bestehenden zu ändern, die strenge Weisung, die heidnischen Lehrer der Hochschule auf den Aussterbeetat zu setzen, sie aber zunächst im ungekränkten Genuß ihrer Stiftungen zu belassen, da blieb es einsam und still in den Zellen und auf den Höfen der berühmten Schule. Drüben das neu erhöhte und vergoldete Kreuz der Kathedrale überragte nun das Dach der Sternwarte.
Gerade unter der Sternwarte hatte Professor Theon seine kleine Dienstwohnung. Der Mathematiker war sein Flurnachbar. Theon lebte und schlief in seiner Arbeitsstube; sein Wohnzimmer hatte er dem Kinde und der Pflegerin überlassen, der braunen Fellachin.
Noch ein anderes junges Menschenwesen lebte dort, wenige Schritte von der kleinen Hypatia. Isidoros, ein siebenjähriger Junge, ein hochaufgeschossener, brauner, schwarzhaariger, langarmiger Spatzenschreck, durfte im Vorzimmer des Mathematikers hausen, schlafen oder studieren, leben oder sterben. Niemand wußte so recht, wem dieser scheue und doch wieder rücksichtslose Knabe gehörte. In den Gesindezimmern der Akademie erzählte man sich darüber eine wüste und unwahrscheinliche Geschichte. Ein ägyptischer Priester, der ja zur Ehelosigkeit verurteilt war, sei der Vater, eine Nonne, eine Verwandte des erzbischöflichen Sekretärs, sei die Mutter. Ägyptisches und syrisches Blut, eine nette Mischung! Das Kind sei vor dem erzbischöflichen Palais ausgesetzt gewesen, aber als es dem Verhungern nahe war, von irgendeiner gutmütigen Dienstmagd in seinem Weidenkorbe nach der Akademie herübergebracht worden. Und die Anatomiediener behaupteten, Isidoros sei eigentlich schon tot und ihnen verfallen gewesen; man habe den Knaben künstlich zum Leben gebracht. Genug, für das Waisenkind fand sich in der kleinen Stadt, welche die Akademie hieß, zwischen weltentrückten Lehrern und einer reichlich besoldeten Dienerschar ein Plätzchen zum Weiterwuchern. Wie das Unkraut zwischen den Steinen in den Ecken der Höfe, so schoß er auf, genährt und gestoßen wie die halbwilden Hunde auf diesen Höfen. Und wenn niemand wußte, in wessen Obhut Isidoros aufwuchs, wer ihn kleidete und wer ihm Unterricht erteilte, so fragte der Knabe am wenigsten danach. Zur Mittagszeit aß er etwas an der Schwelle, welche die nächste war, schlechte Kleider erhielt er mehr, als er völlig zu Fetzen tragen konnte, und seine Kenntnisse, ja, um seine Kenntnisse war es eine seltsame Sache.
Als Isidoros etwa fünf Jahre alt war, verbreitete sich plötzlich in der ganzen Akademie die Nachricht, er sei ein Wunderkind. Zwei Professoren, Theon und der Mathematiker, hatten ihn beobachtet, wie er den Sandweg am Springbrunnen des dritten Hofes dazu benutzte, um die geometrischen Linien einer schwer zu berechnenden Mondfinsternis grob, aber richtig mit einem Stäbchen nachzuzeichnen. Man staunte und forschte und es kam heraus, daß der kleine Junge womöglich alle mathematischen und astronomischen Vorlesungen durch die offenen Fenster oder drinnen im Saale selbst, hinter einem Wandpfeiler versteckt, mit angehört hatte und unter den ordentlichen Schülern schon lange als ein närrischer Weisheitsschatz galt. Eine nähere Untersuchung ergab, daß Isidoros alle die verzwickten Formeln und langen Zifferreihen nur auswendig wußte, daß er ihren inneren Zusammenhang mitunter ungefähr ahnte, gewöhnlich aber gar nicht verstand.
Auf Wunsch des alten Mathematikers wurde Isidoros in die Kinderschule gesteckt. Dort verschlang er mit glücklicher Gier binnen vier Monaten, womit die anderen Schüler sich jahrelang abplagten. Seit dieser Zeit eben durfte er im Vorzimmer des Mathematikers schlafen, und sogar an den Kaiser nach Konstantinopel ging ein Bericht über das Wunderkind ab. Und wirklich setzte eine der Prinzessinnen eine kleine Stiftung für den Knaben aus. Er sollte gute christliche Bücher zum Geschenk bekommen und zu einem Streiter für den neuen Glauben erzogen werden. Weiter reichte die Stiftung freilich nicht.
So war der Flurnachbar des schönen kleinen Heidenkindes; aber er bekümmerte sich um Hypatia weder im Guten noch im Bösen.
...