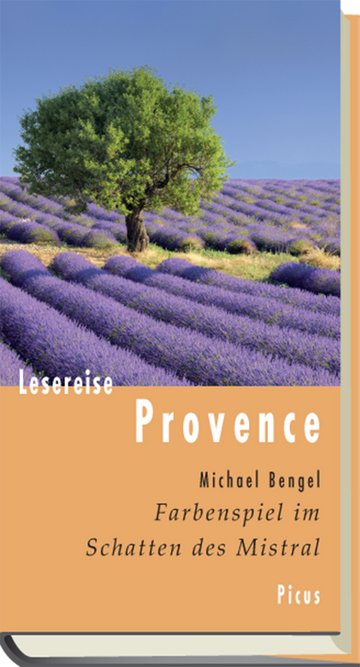Der weiße Riese
Zu Fuß auf den Mont Ventoux
Wenn drei dasselbe tun, ist es noch lange nicht dasselbe, vor allem, wenn Jahrzehnte und Jahrhunderte dazwischen liegen, so wie hier: 1336, 1865, heute. – »Heute habe ich den höchsten Berg dieser Gegend bestiegen, den man nicht unverdientermaßen Ventosus, den Windigen, nennt. Dabei trieb mich einzig die Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks Erde durch Augenschein kennenzulernen.« So schrieb der junge Geistliche und Dichter Francesco Petrarca tief in der Nacht am 26. April des Jahres 1336 im Brief an einen väterlichen Freund fern in Paris. Noch war die Dienerschaft damit beschäftigt, dem Herrn ein spätes Nachtmahl zu bereiten, da hatte sich der Zweiunddreißigjährige bereits zurückgezogen, »um dir dies hier in Eile und aus dem Stegreif zu schreiben, damit nicht, wenn ich es aufschöbe, durch Ortsveränderung etwa die Gemütsbewegung sich wandele und so der Vorsatz zum Schreiben verbrause.« – So danken wir ihm nun das erste Zeugnis einer solchen Unternehmung.
Auch 1865 war der Aufstieg noch ein mühevolles Unternehmen. »Wir waren unser acht«, berichtete der Lehrer, Dichter, Maler und begnadete Insektenforscher Henri Fabre über die Besteigung im August, »bei dreien war die Botanik die treibende Kraft, die fünf anderen lockte die Bergtour und das Gipfelpanorama. Aber keiner jener fünf, denen das Studium der Pflanzen nichts sagte, hat nachher den Wunsch geäußert, mich nochmals zu begleiten. Denn tatsächlich, der Aufstieg ist beschwerlich, und ein Sonnenaufgang entschädigt nicht für die ausgestandenen Strapazen.«
Heute führen Straßen auf den Gipfel, die Bergtour wird zur Ausflugsfahrt, das Gipfelpanorama zur Belohnung für die sachten Mühen am Volant. Wohl ein halbes Dutzend Mal schon hatten wir auf diesem Weg den Mont Ventoux befahren, im Frühjahr halb im Schnee des Mont Serein, während in den Höhentälern der Dentelles de Montmirail bereits die Aprikosen blühten, im Sommer auf der Flucht vor der sengenden Hitze, im Herbst, als an den Hängen des Ventoux das Weinlaub sich verfärbte: Einmal sahen wir den Gipfel über einem Ozean aus Wolken, weiß wie Watte bis zum Horizont; einmal bei Mistral mit einem Fernblick, in dem die Gletscher des Montblanc-Massivs funkelten und der in der Gegenrichtung eine Ahnung von den Pyrenäen bot. An solchen Tagen wussten wir: Wir würden einmal auch den Berg zu Fuß bezwingen. Wir hatten Fabre und Petrarca oft genug gelesen, um ihre Fährte aufzunehmen. Und wenn wir wohl auch auf getrennten Wegen wandern würden, so doch immerhin zum selben Ziel.
Petrarca aus dem italienischen Arezzo, geboren 1304, war schon als Kind ins Venaissin gekommen, wo sein Vater Dienst tat als Notar am Papstpalast zu Avignon. Der Kosten wegen lebte man in Carpentras; das war nicht so splendid und spleenig wie die Kapitale. Nach Studien in Montpellier und in Bologna, nach Aufenthalten in Paris und Flandern kehrte er zurück nach Avignon. Dort traf er wieder auf den Riesen seiner Kindheit und nahm es endlich mit ihm auf: »Dieser Berg aber, der von allen Seiten weithin sichtbar ist, steht mir fast immer vor Augen.«
Oben wurde ihm der Mont Ventoux zur emblematischen Erfahrung: »Wohl aber liegt das Leben, das wir das selige nennen, auf hohem Gipfel, und ein schmaler Pfad, so sagt man, führt zu ihm empor.« So modern er auch als Dichter wurde: Hier war er ganz der Mann des Mittelalters, der jegliche Erscheinung als ein Zeichen Gottes nahm.
Für Fabre, den Gelehrten aus dem nahen Sérignan, mochte der Ventoux so etwas wie ein Hausberg sein. So maßvoll, wie er im Privaten war, so maßlos war er bei der Arbeit. »Groß wie ein Schnupftuch« war sein Tisch, schier unermesslich aber, was er daran schuf: Hundert Werke für die Schule, die zehn berühmten Bände mit insektenkundlichen Erinnerungen (»Souvenirs Entomologiques«), siebenhundert Aquarelle zu den Pilzen seiner Heimat, die Pflanzen aufbewahrt in Dutzenden Herbarien, die Muscheln, Schnecken, Käfer und Insekten zahllos in Regalen. Heute preist man ihn, der dichten Schilderungen wegen, als Homer und Vergil der Insekten. Und dennoch war er ganz ein Mann des 19. Jahrhunderts und seiner geltenden Methode. Was ihn trieb, war der positivistische Blick – nichts mehr von Bekenntnis oder gar Bekehrung: »Der Mont Ventoux lässt sich am besten mit einem Haufen jenes Schotters vergleichen, den man zum Unterhalt der Straßen benötigt. Denkt euch diesen Haufen zweitausend Meter hoch, gebt ihm eine entsprechende Basis, bekleidet den weißen Kalkfelsen mit dunklen Wäldern, und ihr könnt euch von diesem Berg eine ziemlich genaue Vorstellung machen.« So lautet sein Bericht. Und maßlos wie in allem war er auch mit dem Ventoux: Der Aufstieg im August des Jahres 1865 war sein dreiundzwanzigster!
Und wir? Wir hatten tags zuvor noch auf dem Felsenhügel von Orange gestanden, zur warmen Nacht hoch über dem Rund des antiken Theaters. »Carmen« stand auf dem Programm, die Stadt war von Besuchern überfüllt, sogar am Rand des Felsens drängten sich die Menschen. Und während noch hier oben einzig die Zikaden sangen, sahen wir mit einem Mal im letzten Dämmerlicht den kahlen Gipfel des Ventoux. Dann wischte über Nacht ein Zipfel vom Mistral die schwüle Hitze und den Dunst vom Himmel wie bestellt, und wir vereinbarten im Les Florets in Gigondas, dass wir vielleicht zum Abendessen etwas später kämen. Wir kamen mit Verspätung, sonnenverbrannt und hungrig, doch wir kamen vom Ventoux – wie Fabre und Petrarca.
Als wir das Auto nah am Brunnen in den Schatten stellten, schlug im Turm von Sainte Colombe die Glocke eben zehn. Die Hauptstraße am Südhang, von Bédoin, dem Nachbardorf, hinauf zum Mont Ventoux, heißt Avenue du géant de Provence, sie wurde 1882 eingeweiht, und eben hier in Sainte Colombe begann der Festzug auf den Gipfel, zum ersten Mal mit Kutschen und Kaleschen. Dort glaubte ein Professor Alayac sich mit gelehrten Artigkeiten bei den Leuten einzuschmeicheln, die zu Fuß gekommen waren: »Die wenigen Bewohner, die hier leben«, sagte er in seiner Rede, »sind misstrauisch, da sie abgeschieden in den Wäldern leben, die noch durch Wölfe bewohnt und durch Räuber besucht werden.« Ob sie es nur dem Sturmwind überlassen haben, den Professor auszupfeifen?
Erst 1932 gab es auch am Nordhang eine Straße von Malaucène, von wo Petrarca aufgebrochen war, und 1950 eine weitere von Sault. Für uns genügt ein kleiner Weg, schnörkellos die Flanke hoch: Chemin des fébriers et du Ventoux. Er bringt uns am Friedhof vorüber, vorbei an Wein- und Kirschplantagen, dann sehen wir im Dunst zum ersten Mal das Ziel: den kahlen Gipfel mit dem weißen Turm, ein leichter Wolkenfetzen hängt wie eine Wetterfahne am Antennenmast. »Ventosus« nannte man den Berg bereits im Mittelalter, und keiner ist so windig wie der Mont Ventoux. 1967 maß man hier im Februar dreihundertzwanzig Stundenkilometer, das ist französischer Rekord. Vom Westen tost hier der Rousau, vom Osten der Levant, vom Meer kommt der Marin, vom Norden ihrer aller Meister, der Mistral, der kalte Wind aus dem Zentralmassiv, der sich hier noch einmal abkühlt, ehe er durchs Tal der Rhône weitertobt. Anderen zufolge ist der Name weitaus älter und stammt vom keltischen Begriff »vintur«, der aus antiker Zeit schon überliefert ist. Vintur: Das meint den weißen oder schneebedeckten Gipfel, und auch das passt gut zum Mont Ventoux. Das weiße Kalkgestein des kahlen Gipfels sieht von Weitem aus wie Schnee, und vom späten Herbst bis weit ins Frühjahr liegt tatsächlich Schnee auf dem Ventoux.
Man nennt ihn »Wächter der Provence«, weil die Provence und mehr von hier zu überblicken ist: ein Felsmassiv von fünfundzwanzig Kilometer Länge, fünfzehn Kilometer breit, das ohne Vorgebirge und Terrassen weithin sichtbar aus dem flachen Umland bricht, tausendneunhundertneun Meter an der höchsten Stelle. Dreihundertfünfzig Meter hoch liegt Bédoin, wo Henri Fabre aufgebrochen ist; wir haben mit dem Start in Sainte Colombe noch hundert Höhenmeter wettgemacht. Jetzt fehlen uns noch etwa tausendvierhundertfünfzig. Es geht auf weißem Schotter durch den ersten Niederwald, vorbei an Pinien und kleinen, zähen Kermeseichen, am Boden Buchsbaum, Thymian und Stechginster. Die Piste ist als Wanderweg markiert, seine weiß-roten Balken bestätigen uns die Richtung, die wir von der Karte kennen: immerfort bergauf.
Nach einer Stunde nähern wir uns dem Massif des Cèdres. An der Höhe 839 berühren wir kurz einen alten Asphaltweg, dann geht es steil hinauf im Zedernwald. Als Fabre unterwegs war, hieß der Mont Ventoux noch bitter »Mont Pelé«, geschälter Berg, und sah auch ganz so aus: Die Menschen an den Hängen hatten ihn Jahrhunderte hindurch geplündert, abgeholzt, gerodet und versengt. Mit Feuer schuf man neue Weideflächen, wenn die alten ganz und gar verbissen waren; rund achtzigtausend Schafe grasten um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts am Ventoux (verglichen mit dreitausend heute), die Schweine und die Ziegen nicht zu erwähnen; mit dem Holz der alten Wälder heizte man die Häuser, deren Balken man zuvor am selben Ort geschlagen hatte, und aus den Kalköfen und Glasschmelzen des Umlands stiegen sie als Rauch zum Himmel. Fabre hat den Umschwung noch erlebt, die großen Aufforstungsbemühungen mit Schwarzkiefern aus Österreich, mit Eichen, Buchen und mit Zedern aus dem Atlasgebirge Marokkos.
Heute trägt der »Mont Pelé« an seinen Flanken wieder einen dichten Hochwald, in dem sich eine reiche Fauna angesiedelt hat mit Mufflon, Dachs und Gämse. Wir sehen freilich nur Kaninchenkötel unter den Maulbeerbäumen. Doch mehr denn je gilt Fabres Satz von einst: »Ein halber Tag senkrechten Aufstiegs lässt vor unseren Blicken eine Folge von Pflanzentypen vorüberziehen, denen man sonst nur...