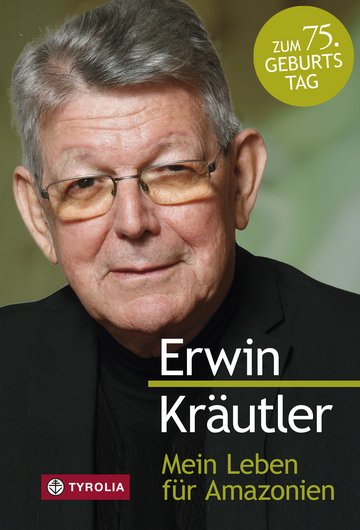1.Von Koblach über Salzburg
nach Amazonien
Aufgewachsen in Vorarlberg – mit der KAJ
Ich bin in Koblach 153, heute Dorf 48, in Vorarlberg geboren und aufgewachsen. Dort hat mich schon früh die Erfahrung mit der KAJ, der Katholischen Arbeiterjugend, sehr geprägt. Obwohl Student, habe ich in den 1950er Jahren in Koblach die KAJ mitbegründet. In den Ferien habe ich auf dem Bau gearbeitet. Unsere Familie war eine Großfamilie mit sechs Kindern. Der Vater war Alleinverdiener. Damit ich auch selbst einmal etwas in der Tasche hatte, nutzte ich die Schulferien, um etwas Geld zu verdienen. So bin ich mit der Arbeiterschaft in Kontakt gekommen, mit den Bauarbeitern und habe mich mit ihnen befreundet. Diese Freundschaften halten bis heute an.
Sehr beeindruckt haben mich in meiner Gymnasialzeit die französischen Arbeiterpriester. Irgendjemand, ich weiß absolut nicht mehr, wer es war, gab mir den Roman Die Heiligen gehen in die Hölle von Gilbert Cesbron zu lesen. Der Roman erzählt, wie der Priester Pierre sich entschloss, in der Banlieue von Paris mit Fabrikarbeitern zusammenzuleben, und selbst Fabrikarbeiter wurde. Hautnah erlebte er die familiären und Einzelschicksale der Arbeiter und bewies in einem vom Klassenkampf geprägten Milieu, dass die Liebe mächtiger ist als aller Hass. Ich war begeistert von dieser Art, Priester zu sein. Es gab auch in Vorarlberg einige Priester, die in diese Richtung gegangen sind. Sie waren keine Arbeiterpriester im engeren Sinne, aber sie waren für mich Vertreter einer Kirche, die heruntersteigt. Das war genau das, was ich mir damals von der Kirche erwartet habe, dass sie herabsteigt und im Arbeitermilieu landet.
Ich habe in Vorarlberg ganz konkret die Probleme der Arbeiter erfahren, ich möchte fast sagen, ihre Orientierungslosigkeit. Man kann sich das heute nicht mehr so vorstellen, aber jeder Arbeiter hat etwas gesucht, jeder wollte, dass sein Leben gelingt. Gleichzeitig hat aber jeder erlebt, dass er als Arbeiter zur untersten Kategorie in der Gesellschaft gehörte – „Wir sind eben nur Maurer, Baraber, Handlanger“.
Damals war Vorarlberg Ziel einer „Völkerwanderung“ aus Kärnten, der Steiermark, dem Burgenland und Oberösterreich. Viele junge Leute kamen aus diesen Bundesländern, weil in Vorarlberg die Textilindustrie blühte und sie deshalb hier Arbeit fanden. Sie hießen einfach „Kärntner“, „Steirer“ oder „Burgenländer“. Man ließ sie spüren, dass sie von jenseits des Arlbergs kamen und nicht zum „Ländle“ gehörten, wie wir Vorarlberger unsere Heimat nennen. Wir sind Alemannen, und die anderen waren keine Alemannen. Ich möchte nicht sagen, dass man diese Menschen deshalb respektlos behandelt hätte, aber man hat es ihnen schwergemacht und sie haben sich schwergetan, Zugang zu finden. In der KAJ aber haben wir sie herzlich aufgenommen. Es sind viele Freundschaften entstanden. Es gab sogar Hochzeiten.
Schon vor der Matura ist mir der Gedanke gekommen, dass ich nicht nur als Arzt den Menschen zur Seite stehen könnte, sondern auch als Priester. Ich habe dann wider alle Erwartungen von Mitschülern und Lehrern bei der Matura die schwarze Rose aufgesteckt. Das war das Zeichen, dass ich Theologie studieren werde. Auch meine Familie war einigermaßen überrascht. Der Vater hat letztendlich nur gesagt: Alles in Ordnung, aber mach mir keine Schande! Die Mutter sagte nichts, aber ich spürte, wie sie sich über meine Entscheidung freute.
An die Mission hatte ich vorerst nicht gedacht. Aber auch Diözesanpriester zu werden war für mich eigentlich kein Thema. Wenn Priester, dann Ordenspriester. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, Jesuit zu werden. Aber dann hat mein Onkel Erich Kräutler – er war seit 1934 in Amazonien und von 1971 bis 1981 Bischof der Prälatur Xingu – erfahren, dass ich Priester werden wollte, und er ließ mir sagen: Wenn schon, dann kommst du zu uns. Was ja nicht ganz unlogisch war. Ich hatte zudem ein paar Freunde, die in die Kongregation vom Kostbaren Blut eingetreten sind. Das alles war entfernt mit dem Gedanken der Mission verbunden, die man sich damals so vorgestellt hat: Ich gehe nach Übersee, helfe den Armen und verkünde das Evangelium.
So bin ich nach der Matura 1958 in Schellenberg, Liechtenstein, bei den Missionaren vom Kostenbaren Blut eingetreten und habe dort das Noviziat gemacht. 1959 begann ich in Salzburg mein Universitätsstudium. Ich machte in Philosophie das Lizenziat, dann habe ich Theologie studiert. Dabei bin ich manchmal sehr unsicher geworden, ob das mein Weg ist. Ich bin nicht mit einem Hurra zum Priesterberuf durchmarschiert. Die Entscheidung für die Weihe habe ich aber ganz bewusst gefällt. Ich bin vom damaligen Salzburger Weihbischof Eduard Macheiner am 16. Dezember 1964 zum Subdiakon und am 18. Dezember zum Diakon geweiht worden.
Im Jänner 1965 begann ich dann zu überlegen, wie und vor allem wo es weitergeht. Ich hatte bemerkt, dass die Vorgesetzten der Kongregation wollten, dass ich weiterstudiere, und zwar Altphilologie: Griechisch und Latein. Ich mag beide Sprachen bis heute sehr gern, aber ich habe mich gefragt, ob ich dafür Priester werden muss? Dann kam mir der Gedanke: Ich gehe nach Brasilien. Denn in Österreich gab es damals noch genügend Priester. So ging ich zum Provinzial und sagte ihm schlicht und einfach: Lieber Pater Provinzial, ich würde gern nach Brasilien gehen, an den Xingu. Der Provinzial sah mich an und erwiderte kurz: Ich bin der Meinung, dass wir unsere jungen Leute dorthin schicken sollen, wo es wirklich brennt.
Das Konsultorium der Provinz war aber noch nicht ganz einverstanden. Einer von den Konsultoren meinte, ich würde hier in der Provinz benötigt, und wollte deshalb die Entscheidung von einer Untersuchung abhängig machen, ob ich überhaupt tropentauglich sei. Ich wurde also nach Mindelheim in der Nähe von Memmingen in ein Krankenhaus geschickt. Dort hat man mich auf Herz und Nieren geprüft. Ich wusste jedoch, dass ich gesund war. Ich bin damals Ski gefahren, war Bergsteiger und war nie ernstlich krank. Am Schluss der ganzen Untersuchungsbatterie hat der Chefarzt gesagt: Sie sind mehr als tropentauglich, Sie sind ein kerngesunder Vorarlberger. – Danke, genau das wollte ich hören.
Ab 1963 hat auch das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) ein wenig mitgespielt, vor allem der Gedanke des geschwisterlichen Teilens in der Weltkirche: Wenn wir hier in Europa viele Priester haben, dann haben wir den Auftrag, dorthin zu gehen, wo es nur wenige gibt. Der Salzburger Dogmatiker Ferdinand Holböck hat sich in seinen Vorlesungen bereits mit dem Konzilsdokument Sacrosanctum Concilium auseinandergesetzt, der Konstitution über die heilige Liturgie, die am 4. Dezember 1963 verabschiedet worden war. Unter den Theologiestudenten verbreitete sich eine große Begeisterung, eine wahre Aufbruchsstimmung.
Auch unser Missionsverständnis änderte sich. Wir wollten eine Kirche, die volksnahe ist, die nicht abgehoben ist. Wir wollten Priester werden, die nicht über dem Volk stehen, sondern bei den Leuten und mit den Leuten sind. Aber selbstverständlich war der Priester damals eine angesehene Persönlichkeit. Diese Hochachtung habe ich besonders bei der Primiz erfahren. Als ich nach meiner Priesterweihe als „Pater Erwin“ in meine Heimatgemeinde Koblach kam und meine erste heilige Messe feierte, war das ganze Dorf auf den Beinen. Ältere Leute erzählen heute noch davon. Wir feierten den Gottesdienst schon am Volksaltar, allerdings noch in lateinischer Sprache. Die Wandlungsworte habe ich aber nicht leise vor mich hingesagt, wie das damals üblich war, sondern ich habe sie laut gesprochen. Mein Heimatpfarrer Alfred Bildstein, der mir bei der Primiz assistierte, meinte nach dem Schlusssegen: Du hast aber Mut! Dom Clemente Geiger, mein erster Bischof in Brasilien, vertrat die Ansicht, die Lesungen und andere Texte würden in Zukunft wohl portugiesisch sein, aber das eucharistische Hochgebet mit den Wandlungsworten würde für immer und ewig lateinisch bleiben.
Alles ging dann sehr schnell. Ich habe am 3. Juli 1965 in Salzburg die Priesterweihe empfangen und habe die anschließenden Wochen in Salzburg, Vorarlberg, in Liechtenstein, der Schweiz und im süddeutschen Raum verbracht. Ich war viel unterwegs. Befreundete Brautpaare luden mich ein, sie zu trauen. Zwei Mal hielt ich eine Bergmesse auf dem Hohen Freschen. Bis ich dann am 2. November, am Geburtstag meines Vaters, von meiner Familie Abschied nahm. Ich fuhr mit dem Zug von Feldkirch nach Hamburg. Am 4. November 1965 ging ich an Bord der Emsstein der Norddeutschen Lloyd, die mich nach Brasilien brachte.
Am 18. November 1965, um vier Uhr nachmittags, betrat ich in São Luís do Maranhão das erste Mal brasilianischen Boden. Diese Uhrzeit erinnerte mich an die Stelle des Johannesevangeliums, die beschreibt, wie zwei Jünger Jesus das erste Mal begegneten: „Es war um die zehnte Stunde“ (Joh 1,39), heißt es dort, also um vier Uhr nachmittags. Die Emsstein hatte in São Luís einen Teil ihrer Fracht zu löschen. So war ich einige Tage bei den Franziskanern im Stadtteil „Alemanha“ (Deutschland) zu Gast. Die Reise ging dann weiter bis nach Belém do Pará,...