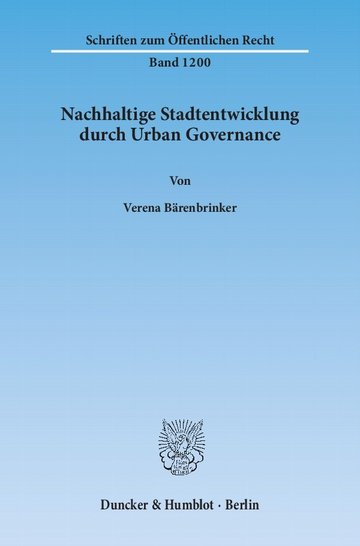| Vorwort | 6 |
| Inhaltsübersicht | 8 |
| Inhaltsverzeichnis | 10 |
| Abkürzungsverzeichnis | 20 |
| 1. Teil: Einleitung | 26 |
| A. Gegenstand der Untersuchung | 26 |
| B. Segregation und neue soziale Frage | 28 |
| C. Leitbild der nachhaltigen Entwicklung | 28 |
| D. Governance in der Stadtentwicklung | 30 |
| E. Gang der Untersuchung | 30 |
| 2. Teil: Herausforderungen der Stadtentwicklung | 32 |
| A. Tendenzen in der Stadtentwicklung | 32 |
| I. Städtewachstum | 33 |
| II. Ungleichzeitigkeit der Stadtentwicklung | 35 |
| 1. Schrumpfende Städte | 36 |
| 2. Wachsende Städte | 41 |
| 3. Jahrhundert der Städte | 43 |
| III. Zusammenfassung | 44 |
| B. Segregation: Die neue soziale Frage | 46 |
| I. Stadt als Funktions- und Sozialraum | 46 |
| II. Segregation | 47 |
| III. Arten von Segregation | 50 |
| IV. Entstehung von Segregation | 52 |
| 1. Wohnungsmarkt | 52 |
| a) Angebotsseite des Wohnungsmarktes | 53 |
| b) Nachfrageseite des Wohnungsmarktes | 53 |
| aa) Ressourcen | 54 |
| bb) Präferenzen | 54 |
| 2. Strukturwandel in der Bundesrepublik | 56 |
| 3. Erschöpfung des Wohlfahrtsstaates | 58 |
| V. Effekte der Segregation | 59 |
| 1. Quartiere der Armut und Ausgrenzung | 60 |
| 2. Perspektivlosigkeit | 63 |
| 3. Stigmatisierung des Gebietes | 64 |
| VI. Schulsegregation | 65 |
| 1. Herausforderungen der Schulen | 65 |
| 2. Folgen der Schulsegregation | 67 |
| 3. Bedeutung von Schulen in stigmatisierten Gebieten | 69 |
| VII. Zusammenfassung | 70 |
| C. Fragen der urbanen Regierbarkeit | 73 |
| 3. Teil: Entwicklungsleitbild der Nachhaltigkeit | 74 |
| A. Leitbilder der Stadtentwicklung und des Städtebaus | 74 |
| I. Definition "Leitbild" | 74 |
| II. Notwendigkeit von Leitbildern | 75 |
| III. Bedeutung von Leitbildern für die Verwaltungsrechtswissenschaft | 79 |
| IV. Zusammenfassung | 81 |
| B. Entwicklung städtebaulicher Leitbilder seit 1945 | 82 |
| I. Charta von Athen | 83 |
| II. Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt | 84 |
| III. Urbanität durch Dichte | 85 |
| IV. Kompakte Stadt der kurzen Wege | 86 |
| V. Nachhaltige (europäische) Stadt | 87 |
| VI. Zusammenfassung | 87 |
| C. Konzept der nachhaltigen Entwicklung | 88 |
| I. Verankerung des Konzeptes auf völkerrechtlicher Ebene | 89 |
| 1. Brundtland-Bericht 1987 | 89 |
| 2. Rio de Janeiro 1992 | 91 |
| a) Rio-Deklaration über Umwelt und Entwicklung | 93 |
| b) Agenda 21 | 95 |
| 3. Istanbul 1996 (Habitat II) | 98 |
| a) Istanbul-Erklärung | 99 |
| b) Habitat Agenda | 100 |
| 4. Rechtsnatur der Rio-Deklaration und der Habitat Agenda | 102 |
| a) Völkerrechtlicher Vertrag | 102 |
| aa) Rio-Deklaration | 102 |
| bb) Habitat Agenda | 103 |
| b) Akte der Vereinten Nationen | 104 |
| c) Völkergewohnheitsrecht | 105 |
| d) Soft law | 106 |
| 5. Begriff der Nachhaltigkeit | 109 |
| a) Integrativer Nachhaltigkeitsbegriff | 110 |
| b) Enger Nachhaltigkeitsbegriff | 113 |
| c) Verhältnis des weiten und des engen Nachhaltigkeitsbegriffs | 114 |
| d) Normativität des Begriffs der nachhaltigen Entwicklung | 118 |
| 6. Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002 | 124 |
| 7. Vancouver 2006 | 125 |
| II. Verankerung des Konzeptes auf europäischer Ebene | 126 |
| 1. Grundlagen und spatial turn: Neue Herausforderungen für die europäische Raumentwicklung | 126 |
| 2. Recht der Europäischen Union | 128 |
| a) Primärrecht | 128 |
| b) Sekundärrecht | 132 |
| c) Kompetenzen der Europäischen Union auf dem Gebiet des Raumordnungs-, Bau- und Planungsrechts | 132 |
| d) Koordination von Fachpolitiken | 135 |
| e) Strukturpolitik | 138 |
| aa) URBAN | 141 |
| bb) URBACT | 143 |
| cc) Europäische Strukturpolitik in der Förderperiode 2007-2013 | 145 |
| 3. Selbstkoordination der Mitgliedstaaten für eine nachhaltige Stadtentwicklung | 149 |
| a) Entwicklung der europäischen Stadtpolitik "von Potsdam über Lille nach Leipzig" | 150 |
| aa) Europäisches Raumentwicklungskonzept | 150 |
| bb) Lille Priorities | 153 |
| cc) Rotterdam Urban Acquis | 154 |
| dd) Bristol Accord | 155 |
| b) Leipzig Charta und TAEU | 157 |
| aa) Leipzig Charta | 159 |
| (1) Leitbild der Nachhaltigkeit | 162 |
| (2) Notwendigkeit integrierter Handlungskonzepte | 162 |
| (3) Besondere Aufmerksamkeit für benachteiligte Stadtquartiere | 165 |
| bb) TAEU | 168 |
| (1) Anknüpfung an das EUREK | 169 |
| (2) Weiterentwicklungen in der TAEU | 171 |
| III. Verankerung des Konzeptes auf nationaler Ebene | 175 |
| 1. Nachhaltigkeitsprinzip im deutschen Verfassungsrecht | 175 |
| 2. Bauleitplanung und nachhaltige Stadtentwicklung | 177 |
| 3. Urban Governance und nachhaltige Stadtentwicklung | 182 |
| a) Soziale Stadt | 183 |
| aa) Entstehungsgeschichte der Sozialen Stadt | 184 |
| (1) Erste Anstöße auf dem Weg zur Sozialen Stadt | 184 |
| (2) Vorläuferprogramme in Städten und Ländern | 184 |
| (3) Bund-Länder-Programm "Die Soziale Stadt" | 186 |
| bb) Stadtentwicklungspolitische Neuerungen des Programms Soziale Stadt | 187 |
| cc) Regelungsstruktur der Sozialen Stadt | 189 |
| (1) Soziale Stadt als Ausdruck von Urban Governance | 189 |
| (2) Soziale Stadt als Ausdruck des Leitbilds einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung | 192 |
| dd) Vergleichbare Handlungsansätze in anderen europäischen Ländern | 195 |
| b) Private Initiativen zur Stadtentwicklung | 199 |
| aa) § 171f BauGB als Grundlage für die Einrichtung privater Initiativen zur Stadtentwicklung | 200 |
| bb) Übertragbarkeit des BID-Konzeptes | 204 |
| cc) Regelungsstruktur des § 171f BauGB | 206 |
| (1) § 171f BauGB als Ausdruck einer kooperativen Planungsphilosophie | 206 |
| (2) Improvement Districts als Form von Public Private Partnership | 207 |
| (3) Improvement Districts als Form von Urban Governance | 208 |
| c) Stadtumbau | 210 |
| aa) Schrumpfende Städte | 210 |
| bb) Regelungszweck der §§ 171a bis 171d BauGB | 211 |
| cc) Regelungsstruktur | 212 |
| dd) Erfolgsaussichten städtebaulicher Umbaumaßnahmen | 214 |
| IV. Zusammenfassung | 216 |
| 4. Teil: Governance als Instrument zur Steuerung von Urbanisierungsprozessen | 223 |
| A. Genese des Governance-Begriffs | 223 |
| I. Karriere eines Begriffs | 223 |
| II. Governance in den Wirtschaftswissenschaften | 224 |
| III. Governance in der Politikwissenschaft | 226 |
| IV. Terminologie der Weltbank: Good Governance | 228 |
| 1. Konzept der Good Governance | 229 |
| 2. Good Governance in der Europäischen Union | 229 |
| V. Governance-Begriff als interdisziplinärer Brückenbegriff | 231 |
| VI. Zusammenfassung | 233 |
| B. Paradigmenwechsel von Steuerung zu Governance | 234 |
| I. Planung | 234 |
| II. Steuerungstheorie | 236 |
| III. Perspektivenwechsel | 238 |
| 1. Gestaltwandel von Staat und Recht | 239 |
| 2. Aufgabenwandel des Staates | 243 |
| IV. Zusammenfassung | 244 |
| C. Rezeption des Governance-Begriffs in der Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft | 246 |
| I. Weiter Governance-Begriff | 246 |
| II. Enger Governance-Begriff | 249 |
| III. Anschlussfähigkeit des engen Governance-Begriffs an die Staats- und Verwaltungslehre | 252 |
| IV. Verwaltungsrechtsdogmatik | 254 |
| 1. Dynamik der Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft | 254 |
| 2. Staats- und Verwaltungsrechtsdogmatik | 255 |
| 3. Staats- und verwaltungsrechtswissenschaftliche Schlüsselbegriffe | 257 |
| V. Bedingungen der Rezeption des Governance-Begriffs durch die Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft | 260 |
| 1. Rechtswissenschaft als Akteurswissenschaft | 260 |
| 2. Staatliche Akteure in Netzwerken | 262 |
| 3. Interessenkonflikte in Netzwerken | 265 |
| 4. Demokratische Legitimation von Netzstrukturen | 267 |
| a) Demokratieprinzip | 267 |
| aa) Monistisches Demokratieverständnis | 268 |
| bb) Offenes Demokratieverständnis | 271 |
| (1) Wasserverbände Emscher und Lippe | 272 |
| (2) Arbeitsgemeinschaften | 274 |
| (3) Lissabon-Urteil | 275 |
| b) Implikationen für die demokratische Legitimation von Netzstrukturen | 281 |
| VI. Zusammenfassung | 286 |
| D. Mehrwert der Governance-Perspektive | 289 |
| I. Rolle des Gesetzes in der Governance-Perspektive | 290 |
| 1. Rekurs auf die Steuerungstheorie: Das Gesetz als zentrales Steuerungsinstrument | 290 |
| 2. Rolle der Rechtswissenschaft für die Analyse von Governance-Strukturen | 291 |
| II. Begriff der Regelungsstruktur | 293 |
| 1. Wirkungsweise und Funktionslogik von Regelungsstrukturen | 295 |
| a) Struktursteuerung | 295 |
| b) Institutionen | 297 |
| 2. Recht in und als Regelungsstruktur | 298 |
| a) Strukturierungsfunktion | 298 |
| b) Bereitstellungs- und Gestaltungsfunktion | 299 |
| c) Entscheidungs- und wirkungsorientierte Rechtswissenschaft | 301 |
| 3. Grenzen der Übertragung des Governance-Konzepts | 304 |
| III. Regulatory choice-Konzept | 306 |
| 1. Voraussetzungen | 307 |
| 2. Regulatory governance | 309 |
| 3. Organisational choice | 310 |
| 4. Hierarchie als Governance-Struktur: governance by government | 311 |
| a) Hierarchie | 312 |
| b) Schatten der Hierarchie | 313 |
| IV. Zusammenfassung | 315 |
| 5. Teil: Regelungsstrukturen | 320 |
| A. Soziale Stadt | 320 |
| I. Inhalt und Regelungszwecke | 321 |
| 1. Abgrenzung zu anderen Maßnahmen des Baugesetzbuchs | 322 |
| 2. Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt | 325 |
| a) Ortsteile oder andere Gebiete des Gemeindegebiets | 325 |
| b) Soziale Missstände | 326 |
| c) Besonderer Entwicklungsbedarf | 327 |
| d) Gebietskulissen | 328 |
| aa) Innenstädte und innenstadtnahe Gebiete | 329 |
| bb) Verdichtete Wohn- und Mischgebiete | 329 |
| II. Voraussetzungen für Maßnahmen der Sozialen Stadt | 330 |
| 1. Öffentliches Interesse an der einheitlichen und zügigen Durchführung | 330 |
| 2. Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung | 331 |
| 3. Integriertes Entwicklungskonzept | 332 |
| a) Funktion des Entwicklungskonzeptes | 332 |
| b) Notwendigkeit eines integrierten Entwicklungskonzeptes | 334 |
| c) Intensive Bürgerbeteiligung als verpflichtende Ausprägung des bottom up-Ansatzes | 338 |
| aa) Bedeutung der Einbindung der Bürger | 339 |
| bb) Art und Weise der Beteiligung | 341 |
| cc) Probleme der Bürgerbeteiligung | 342 |
| d) Inhalt des Entwicklungskonzeptes | 343 |
| 4. Schulen als Schlüsselinstitutionen für die Bekämpfung von Segregation | 345 |
| a) Probleme des Schulwesens in benachteiligten Stadtteilen | 345 |
| b) Schulsegregation als Herausforderung für den staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag | 347 |
| c) Nachhaltige Ansätze zur Bekämpfung von Schulsegregation | 349 |
| d) Voraussetzungen für erfolgreiche Schulen als Schlüsselinstitutionen | 353 |
| aa) Selbstständigkeit der Schulen | 353 |
| bb) Öffnung der Schulen | 356 |
| e) Fazit: Notwendigkeit der Öffnung der Schulen zur (Sozialen) Stadt | 357 |
| 5. Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes | 359 |
| 6. Stärkung der lokalen Wirtschaft | 360 |
| 7. Durchführung der Maßnahmen der Sozialen Stadt | 364 |
| 8. Einrichtung einer Koordinierungsstelle als Schlüsselelement der Sozialen Stadt | 365 |
| a) Notwendigkeit eines Quartiermanagements | 365 |
| b) Aufgabenprofil des Quartiermanagements | 366 |
| c) Modell des Quartiermanagements | 368 |
| 9. Finanzierung der Maßnahmen | 372 |
| a) Europäische Finanzierungsmittel | 372 |
| aa) Förderung durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) | 373 |
| bb) Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) | 373 |
| b) Nationale Finanzierung | 375 |
| c) Mainstreaming | 377 |
| 10. Städtebauliche Verträge | 378 |
| III. Zusammenfassung | 380 |
| B. Private Initiativen zur Stadtentwicklung | 385 |
| I. Notwendigkeit einer reflektierten Übertragung des Konzeptes auf die Stadtentwicklung | 385 |
| 1. Besonderheiten der Innenstadtentwicklung | 385 |
| 2. Unterschiede zur US-amerikanischen Staats- und Verwaltungskultur | 387 |
| II. Inhalt und Regelungszwecke | 388 |
| 1. Sicherstellung der Gesetzgebungskompetenz | 389 |
| 2. Konturen für private Initiativen zur Stadtentwicklung | 390 |
| 3. Verhältnis zu anderen städtebaulichen Instrumenten | 391 |
| 4. Regelungszwecke | 393 |
| III. Einrichtung eines HIDs oder NIDs | 394 |
| 1. Ziele | 394 |
| a) Kritik und Änderungsbedarf | 394 |
| b) Gebietskulisse | 395 |
| 2. Einrichtung eines HID- oder NID-Gebietes | 397 |
| 3. Aufgaben und Maßnahmen | 398 |
| a) Aufgabenspektrum | 398 |
| b) Konkretisierung der Aufgaben | 399 |
| c) Grenzen des Aufgabenspektrums | 400 |
| aa) Aufgabenfeld Sicherheit | 400 |
| bb) Aufgabenfeld Straßenreinigung | 402 |
| d) Maßnahmen- und Finanzierungskonzept | 404 |
| e) Umsetzung des Konzeptes | 406 |
| f) Einrichtung eines Standort- und Lenkungsausschusses | 407 |
| g) Problematik der Bürgeraktivierung | 409 |
| 4. Abgabenerhebung und Mittelverwendung | 410 |
| 5. Überwachung und Aufsicht | 411 |
| IV. Regelungsstrukturen der Privaten Initiativen zur Stadtentwicklung | 412 |
| 1. Rechtliche Stellung des Aufgabenträgers | 413 |
| a) Aufgabenträgermodell | 413 |
| b) Qualifikation der rechtlichen Stellung des Aufgabenträgers | 414 |
| aa) Tätigkeit als Verwaltungshelfer | 415 |
| bb) Tätigkeit als Beliehener | 416 |
| 2. Vereinbarkeit des Aufgabenträgers mit dem Demokratieprinzip | 417 |
| a) Legitimationsbedürftigkeit der Tätigkeit | 417 |
| aa) Qualifikation der Tätigkeit | 417 |
| bb) Erforderliches Legitimationsniveau | 418 |
| b) Hinreichende demokratische Legitimation des Aufgabenträgers | 419 |
| aa) Sachlich-inhaltliche demokratische Legitimation | 419 |
| bb) Organisatorisch-personelle demokratische Legitimation | 420 |
| (1) Unterstützendes Quorum | 420 |
| (2) Beteiligung an der Konkretisierung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes | 423 |
| (3) Kontrollbefugnisse | 424 |
| 3. Rechtliche Zulässigkeit der Zwangsabgabe | 426 |
| a) Finanzierung einer öffentlichen oder privaten Aufgabe | 426 |
| b) Qualifizierung der Zwangsabgabe | 427 |
| aa) Zwangsabgabe als Steuer | 427 |
| bb) Zwangsabgabe als nichtsteuerliche Abgabe | 428 |
| cc) Zwangsabgabe als Gebühr | 429 |
| dd) Zwangsabgabe als Beitrag | 430 |
| ee) Zwangsabgabe als Sonderabgabe | 433 |
| (1) Besonderer Sachzweck der Erhebung | 434 |
| (2) Homogene Gruppe | 435 |
| (3) Besondere Sach- und Finanzierungsverantwortung der Gruppe | 436 |
| (4) Gruppennützige Verwendung des Abgabenaufkommens | 437 |
| (5) Periodische Legitimation | 438 |
| c) Grundrechtliche Bewertung der Zwangsabgabe | 438 |
| aa) Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG | 438 |
| bb) Art. 2 Abs. 1 GG | 440 |
| cc) Art. 9 Abs. 1 GG | 441 |
| 4. Vergaberecht | 442 |
| a) Anwendbarkeit des Vergaberechts | 443 |
| b) Ausschreibungspflicht der ersten Stufe | 443 |
| aa) Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Vergaberechts | 444 |
| (1) Öffentlicher Auftraggeber | 444 |
| (2) Unternehmen als Aufgabenträger | 444 |
| (3) Vorliegen eines entgeltlichen Vertrages | 445 |
| (a) Qualifikation des Vertrages | 445 |
| (b) Entgeltlichkeit des Vertrages | 446 |
| bb) Ausnahme von der Eröffnung des Anwendungsbereichs des Vergaberechts | 447 |
| (1) Faktische Alternativlosigkeit bei Auswahl des Aufgabenträgers | 447 |
| (2) Vorliegen eines vergaberechtsfreien Inhouse-Geschäfts | 448 |
| (a) Voraussetzungen eines Inhouse-Geschäfts | 448 |
| (b) Übertragbarkeit auf die vorliegende Konstellation | 448 |
| (3) Fehlende Beschaffungsrelevanz | 449 |
| c) Auftragsvergabe durch den privaten Aufgabenträger an Dritte | 451 |
| aa) Aufgabenträger als öffentlicher Auftraggeber nach § 98 Nr. 2 GWB | 451 |
| bb) Aufgabenträger als öffentlicher Auftraggeber nach § 98 Nr. 5 GWB | 453 |
| V. Zusammenfassung | 453 |
| C. Stadtumbau | 458 |
| I. Schrumpfende Städte | 458 |
| II. Inhalt und Regelungszwecke | 459 |
| 1. Abgrenzung zu anderen Maßnahmen des Baugesetzbuchs | 459 |
| 2. Auswahlermessen | 460 |
| III. Regelungsstrukturen | 461 |
| 1. Gebietskulisse | 461 |
| 2. Städtebauliche Funktionsverluste | 461 |
| 3. Öffentliches Interesse | 462 |
| 4. Städtebauliches Entwicklungskonzept | 466 |
| a) Anforderungen | 467 |
| b) Betroffenenbeteiligung | 468 |
| 5. Stadtumbauvertrag | 471 |
| 6. Stadtumbausatzung | 475 |
| 7. Aneignungswettbewerb | 476 |
| 8. Finanzielle Förderung | 478 |
| IV. Stadtumbaumaßnahmen und Eigentumsgarantie | 478 |
| 1. Eigentumsgarantie | 479 |
| 2. Herausforderung für den Gemeinwohlbezug | 479 |
| V. Zusammenfassung | 481 |
| 6. Teil: Fazit und Ausblick | 485 |
| A. Herausforderungen der Stadtentwicklung | 485 |
| B. Leitbild der Nachhaltigkeit | 487 |
| C. Governance in der Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft | 493 |
| D. Regelungsstrukturen | 498 |
| I. Soziale Stadt | 498 |
| II. Improvement Districts | 499 |
| III. Stadtumbau | 501 |
| E. Ausblick | 504 |
| Literaturverzeichnis | 506 |
| Sachwortverzeichnis | 547 |