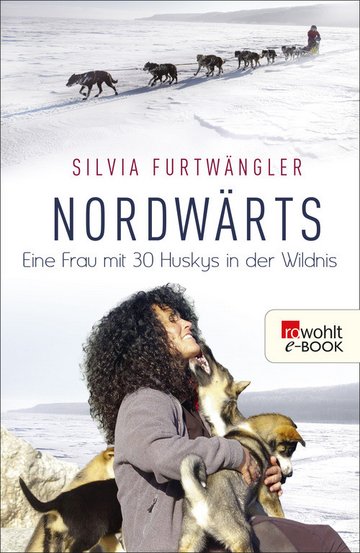Ein Amundsen-Koller und ein Hochebenenrausch
«Du darfst ihn mitnehmen.»
Eine Frau, die ich nur flüchtig kannte, bot es mir an. Da lag er, der Kompass von Roald Amundsen. In einer Vitrine, in einem Haus in Mogen.
«Das kann ich nicht, der ist viel zu kostbar.»
«Doch, nimm ihn ruhig mit, nach zwei, drei Tagen gibst du ihn zurück.»
Zögernd griff ich zu dem Kompass, betrachtete ihn lange, voller Ehrfurcht, steckte ihn dann sorgsam, in einen Schal gewickelt, in meinen Rucksack ein. In diesem Moment fühlte ich mich als Teil seiner Geschichte. In den nächsten Tagen streichelte ich ihn mehrmals wie einen meiner Hunde. Ich konnte mein Glück nicht fassen. Ich darf diesen Kompass in meinen Händen halten! Wem ist das schon gegönnt? Vielleicht war es kindisch, aber ich wollte gern kindisch sein. Wenigstens in diesem Moment.
Eines Tages hatte ich mich auf die Spuren von Roald Amundsen begeben, dem norwegischen Abenteurer – und am Ende wanderte ich mit Mann und Sohn in die Wildnis aus.
Natürlich wollte ich nicht wie Amundsen zum Nord- oder Südpol reisen, aber es konnte doch interessant sein, so dachte ich, dort mit meinen Hunden entlangzufahren, wo er sich für seine Südpolexpedition vorbereitet hatte: in der Hardangervidda in Norwegen. Die Hardangervidda ist Europas größte Hochebene mit einer Fläche von ungefähr achttausend Quadratkilometern. Sie ist ein Nationalpark, von Menschen wenig berührt, mit vielen felsigen Ebenen, Geröllfeldern, dunklen Seen und sanften Anhöhen aus der Gletscherzeit. Die größte wilde Rentierherde ist hier zu Hause, und es sind wirklich freilebende Tiere, sie haben keine Markierung im Ohr, keinen Knopf, der sie einem bestimmten Besitzer zuweist, wie es sonst bei Rentieren der Fall ist.
Die Hardangervidda war vom Bayerischen Wald aus, wo ich damals wohnte, nicht so weit, das schien machbar zu sein. Amundsen selbst hatte dort 1893, gerade zwanzig geworden, seinen ersten Versuch unternommen, die Hochebene auf Skiern und mit einem Rucksack auf dem Rücken zu bewältigen. Ein Schneesturm hatte das Vorhaben schließlich scheitern lassen, aber es war nicht vergessen, und drei Jahre später hatte er mehr Glück. Zusammen mit seinem Bruder Leon startete er ein weiteres Training, dieses Mal mit Huskys – Hunden, die auch ich besaß.
Die Briten hatten bei ihren Polexpeditionen als Erste Huskys eingesetzt, doch ohne Erfolg. Dann versuchte es der in Devonport geborene Robert Falcon Scott, Marineoffizier und Polarforscher und setzte sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts vergeblich bei seinen Antarktis-Expeditionen ein, was Roald Amundsen, Erzrivale von Scott, zu der Bemerkung veranlasste: «Entweder müssen die Engländer schlechte Hunde gehabt oder nicht verstanden haben, mit ihnen umzugehen.» Als Scott nämlich in der Antarktis ankam, waren viele der Hunde krank und weigerten sich, das mitgenommene Futter zu fressen: verdorbenen Stockfisch. Ebenfalls von Belang war wohl, was ich aus Erfahrung bestätigen kann: Schlittenhunde brauchen Kommandos – und Scott soll da nicht richtig durchgegriffen haben. Als Alpharüde versagte er vollends, sodass am Ende er und seine Leute die Schlitten selbst ziehen mussten. Die Huskys trotteten nebenher oder saßen sogar auf den Schlitten und ließen sich ziehen. Das sollte auch nur einer meiner Hunde versuchen! Bei Amundsen hatten die Schlittenzieher es übrigens auch nicht versucht. Seine Südpol-Expedition gelang nur deshalb so gut, weil er wusste, wie die Hunde im Geschirr zu führen waren. Er litt auch nicht unter dem Bellen der Tiere, da war Scott doch sehr viel empfindsamer.
Ein guter Anlass für meine Tour war der achtzigste Todestag des norwegischen Bezwingers beider Pole, der von 1872 bis 1928 gelebt hatte. Jetzt war Frühling 2008, und bei Wintereinbruch konnte ich doch eine kleine Gedenktour an diesen großen Expeditionsleiter machen. Amundsen, Scott, Jack London, Ernest Shackleton und all die anderen Abenteurer hatten mich seit jeher fasziniert. Sie waren über ihre eigenen Grenzen gegangen, das war es, warum sie für mich so wichtig waren. Ich hatte das sehr bestimmte Gefühl, sie hätten mich verstanden, wenn ich über meine ging – was man bei meinen Mitmenschen im Bayerischen Wald, abgesehen von meiner Familie, nicht unbedingt behaupten konnte.
Amundsen war kein unumstrittener Mensch gewesen. Er galt als widersprüchlicher Charakter, ausgestattet mit einem enormen Selbstbewusstsein, der viel Anerkennung brauchte und Kritik nicht gut vertragen konnte. Sein Führungsstil war autoritär, von seiner Mannschaft verlangte er unbedingten Gehorsam, wer sich ihm widersetzte, wurde aus dem Team geschmissen. Mit einem ähnlichen Verhalten geriet auch Reinhold Messner ins Kreuzfeuer, als sein Bruder Günther bei einer Expedition am Nanga Parbat, an der höchsten Eiswand der Erde, starb. Reinhold Messner war allein zum Gipfel aufgebrochen, sein jüngerer Bruder folgte ihm. Später warf man dem Überlebenden vor, das Leben des Bruders aufs Spiel gesetzt zu haben, um den Nanga Parbat zu überschreiten. Bei den Bezichtigungen ging es um «Tyrannei», «Männerspiele» oder «Imponiergehabe». Wie dem auch sei, nur Reinhold Messner war in der Nähe seines Bruders gewesen.
Doch zweifellos ist: Wer Erfolg haben will, wer auf eine Idee fixiert ist und Widerstände überwinden will, kann sich nicht nur als einfühlsamer und höflicher Mensch zeigen – was nicht bedeutet, dass ich es gutheiße, andere absichtlich in Gefahr zu bringen. Aber um eine Gruppe zu führen, eine Expedition zu leiten, Menschen so weit zu mobilisieren, dass sie über sich hinausgehen, sind einige «unangenehme» Eigenschaften notwendig. Ich hätte die von Amundsen gern in Kauf genommen, wäre gern in seinem Team gewesen, hätte mich mit diesem eigenwilligen Abenteurer auseinandersetzen wollen. Auch mit all den anderen, den Jack Londons, den Robert Falcon Scotts. Sie schienen etwas zu haben, etwas, das auch ich in mir trug – ein ganz spezielles Expeditions-Gen. Nun konnte ich ihrem Willen nur noch nachspüren.
Als die beiden Amundsen-Brüder die Hardangervidda im Dezember 1896 durchquerten, so las ich in einem Buch, wurden sie nachts von einem abermaligen Schneesturm überrascht, einem jener plötzlich auftretenden Stürme, die ich inzwischen selbst kennengelernt hatte. Beide wurden komplett eingeschneit, von Roald soll man nur seine Füße gesehen haben. Sein Bruder Leon konnte sich, nachdem er wach geworden war, zuerst aus den gigantischen Schneemassen befreien, danach buddelte er Roald aus. Ohne diese Tat hätte es Amundsens Südpolar-Expedition wohl nie gegeben. Der Schneesturm hielt anscheinend an, Genaueres weiß man darüber aber nicht. Es ist auch nicht dokumentiert, ob Roald und Leon danach durch die Hardangervidda herumgeirrt, ob sie im Kreis gelaufen sind oder ob sie sie tatsächlich, wie geplant, durchquert haben. Fest steht nur: Irgendwann fand sie ein Farmer und führte sie zu seinem Haus in Mogen, wo man ihnen zu essen und trinken gab, auch neue Kleider. Als Dank erhielten die helfenden Leute von den Amundsen-Brüdern einen Kompass.
Je mehr ich mich informierte, umso mehr dachte ich, dass die Hardangervidda ein Gebiet ganz nach meinem Geschmack sein musste. Schließlich stand meine Entscheidung fest: Ich wollte die Tour so mit meinen Hunden nachgehen, wie sie von den Abenteurer-Brüdern geplant worden war. Als ich anfing, von meinem Plan zu erzählen, drückte ich das sehr vorsichtig aus, denn ich ahnte, man könnte mich missverstehen: «Da kommt eine Deutsche und will das machen, was Amundsen angeblich nicht geschafft hat.» Insbesondere gegenüber Norwegern musste ich sehr vorsichtig sein, denn niemand durfte das Geringste gegen ihren Nationalhelden vorbringen. Deshalb sagte ich, wenn ich nach meiner Motivation für dieses Unternehmen gefragt wurde: «Ich will seinen Spuren folgen, um auf seine Leistung aufmerksam zu machen. Bei dieser Vorbereitung wäre er fast ums Leben gekommen. Kaum einer weiß davon, über diese Tour ist nur sehr wenig bekannt.» Das beruhigte möglicherweise in Unruhe versetzte Gemüter, und es hieß dann auch: «Ah, das ist toll, das muss endlich mal ans Tageslicht kommen.» In den norwegischen Medien wurde meine Miniexpedition in vielen Artikeln thematisiert.
Acht Hunde und einen Schlitten nahm ich mit, meine Basis war das Hotel Skinnarbu in der Nähe von Rjukan, eine schöne, auf einer kleinen Anhöhe einsam gelegene Anlage, mit weißen Sprossenfenstern, schlichten, schönen Zimmern, viel Holz und mit einer Schneehaube auf dem Dach. Rjukan selbst ist ein Ort mit 3500 Einwohnern, er liegt unten in einem Tal, Einheimische sprechen vom «tiefsten Loch der Erde». Sieben Monate, von September bis März, gibt es hier keine Sonne – und seit über hundert Jahren existierte die Idee, Sonnenlicht ins Tal zu reflektieren. 2013 wurde das scheinbar Unmögliche wahr: Drei Spiegel, Heliostaten, jeweils rund siebzehn Quadratmeter groß, werden seither per Computer so gesteuert, dass sie dem Sonnenlicht folgen und es in die Ortschaft reflektieren. Die Lichtellipse ist jedoch nicht sehr groß, nur fünf mal fünf Meter.
2008 aber gab es diese technische Neuerung noch nicht. Da fuhr ich vom Tal aus eine Passstraße hoch – und ein Bergpanorama lag vor mir, darüber ein strahlend blauer Himmel. Einfach grandios. So ein Empfang! Ich war völlig hin und weg. In diesem Moment konnte ich mir nichts Schöneres vorstellen.
Der Hotelmanager, Magnus Rybak, drahtig, anpackend, mit einem Bartansatz und perlweißen, kräftigen Zähnen, riet mir, mich bei der örtlichen Polizei zu melden, was ich dann auch tat.
«Wir haben von...