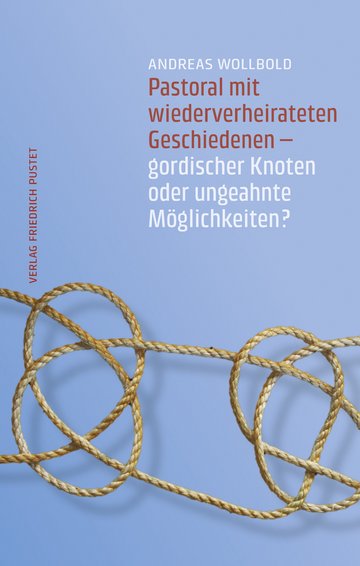1. KLÄRUNG DER FRAGESTELLUNG
„Ich weiß wohl, die Frage der Ehe ist äußerst dunkel und komplex. Und ich wage nicht die Behauptung, in diesem oder in einem anderen Buch all ihre fraglichen Aspekte geklärt zu haben oder es überhaupt zu vermögen, wenn ich dazu gedrängt würde“, so erklärt der hl. Augustinus in seinem Standardwerk zu unserer Frage, „De coniugiis adulterinis (Die ehebrecherischen Verbindungen)“ (Coni. adult. 1,25,32 [CSEL 41,379], vgl. Retractationes 2,57 [CCL 57,136]). Das Problem stellt für ihn eine „äußerst schwierige Frage (difficillima quaestio)“ dar (Retractationes 2,57 [CCL 57,136]). In der Tat kommt darin eine Vielzahl von Aspekten und Argumenten zusammen, und gleichzeitig handelt es sich um eine für die Betroffenen wichtige, ja heilsentscheidende Frage. Nach keiner Seite hin darf also die hohe Komplexität des Problems vereinfacht werden, weder um die Probleme zu verdrängen, noch um den Wiederverheirateten „entgegenzukommen“.
Eine überaus schwierige Frage erfordert vielmehr große Sorgfalt in der Gedankenführung. Ungewissheiten auszuhalten, Argumente nicht auf ungesicherte Indizien und bloße Hypothesen zu stützen, Gegenargumente genügend zu gewichten anstatt sie zu ignorieren, einem Parteiengeist und einer willkürlichen Auswahl genehmer Literatur zu widerstehen, das verlangt ein hohes wissenschaftliches Ethos und nicht zuletzt ein großes Maß an Bescheidenheit, ja Demut – Tugenden, die zumeist nicht gerade zu den typischen Berufskrankheiten von Forschern und Professoren gehören. Kurz, eine schwierige Frage, verbunden mit dem starken Interesse an einer Lösung: Diese Konstellation führt fast zwangsläufig zur Versuchung, den gordischen Knoten zu zerschlagen (gleich ob mit der rechten oder der linken Hand!), damit jedoch der Komplexität der Frage Gewalt anzutun. Listen wir darum vorweg sieben Gefahrenzonen auf, in die sich die Diskussion beinahe zwangsläufig begibt, aus denen sie dann aber kaum mehr herausfindet.
1. Aus einzelnen Worten oder Vorgehensweisen der Kirchen- und Theologiegeschichte ein allgemeines Gesetz ableiten: Es wäre ein naives Bild der Lehrentwicklung der Kirche, wollte man von Anfang an eine vollkommene Klarheit und Eindeutigkeit des historischen Befundes erwarten. Eher gleicht sie einem Tasten und Suchen, das erst nach und nach zu einer definitiven Ordnung gelangt. Zwar lassen sich grundlegende Einsichten bis zum Anfang zurückverfolgen, doch deren Konsequenzen für die Kirchenordnung bedurften in der Regel eines Weges von Jahrhunderten. So wird man aus der Frühzeit des Christentums einzelne Worte kirchlicher Schriftsteller oder Belege für Verhaltensweisen finden, die von der späteren Lehre und Praxis abzuweichen scheinen. Es wäre aber methodisch nicht zulässig, diese als Anzeichen für eine generell abweichende frühkirchliche Tradition zu interpretieren. Es handelt sich vielmehr um Zeugnisse der frühen Dogmenentwicklung, und zwar, wie noch zu zeigen sein wird, angesichts einer ihr diametral entgegenstehenden kulturellen Umwelt in der Spätantike. Das gilt noch einmal mehr von solchen Belegen, die ohne tiefere Reflexion und eher beiläufig eine damals existierende Meinung oder Praxis bloß erwähnen. Und es gilt schließlich am meisten von solchen Stellen, deren Interpretation selbst vieldeutig ist und historisch und philologisch redlicherweise kaum gesichert angegeben werden kann.
2. Die von der späteren Lehre und Praxis abweichenden Belege stärker gewichten als die sie bestätigenden: Gelegentlich trifft man auf ein eigenartiges Verständnis historischer Theologie, so als wüchse deren wissenschaftlicher Charakter in dem Maß, wie sie lehr- und kirchenkritisch auftritt. Der ansonsten von großem Gleichmut geprägte Jesuit Henri Crouzel, einer der wichtigsten Forscher zu Ehe, Ehescheidung und Jungfräulichkeit bei den Kirchenvätern, bricht einmal in die verständliche Klage aus: „Man macht es sich einfach: Wenn die Schlussfolgerungen eines Historikers das bestätigen, was als rechtgläubig gilt, dann disqualifiziert man ihn dadurch, dass man ihn als Apologeten etikettiert. Bewegen sich seine Schlussfolgerungen aber in die entgegengesetzte Richtung, dann sind sie natürlich das Ergebnis ,objektiver Forschung‘. Können sie nicht genauso gut eine Apologie sein, nur im entgegengesetzten Sinn?“ (Crouzel 1974a, 190, Anm. 5). Gerade wenn man, wie im vorangegangenen Punkt unterstrichen, davon ausgeht, dass ein vielfältiger und im Detail sogar widersprüchlich erscheinender biblischer oder patristischer Befund nicht die kirchliche Tradition als solche in Frage stellt, kann man in großer Gelassenheit und allein an wissenschaftlicher Objektivität orientiert historische Forschung betreiben. An verschiedenen Stellen wird sich in unserer Thematik tatsächlich zeigen, dass der Befund uneindeutig ist und man in wichtigen Punkten allenfalls Hypothesen formulieren kann.
3. Parteinahme zur Parteilichkeit werden lassen: Es ist selbstverständlich legitim, sich als Anwalt der Interessen Wiederverheirateter in die Diskussion einzumischen. Nicht selten stehen Theologen dabei Einzelschicksale aus Verwandtschaft und Bekanntschaft oder aus der Seelsorge vor Augen. Die hohe Emotionalität der Frage lässt noch leidenschaftlicher Partei ergreifen. All das kann einen Theologen zur Beschäftigung mit der Frage treiben. Ihm jedoch bei ihrer Lösung die Feder führen darf die Parteinahme nicht. Er darf nicht schon wissen, was dabei herauskommen muss. Genau diesen Eindruck gewinnt man jedoch selbst bei einer oberflächlichen Lektüre eines Teils der einschlägigen Literatur gleich welcher Grundeinstellung. So leitet Theodor Schneider einen einflussreichen Sammelband zur Antwort auf die Äußerung der Glaubenskongregation von 1994 mit Worten ein, die suggerieren, die Theologie habe zuverlässige Ergebnisse hervorgebracht, nur das Amt verweigere sich, entsprechende Konsequenzen zu ziehen: „Die theologische Auseinandersetzung der beiden letzten Jahrzehnte erinnert an das Bild schwitzender Läufer in ausdauernder und kräftezehrender Bewegung auf einem Band, das in Gegenrichtung rollt: Training ohne jeglichen Raumgewinn! Gewiß, ein solcher Vergleich ist dem Ernst der Lage kaum angemessen. Vor allem die Verletzungen und Bedrängnisse der Betroffenen verbieten eine leichtfertige Rede. Aber es ist wirklich nicht ganz einfach, hier der Versuchung zu bitterer Ironie zu widerstehen“ (Schneider 1995, 7). Leider belegt der Sammelband aber in seinen Schlüsselbeiträgen etwa zum Befund des Neuen Testamentes, zum Konzil von Trient oder zu moraltheologischen Fragen, dass diese angeblich so zuverlässigen Ergebnisse nur dadurch erzeugt werden, dass Hypothesen als Gewissheiten deklariert werden und kritische Literatur weitgehend undiskutiert bleibt oder rasch abgefertigt in die Fußnoten verschwindet. Also im Bild gesprochen: Der Läufer reißt die Arme hoch und ruft „Sieg!“, aber auf der Strecke geblieben sind seine Mitbewerber, weil er sie in den Graben gedrängt hat. Theologie leistet den Betroffenen aber den besten Dienst, wenn sie die Komplexität der Fragen aufzeigt und nicht reduziert. Das hat zur Folge, dass sie nicht bloß naheliegende Lösungen propagiert, sondern geduldig nach Wegen sucht, die auf Dauer vor der kirchlichen Tradition Bestand haben können.
4. Die Priorität der bestehenden Lehre und Praxis der Kirche nicht beachten: Selbstverständlich kennt die katholische Kirche die Entwicklung ihrer Lehre und ihrer Disziplin. Diese kann jedoch nur am Ende einer Diskussion stehen, die zu einer ausreichenden und vom Lehramt bestätigten Gewissheit gekommen ist. Den Grund dafür gibt Joseph Ratzinger an: „Auf alle Fälle kann die Kirche ihre Lehre und Praxis nicht auf unsichere exegetische Hypothesen aufbauen. Sie hat sich an die eindeutige Lehre Christi zu halten“ (Ratzinger 1998, 22). Denn bei der Ehe ist das Offenbarungsgut selbst und die von Gott gegebene sakramentale Ordnung der Kirche (im Sinn des ius divinum, des gottgesetzten Rechtes) berührt. Was würde man etwa von einer Dogmatisierung der Miterlöserschaft Mariens halten, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der Theologie erhebliche Einwände dagegen vorbringen kann? Bis zu einer solchen lehramtlich rezipierten Gewissheit gilt (natürlich entsprechend den theologischen Gewissheitsgraden) die tradierte Lehre in ihrer herkömmlichen Auffassung als verbindlich. Solange also die Forschung nicht zu eindeutigen Ergebnissen etwa bezüglich der theologischen Bedeutung der Unzuchtsklauseln bei Matthäus oder einschlägiger patristischer Stellen gekommen ist, darf die Kirche nicht von ihrer Position abrücken. Was in der theologischen Diskussion vielleicht für möglich erachtet wird, reicht zu einem Neuverständnis des kirchlichen Glaubens und der darauf gründenden Kirchenordnung nicht aus. Dieser Vorbehalt ist bei nicht wenigen Beiträgen zu unserer Frage in Vergessenheit geraten: Was etwa exegetisch oder patristisch für möglich gehalten wird, soll auch dem kirchlichen Amt die Türen zu einer Liberalisierung von Lehre und Praxis öffnen.
5. Die Unauflöslichkeit der Ehe betonen, aber Lösungen vorschlagen, die in der öffentlichen Meinung den gegenteiligen Eindruck hervorrufen würden: Die meisten Stellungnahmen aus dem katholischen Raum betonen, dass sie nach wie vor an der Unauflöslichkeit der Ehe festhalten und nur auf die leidvolle Situation von nach Scheidung in zweiter Ehe Lebenden reagieren. Ein solcher Weg scheint inzwischen auch vielen Oberhirten gangbar zu sein, weil sie hoffen, damit die Treue zur kirchlichen Lehre mit einer liberalen oder doch liberaleren Praxis verbinden zu können. Vielleicht spielt dabei auch der große Einfluss des christlichen Existenzialismus und Personalismus im theologischen Denken der...