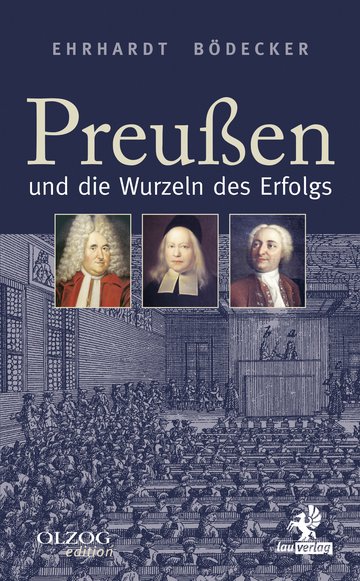II.
Preußen und die historischen Mythen
Preußen und die historischen Mythen
Sowohl das Kriegsbündnis der USA mit der marxistischen Sowjetunion als auch die kommunistisch gesinnte Umgebung des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt (1933–1945) führten dazu, daß marxistische Theorien schon während des Krieges und unmittelbar danach die westliche Antipreußen-Propaganda beherrschten. Fast 60 Jahre nach Kriegsende sind sie noch wirksam, sogar unter Historikern, die ihre Nähe zum Marxismus leugnen.
Die westliche Methode der sozialpsychologischen Umerziehung hat die Sowjetunion nicht übernommen, sondern den Deutschen in der DDR ein marxistisches Umdenken „verordnet“. Es wurden Glaubenssätze gegen Preußen aufgestellt, die den Ideen von Karl Marx entstammten. Begriffe und Behauptungen wie Bourgeoisie, Kapitalismus folgt dem Militarismus, Unterdrückung, Ausbeutung, Kadavergehorsam, autoritäre Verformung des Staates, soziale Ungerechtigkeit, Obrigkeitsstaat und böse Junker wurden zu abstoßenden marxistisch-sozialistischen Gedankenbildern, die dem offiziellen Preußenbild in der DDR zugrunde gelegt wurden.
Inhaltlich unterschieden sich die Analysen westdeutscher Historiker von denen ihrer Kollegen aus der ehemaligen DDR nur unmerklich. Im Gegensatz zur DDR, wo aus der marxistischen Quelle der Geschichtsdeutung kein Hehl gemacht wurde, umgaben sich Geschichtsschreiber der Bundesrepublik Deutschland mit dem Mantel einer objektiven, der Besonnenheit, Freiheit und Menschlichkeit verpflichteten Wissenschaft. Trotzdem konnten auch sie dem jahrhundertealten Dilemma der persönlichen Färbung und Verzerrung von Geschichtserzählung nicht entgehen. Sebastian Haffner schloß daraus, daß es keine Geschichtswissenschaft gäbe, sondern nur eine Deutungskunst.
Jedes Geschichtswerk hängt nicht nur von zeitbedingten Einflüssen, sondern auch von der persönlichen Sicht des Autors ab. Berichte über die Vergangenheit sind daher ebenso subjektiv und parteilich wie Berichte über Personen und Ereignisse der Gegenwart. Kein Geschichtswerk kann dieser Schwäche entgehen. Eine weitere Einschränkung der Verläßlichkeit von historischen Darstellungen sind die Motive der Autoren, die entweder von Verständnis und Zuneigung oder von Anklage und Ablehnung geleitet werden. Letzten Endes fehlen vielen Historikern, worauf der junge Historiker Eckart Kehr schon in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hingewiesen hat, wirtschaftliche Erfahrungen, um Gesamtzusammenhänge beurteilen zu können. Dieses Urteil trifft auf den Großteil der Gesamtdarstellungen preußisch-deutscher Geschichte der letzten Jahrzehnte zu. Es sei nach Gerhard A. Ritter auch ein Mangel, daß deutsche Historiker nicht gelernt hätten, Statistiken zu lesen und auszuwerten. Der Interpretationsstreit in den achtziger Jahren über die deutsche Geschichte, der mit „Historikerstreit“ etikettiert wurde, zeigte trotz der wortreich vorgetragenen Meinungen ebenfalls eine deutliche Ignoranz der beteiligten Diskutanten gegenüber den wirtschaftlichen Nöten, Zwängen und Leistungen des Deutschen Kaiserreichs.
Nach Professor Dr. Friedrich List, dem Vordenker der europäischen Wirtschaftseinheit und des Deutschen Zollvereins (1834), ist nichts natürlicher als daß Historiker, die bloß ihre Vorgänger oder andere Autoren abschrieben und all ihr Wissen aus Büchern geschöpft hätten, höchst beunruhigt und verblüfft sind, wenn ihnen lebendige, ihrem Schulwissen widerstreitende Erfahrungen und ganz neue Ideen gegenübertreten. Diese Verblüffung trat 1980 offensichtlich bei den „politisch korrekten“ deutschen Historikern ein, als die beiden jungen englischen Historiker David Blackbourn und Geoff Eley ihr im Verlag Ullstein erschienenes Büchlein über die Mythen deutscher Geschichtsschreibung veröffentlichten. Hierin warfen sie ihren deutschen Kollegen Unkenntnis der englischen Geschichte vor und eine falsche Interpretation der Lebensumstände im Deutschen Kaiserreich von 1871–1914. Sie bezweifelten die Berechtigung, die englischen Verhältnisse als vorbildhaft und nachahmenswert für die deutsche Politik hinzustellen. An vielen Beispielen weisen sie nach, daß in dieser Zeit in Deutschland nicht von einer Feudalisierung des Lebens, sondern von seiner Verbürgerlichung gesprochen werden muß. Sie haben Recht. Deutschland hatte die modernste und fortschrittlichste Verfassung eines Industrie- und Wirtschaftsstaats des 19. und 20. Jahrhunderts. Um das beurteilen zu können, muß man allerdings einen Standort wählen, der einen ungetrübten, das heißt einen ideologiefreien Blick ermöglicht.
Die Bundesrepublik Deutschland bleibt für viele Historiker die Erfüllung aller historisch erhofften und erstrebten Wünsche. Hieraus leiten sie das Recht ab, Preußen, das Deutsche Kaiserreich und seine Zustände als unmodern und autoritär zu verurteilen. Es mutet schon recht eigentümlich an, über das Kaiserreich als einen unmodernen Staat in einer Zeit zu sprechen, in dem sich die politische Klasse der Bundesrepublik Deutschland als unwillig erwiesen hat, die notwendigen Strukturen für die Anpassung der deutschen Wirtschaft an Globalisierung und Industrialisierung vorzunehmen.
Warum fragen sich Politiker nicht, was die Gegenwart aus den außergewöhnlichen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erfolgen der damaligen Zeit lernen kann? Auf solche Fragen lägen viele Antworten bereit.
Behaupten und wiederholen sind die Mittel zur Beeinflussung von Menschen. Man sollte nicht versuchen, Tatsachen oder Beweise vorzutragen. An Beweisen sind Menschen nicht interessiert. So lauten die einfachen Propagandaregeln des französischen Arztes Gustave Le Bon (1841–1931) in seinem weltberühmten, im Jahre 1895 erschienenen Buch „Die Psychologie der Massen“. Als besonders wirksam erweisen sich Behauptungen und Wiederholungen, aber auch als höchst fragwürdig, wenn sie unter dem Mantel der Wissenschaftlichkeit vorgetragen werden. Die These von dem unmittelbaren Zusammenhang der Strukturen des Deutschen Kaiserreichs mit dem Nationalsozialismus beruht auf solchen willkürlichen Behauptungen und Spekulationen, nicht auf Analysen, schon gar nicht auf Beweisen.
So mischten sich der Vorwurf der Kollektivschuld, das Verbot der Erinnerung (damnatio memoriae), der Glaube an die Kontinuität und die Kausalität, die These vom Sonderweg der deutschen Geschichte, die Wiederbelebung der Behauptung von der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands am Ersten Weltkrieg und endlich das Bekenntnis zu den in der deutschen Nation traditionell angelegten Charaktereigenschaften wie Militarismus, Rassismus, Gewalttätigkeit und Autoritätsgläubigkeit zu einem unentwirrbaren Knäuel von Verdächtigungen, von abstrusen historischen Mythen und politischen Phrasen. Sie richten sich gegen die Deutschen ganz allgemein sowie gegen ihre kulturellen Überlieferungen und ihr traditionelles Denken.
Es sind abwegige Vorstellungen, wenn Politiker und Historiker die Überzeugung haben sollten, mit einer abstoßenden Schilderung deutscher Geschichte bei der deutschen Bevölkerung Toleranz und demokratische Gesinnung hervorrufen zu können. Noch paradoxer wird diese Haltung, wenn umgekehrt in einer anerkennenden Bewertung der preußisch-deutschen Geschichte eine antidemokratische, vielleicht sogar eine unannehmbare rechtslastige Gesinnung vermutet wird. Ahnenkult, die Erinnerung an die Vergangenheit und eine bewußte, gelegentlich sogar verklärende Hinwendung zu den Vorfahren sind wesentliche Elemente menschlichen Zusammenlebens. Hierin unterscheiden sich weder Rassen noch Religionen. Zwar hat sich als Folge der Zunahme von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen das Verhalten zur Vergangenheit und zu den Toten verändert, aber unabhängig davon bleiben auch bei den modernen Völkern die Vorfahren und ihre Toten der Stoff, aus dem nicht nur Selbstbewußtsein, sondern auch die eigene Versicherung der Zusammengehörigkeit erwächst. Für uns Europäer sind die ägyptischen Pyramiden das hervorstechende Wahrzeichen für den „Blick zurück“. Überall dort, wo die Menschen zu schreiben und zu lesen verstanden und sich Literatur entwickelte, wurde die Vergangenheit angenommen und literarisch verarbeitet, vielfach mit anerkennenden und pädagogischen Absichten. Stellvertretend für viele andere Autoren sei erinnert an den Griechen Homer mit der Ilias und der Odyssee, an den ebenfalls in Griechenland beheimateten Thukydides (460–400 v. Chr.) und an den Römer Cornelius Tacitus (um 55–nach 115 n. Chr.) Tacitus hielt sich im großen und ganzen an sein Versprechen „sine ira et studio“ zu berichten. Mit seiner Schilderung von den Germanen „De origine et situ Germanorum“ verfolgte er nicht nur berichtende, sondern im Blick auf den Verfall des Römischen Reiches auch belehrende Absichten. Immer bedeutete aber Geschichtsschreibung zuvörderst, über Ereignisse zu berichten. Geschichtsschreiber wollten beschreiben, Ereignisse schildern, die überliefert oder von ihnen selbst erlebt worden sind.
Anfang des 19. Jahrhunderts forderten Barthold Georg...