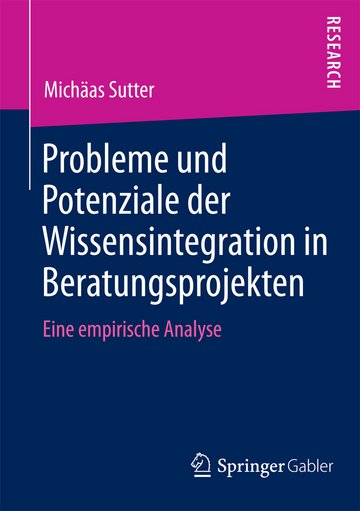| Geleitwort | 5 |
| Vorwort | 7 |
| Inhalt | 9 |
| Abbildungs- und Tabellenverzeichnis | 12 |
| 1. Einleitung | 13 |
| Ausgangspunkt der Arbeit | 13 |
| Ziele, Herangehensweise, Limitationen und Aufbau der Arbeit | 17 |
| 2. Interorganisationales Lernen | 20 |
| 2.1 Interorganisationales Lernen – Skizze des Forschungsfeldes und Entwicklung einer Arbeitsdefinition | 20 |
| 2.2 Ebenen und Prozesse interorganisationalen Lernens | 22 |
| 3. Unternehmensberatung als Untersuchungsgegenstand | 25 |
| 3.1 Unternehmensberatung – Ein unübersichtliches Terrain | 25 |
| 3.2 Beratungsprojekte – Koproduktionen von Beratern und Klienten? Eine Frage nach den Funktionen der Unternehmensberatung | 30 |
| 3.2.1 Wissenstransfer | 30 |
| 3.2.2 Weitere Funktionen von Unternehmensberatung | 38 |
| 3.3 Entsteht in Beratungsprojekten neues Wissen? | 40 |
| 3.3.1 Innovationen – Motor für organisationales Lernen | 41 |
| 3.3.2 Ist in Beratungsprojekten interorganisationales Lernen notwendig? | 43 |
| 3.4 Was wissen Berater? | 46 |
| 3.4.1 Wenden Berater wissenschaftliches Wissen an? | 46 |
| 3.4.2 Besitzen Berater Wissen um „best practices“? | 49 |
| 3.4.3 Gegenstand von Beratungswissen | 52 |
| 3.4.4 Zunehmende Spezialisierungsanforderungen an Beraterwissen | 57 |
| 4. Von lokalen Rationalitäten in Organisationen zu interorganisationalen Kommunikationsbarrieren in Beratungsprojekten – Problem (inter)-organisationaler Wissensintegration und Ansätze zum Umgang damit | 60 |
| 4.1 Die begrenzte kognitive Kapazität des Menschen: Spezialisierung als Antwort auf Komplexität | 61 |
| 4.2 Die Integration spezialisierten Wissens – Zwei Perspektiven | 64 |
| 4.2.1 Die Cross-Learning-Perspektive – Geteilte Bezugsrahmen als Voraussetzung für Wissensintegration | 65 |
| 4.2.2 Die Spezialisierungsperspektive: Das TOL-Modell – Lernen bei begrenzter Rationalität | 101 |
| 5. Herleitung der Fragestellungen der Untersuchung | 124 |
| 6. Methodik der empirischen Untersuchung | 132 |
| 6.1 Qualitative Forschung als Untersuchungsansatz | 132 |
| 6.2 Auswahl der Fälle | 135 |
| 6.3 Datenerhebung, Erhebungsinstrumente und Datenauswertung | 140 |
| 7. Ergebnisse der empirischen Untersuchung | 144 |
| 7.1 Wissenstransfer zur Herstellung gemeinsamer Bezugsrahmen | 144 |
| 7.1.1 Zusammenfassung | 149 |
| 7.2 Wissenslokalisierung | 150 |
| 7.2.1 Wissenslokalisierung im Rahmen des „Staffings“ | 150 |
| 7.2.2 Wissenslokalisierung im laufenden Projekt | 152 |
| 7.2.3 Zusammenfassung | 156 |
| 7.3 Wissensgenerierung | 157 |
| 7.3.1 Modularisierung als Grundlage der Wissensintegration | 157 |
| 7.3.2 Prototyping als Mechanismus der Wissensintegration | 161 |
| 7.3.3 Zusammenfassung | 179 |
| 7.4 Wissenstransfer zum Aufbau von Common Knowledge | 181 |
| 7.4.1 Gemeinsames Projektverständnis | 181 |
| 7.4.2 Gemeinsames Schnittstellenwissen | 183 |
| 7.4.3 Gemeinsame Sprache | 184 |
| 7.4.4 Mechanismus des Wissenstransfers | 186 |
| 7.4.5 Die Bedeutung von Artefakten beim Aufbau von Common Knowledge | 187 |
| 7.4.6 Zusammenfassung | 190 |
| 7.5 Wissensspeicherung | 191 |
| 7.5.1 Zusammenfassung | 193 |
| 7.6 Wissensumsetzung | 194 |
| 7.6.1 Direkte Wissensumsetzung | 195 |
| 7.6.2 Transactive Encoding | 196 |
| 7.6.3 Zusammenfassung | 199 |
| 7.7 Kommunikationsbarrieren in Beratungsprojekten | 200 |
| 7.7.1 Mechanismen zur Herstellung von Anschlussfähigkeit | 203 |
| 7.7.2 Inkommunikabilität aufgrund unkontrollierbarer Effekte | 214 |
| 7.7.3 Zusammenfassung | 217 |
| 8. Diskussion | 220 |
| 8.1 Diskussion der empirischen Ergebnisse | 220 |
| 8.1.1 Beiträge zur TOL-Forschung | 220 |
| 8.1.2 Beiträge zur Beratungsforschung | 225 |
| 8.2 Limitationen der Arbeit | 228 |
| 8.3 Implikationen für die Forschung | 229 |
| 8.4 Anregungen für die Praxis | 230 |
| Anhang | 233 |
| Anhang 1: Überblick Interviewthemen | 233 |
| Anhang 2: Zitationsbeispiel und Transkriptionserläuterung | 236 |
| Literaturverzeichnis | 237 |