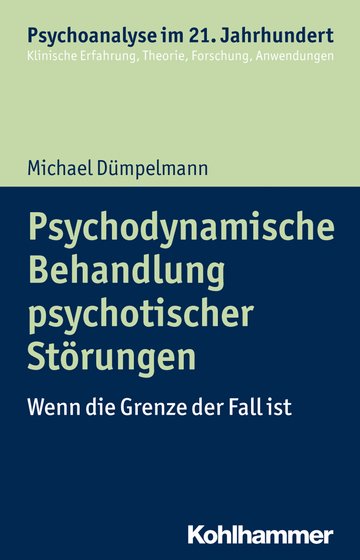2 Wie Psychosen zum Gegenstand werden
»Woyzeck, Er hat die schönste Aberratio mentalis partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt.«
Georg Büchner
Einführung
Woran denken wir und welche Bilder machen wir uns, wenn das Wort »Psychose« auftaucht? Diese Fragen führen zu den Mitteln und Konventionen, Psychosen zu beschreiben und zu systematisieren. Neben einigen epidemiologischen Daten zum Auftreten und zu auffälligen Geschlechterunterschieden werden dazu zwei Konzepte vorgestellt. Beide basieren auf psychopathologischen Kriterien, die jedoch unterschiedlich verwendet werden, einmal kategorial und zum anderen funktional. Für das Verständnis von Psychosen ergeben sich daraus gravierende Unterschiede, die für den psychodynamischen Zugang zu ihnen relevant sind. Auch für die Rezeption von Psychosen und damit verbundene explizite und implizite Wertungen hat das Folgen: Störung bzw. Erkrankung mit potenzieller Stigmatisierung oder ein Strukturmerkmal unter vielen anderen?
Lernziele
Überblick gewinnen und Kennenlernen von
• Symptomen, Prävalenzen, Genderdifferenzen psychotischer Störungen,
• den aktuellen diagnostischen und klassifikatorischen Konventionen für sie,
• alternativen Konzepten, insbesondere dem der Einheitspsychose, und
• den Auswirkungen der Klassifikation auf die Rezeption der Störungsbilder.
2.1 Symptomatik und Epidemiologie
Nichtorganische bzw. funktionelle Psychosen, das Thema dieses Buches, lassen sich knapp als Veränderung des Selbst- und Weltbezugs beschreiben, woran nach Ausprägung und Typ unterschiedlich das Erleben der eigenen Person und der Objekte, Affektivität, Denken, Antrieb und auch Motorik beteiligt sind. Positivsymptome, wie etwa Wahn und Halluzinationen, werden von Negativsymptomen unterschieden, den Störungen basaler Ich-Funktionen, die unspezifisch sind (Häfner, 2017). Bleuler unterschied dazu weitgehend analog zwischen Sekundärsymptomen von Wahn und Halluzinationen und Primärsymptomen (1911).
In der Gruppe F 2 der ICD-10 werden schizophrene, schizoaffektive, schizotype, anhaltend wahnhafte, akut vorübergehende und einige weitere Störungen zusammengefasst und durch Psychosen bei Depressionen und Manien der Gruppe F 3 ergänzt (Dilling, Mombour, & Schmidt, 1993). Darunter ist das bedeutsamste Störungsbild die Schizophrenie, die mit Positivsymptomen – Ich-Störungen, Wahn und Halluzinationen – und Negativsymptomen wie verarmtem Sprachverhalten und Denken, affektiver Verflachung, vermindertem Willen bis hin zu Apathie und Anhedonie beschrieben wird (vgl. Scharfetter, 1990). Schizophrenien werden in paranoid-halluzinatorische, hebephrene bzw. desorganisierte, katatone und solche unterteilt, in deren Mittelpunkt depressive Symptome nach einer akuten Psychose stehen. Dass die verschiedenen schizophrenen Störungsbilder als Typologien einer homogenen Gruppe anzusehen sind, wird bezweifelt (van Os, 2016). Zur Lebenszeitprävalenz werden Werte um 1 % angegeben (Tölle & Windgassen, 2009), aber auch stärker abweichende Zahlen wie z. B. 0,49 % in einer Region Süditaliens (Mulè, Sideli, Capuccio, Fearon, Ferraro et al. 2016). Geht man vom gesamten Spektrum psychotischer Störungen aus, werden Prävalenzen um 4 %, bei Einbeziehung auch subklinischer psychotischer Symptome um 8 % genannt (van Os, Linscott, Myin-Germeys, Delespaul & Krabbendam, 2008).
Psychodynamisch von Interesse und zunehmend im Fokus empirischer Untersuchungen sind Geschlechtsunterschiede bei psychotischen Störungen, die Erstmanifestation, Verlauf und Ausprägung betreffen. Schizophrene Psychosen treten bei Frauen bis zum 21. Lebensjahr später und weniger intensiv ausgeprägt auf, jedoch nach dem 40. Lebensjahr häufiger und schwerer ausgeprägt als bei Männern auf, was mit der Wirkung von Östrogen erklärt wird (Häfner, 2017). Analoge Unterschiede zwischen den Geschlechtern wurden auch bei schizoaffektiven und affektiven Psychosen gefunden, jedoch quantitativ geringer ausfallend (McGlashan & Bardenstein, 1990). Östrogen wird als Schutzfaktor mit einer Erhöhung der Vulnerabilitätsschwelle und einer Dämpfung der Symptomintensität angesehen (Häfner, 2017). Bei schizophrenen Frauen werden mehr emotional geprägte und weniger Negativsymptome, bessere soziale Beziehungen und auch ein leichterer therapeutischer Zugang beschrieben. (Brzezinski-Sinai & Freeman, 2017). Eine Untersuchung von Wahnthemen zeigte nahezu gleiche Häufigkeiten für Verfolgung und religiöse Inhalte, bei Frauen jedoch vermehrt hypochondrischen und Liebeswahn sowie seltener Größenwahn als bei Männern (Stompe, 2008). Trotz der vielen Ansatzpunkte dazu, die sich in diesen Befunden zeigen, spielen Genderdifferenzen in psychodynamischen Arbeiten zu Psychosen bisher keine größere Rolle.
2.2 ICD-10: Von der Krankheitseinheit zur Störungskategorie
Die Abgrenzung einzelner Typologien von Psychosen voneinander kann schwierig sein. Die Abbildungsmöglichkeiten der ICD-10 für die Bandbreite von Störungsbildern, bei denen psychotische Symptome auftreten können, sind z. T. wenig befriedigend. Eine schizoaffektive Störung zu diagnostizieren, wird kritisch als eine »Ermessensfrage« betrachtet (Tölle & Windgassen, 2009, S. 269). Koinzidente Symptome von Persönlichkeitsstörungen, Ängste, Zwänge u. ä. sind klinisch nicht selten, müssen aber entweder als Teil der Psychose oder nicht der Regel entsprechend als weitere Entität im selben Fall klassifiziert werden. Für leichtere, impressiv oft als psychosenah oder präpsychotisch bezeichnete Syndrome stehen nur »Schizotypie« oder »akut vorübergehende« psychotische Störungen zur Auswahl. Der Vielfalt von Syndromen, an denen psychotische Symptome beteiligt sein können, entspricht das nicht, wie auch nicht der Verbreitung subklinischer Manifestationen in der Allgemeinbevölkerung. Dem System der ICD-10 ist somit eine Tendenz inhärent, durch die angebotenen Kategorien das Auftreten psychotischer Zustände stets als schwere Erkrankung zu bewerten, was der historischen Schichtenregel entspricht: Danach bestimmen die Teile eines individuellen Syndroms dessen Charakter, denen die stärkste Pathologie zugeschrieben wird (Jaspers, 1948). Der Fülle psychotischer Symptome bei Syndromen unterschiedlichen Schweregrads entspricht dies nicht.
Grundlage der Systematik psychischer Störungen in der ICD-10 ist, dass sie einem deskriptiv-kategorialen Ansatz folgt: Symptomatische Merkmale werden im Querschnitt nebeneinander beschrieben und dann zu Störungskategorien zusammengefasst. Diese Konventionen haben die Reliabilität von Diagnosen zweifellos verbessert, was sich von der Validität der so definierten Störungstypologien jedoch nicht sagen lässt (Böker, Northoff, & Dümpelmann, 2016). Auch für psychotische Störungen lassen sich in ihnen trotz aller Modifikationen noch unschwer die Grundzüge der historischen Entwürfe Kraepelins und Schneiders ( Kap. 3) erkennen. Sie hatten bei Psychosen zwar psychisch manifeste, jedoch somatisch begründete, endogene Krankheitseinheiten und eine dichotome Aufteilung in den schizophrenen und den zyklothymen Formenkreis postuliert, was leicht einen Eindruck von Homogenität vermitteln kann. Den explizit erhobenen Anspruch der ICD-10 auf weitgehende Theoriefreiheit schränkt die implizite Nähe zu historischen Ätiologiemodellen erheblich ein. Das Morbus-Modell (Scharfetter, 1990) blieb trotz der Umbenennung in »Störung« in vielen Zügen erhalten und ist mitverantwortlich für eine lange und folgenreiche biologische Orientierung vieler psychiatrischer Psychosenkonzepte und einen entsprechenden Nimbus von Psychosen, die früher auch oft »Morbus Bleuler« genannt wurden. Zu Zeiten hoher Anforderungen an Evidenz ist es verwunderlich, dass sich als störungsspezifisch bezeichnete Empfehlungen, etwa pharmakotherapeutische, an dieser Schematik orientieren (Moncrieff, 2013).
An der Klassifikation und der Einordnung von Psychosen gab es und gibt es aber reichlich Kritik und auch Alternativen dazu wurden formuliert. Dazu einige Beispiele: In Leonhards Einteilung der Psychosen werden im Vergleich zur ICD-10 affektive Aspekte erheblich stärker gewichtet, etwa durch die Kategorie der zykloiden Psychosen (2003). Aber lassen sich psychische Störungen überhaupt kategorisieren? Scharfetter hinterfragt kategorische Abgrenzungen am Beispiel der Trennung schizophrener von dissoziativen Störungen,...