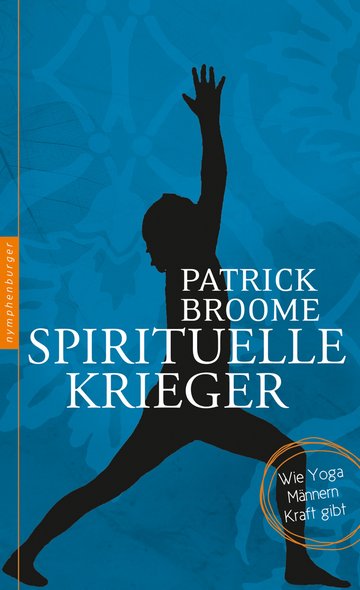PATRICK BROOME
Von einem, der auszog, um sich selbst zu finden
© Heike Wasem-Hasso
Standpunktkoordinaten: Hier. Jetzt. Heute.
Im Jahr 2014 sind zwei äußerst bedeutungsvolle Dinge in meinem Leben geschehen, die auf den ersten Blick zunächst einmal herzlich wenig miteinander zu tun haben. Im Sommer dieses schicksalhaften Jahres wurde ich als Yogalehrer der Deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien Teil der Weltmeister-Euphorie und erlebte alle Höhen und Tiefen der Spieler hautnah mit. Geführt wurden diese Männer von einem Trainerteam, das in die Fähigkeit der Mannschaft vertraute und dieser vor allem unterstützend zur Seite stand. Angeführt von einem Cheftrainer, der sich von kleineren und größeren Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen ließ und gelassen beobachtete, wie sich die Dinge ganz von selbst entwickelten und schließlich zum Großen und Ganzen zusammenfügten. Getragen wurde dieses Vertrauen von der Kraft der Zuversicht: vom unerschütterlichen Optimismus.
Die Psychologieprofessorin Dr. Astrid Schütz forscht seit vielen Jahren zu diesem Thema. »Optimismus heißt, positive Ergebnisse zu erwarten«, erklärt sie. »Die Grundannahme lautet: Es wird schon gut ausgehen« (siehe dazu Ingrid Kupczik: »Optimismus: Die Kraft der Zuversicht«). Dahinter steht das tief verwurzelte Vertrauen, dass die Dinge sich – irgendwie – in der gewünschten Weise entwickeln werden. In Verbindung mit einer hohen »Selbstwirksamkeitserwartung« wirkt diese Haltung wie ein Zauberspruch. Die Macht der Selbstwirksamkeit basiert auf der Überzeugung, dass die eigene positive Entwicklung selbst aktiv bewirkt werden kann. Forscher gehen davon aus, dass ein zuversichtlicher Charakter zu etwa 30 Prozent genetisch bedingt ist. Der weitaus größere Anteil resultiert jedoch aus dem Erleben positiver Lebenserfahrungen.
Zum anderen ging mit dem Tod des von mir hochgeschätzten indischen Großmeisters B. K. S Iyengar symbolisch die Ära des sogenannten Guru-Yoga zu Ende: Die Emanzipation des Schülers vom Lehrer war damit unausweichlich geworden. Yoga wirkt – unabhängig vom Kult und vom Lehrer, der seinen Schüler ein Stück weit führt und ihm hilft, sich auszurichten. Anschließend muss der Weg jedoch unbedingt auf eigenen Beinen fortgesetzt werden, damit der Schritt in die Selbstwirksamkeit gelingt.
Yoga wurde in den letzten Jahrzehnten mit allen möglichen Heilsversprechen überfrachtet: vom Weltfrieden über den Umweltschutz bis hin zur generalisierten Erlösung von sämtlichem Leid. Die Autorin Pearl S. Buck meinte dazu einst lakonisch: »Wer die Welt verbessern will, sollte gleich bei sich selbst anfangen.« Vielleicht dient Yoga ja einfach nur als »Werkzeug«, damit wir uns in unserem Körper etwas wohler fühlen und lernen, das Auf und Ab des Lebens zu meistern, uns von Rückschlägen zu erholen und gelassen durch den Alltag zu gehen. Der bekannte Yogalehrer David Swenson erklärte vor vielen Jahren einmal auf einem Workshop, dass er ohne Yoga verrückt werden würde. Der »Zauber« des Yoga wirkt also von selbst – ganz ohne Hokuspokus …
Nichts ist beständiger als der Wandel
Meine Geschichte begann vor fast einem halben Jahrhundert, als ich im beschaulichen Kulmbach geboren wurde. Zu jener Zeit also, als der Lieblingsmoderator meiner Mutter, Thomas Gottschalk, seinen Charme über den Äther versprühte. Einem Gerücht zufolge wurde ich nach einer feuchtfröhlichen Faschingsparty aufgrund eines verzögerten Coitus interruptus im Fonds des klapprigen VW Käfers meines Vaters Jim gezeugt. Die Begeisterung meiner damals knapp 19-jährigen Mutter hielt sich jedoch – verständlicherweise – in Grenzen, als sie von der Schwangerschaft erfuhr. Ich war kein Wunschkind. Und das spürte ich sehr schnell.
Weil meine Mutter arbeiten musste, um mich und meinen Vater, der noch am Abitur laborierte, zu ernähren, kam ich zu meiner Großmutter. Als mein Vater mit Pauken und Trompeten durchfiel, musste ein neuer »Businessplan« her: auf und davon nach Amerika – ein Jahr Highschool und dann dort auf die Universität. Also wurde ich im zarten Alter von etwa vier Monaten kurzfristig bei der Oma abgeholt und mit meinen Teenager-Eltern nach Kalifornien verschifft. Ich vermute, dass unser Leben dort einfach, aber happy war. Die Fotos dieser Zeit zeigen Regale aus Apfelsinenkisten, Mama im Food Store Co-op als Kassiererin und Papa Jim im Liquor Store als Verkäufer. Es war eine verrückte Zeit: Die Abbildungen von Adventskränzen, die Feuer fingen, und Nachtwandlern bei Vollmond sprechen eine eigene Sprache. Das Leben spielte sich hauptsächlich draußen ab.
Mit knapp fünf Jahren war der American Dream jedoch ausgeträumt und ich flog mit meiner sehr nachdenklich wirkenden Mutter über den Großen Teich zurück nach Deutschland. Die Beschwichtigungsparolen lauteten, dass Daddy bald nachkommen würde. Doch stattdessen trat Roger auf den Plan: ein trinkfester Exknacki, der mich mit den wildesten Geschichten über sein Leben als Boxer und Weltenbummler bei Laune hielt. Dass nichts davon auch nur annähernd der Wahrheit entsprach, war Nebensache. Roger beeindruckte mein kindliches Gemüt. Gemeinsam verfolgten wir nachts um eins Muhammad Alis Boxkämpfe und schwitzten mit ihm von Runde zu Runde: reine Männersache. Ansonsten war diese Zeit meiner Kindheit geprägt von Missverständnissen, Schulwegprügeleien und ungesühnten Ungerechtigkeiten.
Als »Schlüsselkind« war ich oft allein und unglaublich eifersüchtig auf die anderen Kinder, die nach der Schule von ihren Müttern und einem warmen Essen erwartet wurden. In den Ferien wurde ich bei Oma auf dem Land abgegeben. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass es für meine Mutter keine leichte Zeit war und sie als Alleinerziehende diese Auszeiten von Kind und Kegel für sich brauchte. Doch ich fühlte mich abgeschoben und unerwünscht.
Ein paar Jahre später war dann auch Roger plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Dafür kam Eduard ins Spiel: beruflich erfolgreich, zuverlässig und mitunter unglaublich spießig – das absolute Gegenteil von Roger. Nun folgte der soziale Aufstieg … Aus der »Nürnberger Bronx« siedelten wir ans Prinzregentenufer der Frankenmetropole über. Meine Mitschüler beobachteten die Veränderungen misstrauisch und feindeten mich an, weil ich den Wechsel ins Gymnasium schaffte.
Was zu jener Zeit genau mit mir passiert ist, weiß ich nicht. Plötzlich wurde ich schwer depressiv, hatte jedes Gefühl für mich selbst verloren und entwickelte eine ausgeprägte Essstörung. Ein unablässiger Kampf mit meinem Körper, meinem Aussehen und meiner Umwelt, der ich mich immer weniger zugehörig fühlte, begann. Ich fühlte mich wie ein apathischer Zuschauer, der am Rande stehend sein eigenes Leben beobachtet. Ich hasste mein teigiges Gesicht und meinen schwammigen Körper. Und trotzdem knutschte ich mit den Mädels der Schule und des Viertels herum, als gäbe es kein Morgen.
Im Alter von 14 Jahren wohnte ich quasi allein, mal bei Jim, mal bei meiner Tante Anita, und konnte nahezu unbeaufsichtigt tun und lassen, was ich wollte. In dieser Zeit ließen mein bester Kumpel Page und ich es so richtig krachen: jede Nacht unterwegs zwischen Kirchendisco und Privatparty. Meist mit nichts als einer Gurke im Magen, da diese einerseits sättigte und andererseits den Durst löschte. Ich empfand das Leben als herausfordernd: spannend, emotional aufwühlend, aber auch furchtbar anstrengend. Und dennoch fühlte ich mich, als ob ich mir von draußen durchs Fenster bei all dem rastlosen Treiben zuschaute. Alle Menschen um mich herum schienen mehr Spaß zu haben als ich. Ich hing fest und die nächsten zehn Jahre ging es genauso im Hamsterrad weiter. Es schien sich immer alles um die anderen zu drehen, aber niemals um mich.
Häufig leiden wir, weil wir uns selbst nicht kennen. Weil wir nicht wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir wissen nicht, wer wir sind und wozu dieses Leben eigentlich gut ist. Das Leben erscheint einem immer dann als sinnlos, wenn es mechanisch gelebt wird und in Wiederholungen verläuft. Aus eigener Erfahrung weiß ich nur allzu gut, dass ein junger Mann oder Jugendlicher im Zustand derartiger Orientierungslosigkeit kaum etwas Sinnvolles zu leisten vermag bzw. am Gefühl der Sinnlosigkeit zerbrechen oder scheitern kann.
Es folgte der Umzug nach Köln – zurück ließ ich meine Freunde, mein Leben und mein Herz. In der Karnevalshochburg funktionierte ich wieder so, wie es von mir erwartet wurde. Rein äußerlich entsprach ich dem Bild eines Punks. Doch ich erschien jeden Tag pünktlich in der Schule und war dort einer der motiviertesten Schüler. Meine Katze Charly, die jede Nacht in meinem Arm einschlief, war mein stabilisierender Halt und der Quell meiner Liebe.
Dann erfolgte der erste Warnschuss. Ein paar Wochen vor dem Abitur wurde ich mit dem Motorroller von einem Auto umgefahren: regennasse Straße, Führerschein gerade erst seit drei Tagen in der Hosentasche … – doch wie genau es passiert war, wusste keiner. Die Krankenakte vermerkte, dass meine linke Körperseite völlig zerschmettert war: linker Oberschenkel komplett durch, der Oberarm ein einziger Trümmerhaufen, der Ellenbogen nicht mehr vorhanden, das Gesicht zerschnitten. Ich sah mich auf der Straße liegen und mit Sanitätern sprechen, die mich derart entsetzt ansahen, dass ich glaubte, sie beruhigen zu müssen. Anschließend das Klischee vom hellen Licht, sich verströmender Wärme und das tiefe Gefühl von Entspannung, Ruhe und Sicherheit. Ob dies nun eine Nahtoderfahrung oder das Resultat starker Schmerzmittel war, die mich noch drei Tage nach dem Unfall einen halben Meter über dem Bett der...