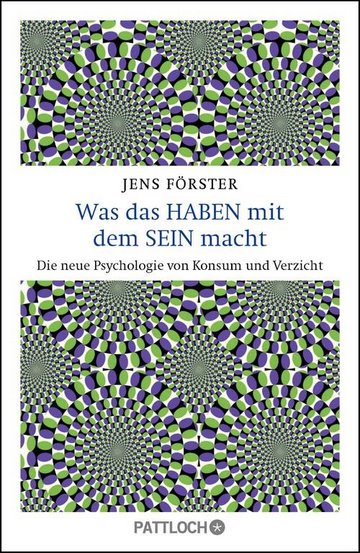Die objektive Sicht: Wir haben ein Problem
Die Explosion der Dinge
Aus einem völlig anderen Blickwinkel der Beobachtung, einem, der eine objektive Sicht zulässt, erkennen wir, dass immer mehr Menschen erbärmlich wenig haben, wohingegen Mitglieder der Mittel- und Oberschicht in wohlhabenden, meist westlichen Gesellschaften so viele Dinge besitzen wie nie zuvor Menschen eines vergleichbaren Standes. Zudem klafft die Schere zwischen armen und reichen Nationen immer weiter auseinander.
Die Anzahl unserer Besitz- und Konsumgüter ist enorm und wächst explosionsartig. John Ryan hat es für uns ausgerechnet: Jeden Tag konsumiert jeder in der westlichen Welt rund 55 Kilo an »Zeug«, meist mit negativem Einfluss auf die Umwelt. Dazu gehören Plastiktüten, Zahnpasta, Wasser, Benzin, Nahrung, Kleidung, Pappbecher und all das, was zu deren Herstellung nötig ist. Zeug besteht aus Zeug: Allein ein »Coffee to go« beispielsweise aus einem Becher, einem Plastikdeckel, einem Holzstiel, einer Packung für Zucker, Zucker, einem Döschen für Milch, Milch, einer Serviette und einer Pappmanschette; acht Dinge, die alle woanders produziert, zu diesem Ort gebracht und dann sortiert und eingeordnet werden müssen. Hunderte Menschenhände haben daran gearbeitet. An einem Kaffee, den ich trinke (oder nach zwei Schlucken wegwerfe, weil er mir nicht stark genug ist), sind also unter anderem zig Fabriken und zig Transportunternehmen beteiligt. Nicht zu vergessen die zig Rohstoffe, die verbraucht wurden (Wasser, Holz, Metalle, Gas, Farben etc.) und die zig Eingriffe in die Natur, die dafür nötig waren (wie Straßenbau zu den Fabriken oder Umleitung von Flüssen) und wiederum den Einsatz von Dingen, Substanzen und Werkstoffen erfordert haben (Baumaschinen, Sicherheitshelme, Arbeitskleidung usw.). So sind zig Liter Wasser, zig Liter Öl, eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Giften sowie einige Kilowattstunden an Strom nötig, um allein die farbige Aluminiumlasche auf dem winzigen Milchdöschen zu produzieren. Früher hätte an seiner Stelle ein einziges Ding – ein Milchkännchen – gestanden, das ständig wieder aufgefüllt worden wäre.[6]
Dies ist nicht der einzige Grund, warum unser ökologischer Fußabdruck immer größer wird. Um das Überleben der Erde zu gewährleisten, stünden jedem Menschen 1,8 Hektar Land zur Verfügung. Gegenwärtig beansprucht jeder Erdenbürger jedoch im Schnitt 2,7 Hektar, wobei die Größe je nach Region stark variiert; der ökologische Fußabdruck von uns Deutschen misst zum Beispiel 4,6 Hektar pro Person, was einer Überbeanspruchung der Biokapazität von über 100 Prozent entspricht! Mit anderen Worten: Wir betreiben Raubbau, konsumieren mehr, als wir haben, und leben damit »auf Pump«, solange die Erde uns Kredit gibt.
Wir verbrauchen mehr Strom, Wasser und andere Ressourcen, als uns zur Verfügung stehen. Die ständig steigende Tendenz dieser Beanspruchung kann anhand des stetig steigenden Besitzes des Durchschnittseuropäers im Lauf des letzten Jahrhunderts verdeutlicht werden.
Hyper-Ich
Der französische Soziologe und Philosoph Gilles Lipovetsky hat unserem Zeitalter ein Hyperkonsumverhalten zugeschrieben, das von zwei Phasen – der Phase der Erfindung des modernen Konsumenten (1890 bis 1950) und der Phase des Massenkonsums (50er bis 70er Jahre) – eingeleitet wurde. Kurz gefasst stellt er fest, dass wir immer mehr Güter besitzen, die Anfang des Jahrhunderts zwar ebenso begehrt, aber bis in die späten 40er Jahre hinein einer elitären Schicht vorbehalten waren. Bis 1880 waren Produkte recht unschön und anonym verpackt und wurden in Massen verkauft. Wie Wolfgang Ullrich sehr schön beschreibt, ging es vor allem um Haltbarkeit. Patina war etwas Positives und zeigte einen Wert an, da sie für eine lange Lebensdauer eines Objekts, zum Beispiel eines Kochtopfs, sprach. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann man Produkten durch Verpackungen ein gefälliges Aussehen zu geben; man erfand die Werbung und gab Gütern einen Markennamen. Aus einer bloßen Bedarfsdeckung wurde die Bedarfsweckung; man wollte möglichst breite Bevölkerungsschichten zum Konsumieren verführen. Zwar konnte damals tatsächlich das ein oder andere Begehren geweckt werden, jedoch blieb es häufig dabei, da die leeren Geldbeutel der breiten Mittel- und Unterschicht keine Umsetzung der neu erzeugten Träume erlaubten. Kaum jemand konnte sich die als Selbstverständlichkeiten beworbenen Produkte wie Auto, Fernseher, Radio oder Kühlschrank leisten. Vielleicht kennen Sie die vergilbten Fotos, auf denen offensichtlich mehrere Familien in einem Wohnzimmer dicht gedrängt vor einem Radio sitzen – ein alltägliches Szenario zu jener Zeit.
Nach dieser ersten Phase setzte in den 50er Jahren durch den wirtschaftlichen Aufschwung eine sogenannte Demokratisierung des Konsumverhaltens ein – vormalige Luxusgüter wurden Standard. So hatten beispielsweise im Jahr 1975 immerhin 73 Prozent der Franzosen ein Auto, 86 Prozent ein TV-Gerät und 91 Prozent einen Kühlschrank. Plötzlich verloren Erbstücke und alles Alte ihren Wert. Man hatte Lust auf modernes Design, auf Neues; alles musste glänzen. Was dann Anfang der 80er Jahre begann, davon hatte die Wirtschaft vermutlich nicht zu träumen gewagt: Die Idee, dass jede Familie ein Exemplar dieser Güter haben musste, wurde von der neuen Norm abgelöst, dass jeder Einzelne sein eigenes haben sollte. Die Ära des Zweit-Autos, des Dritt-Fernsehers, ja, des Zweit-Kühlschranks begann, und so hatte jeder nun »seins«. Während also der elfjährige Erwin in den 50er Jahren froh sein konnte, wenn die kostbare Brause, die er vom Nachbarn fürs Kohletragen bekommen hatte, nicht gleich von seinen zwei Brüdern, die das Zimmer mit ihm teilten, stibitzt wurde, sitzt heute der gleichaltrige Mark-Jason auf seinem rückenschonenden Sitzsack und greift sich entspannt einen Iso-Drink aus seinem danebenstehenden Mini-Fridge; dabei spielt er in seinem Zimmer an seiner eigenen Konsole seine Lieblings-Games.
Kinderzimmerfreiheit
Lipovetsky weist auf die psychologischen Folgen hin. Er beobachtet einen zunehmenden Hyperindividualismus, der zwangsläufig entsteht, wenn jemand durch den Besitz von allem von anderen Mitgliedern einer Gesellschaft unabhängig wird. Das könnte zu ungeahnten Problemen führen: Wenn Mark-Jason nicht mehr mit anderen teilen muss, wie lernt er dann, sich sozial zu verhalten, wie es Erwin früher notgedrungen musste? Die Tatsache, dass er nicht mehr in die Küche laufen muss, um sich einen Saft zu holen, könnte allein schon seine Möglichkeiten einschränken, mit anderen Menschen zu interagieren. Und wer ersetzt ihm die vielen Kontakte, die Cliquen, die Freundeskreise, die für Erwin notwendig waren, um sich beispielsweise ein Fahrrad auszuleihen? Wo lernt Mark-Jason geschicktes Verhandeln? Wie lernt er, Leute mit begehrenswerten Dingen oder Ressourcen um den Finger zu wickeln; wie macht er sich interessant, wie gewinnt er Freunde, und wie hält er sie sich warm? Obendrein: Wie hält er es später aus, wenn er einen Wunsch oder ein Bedürfnis einmal nicht sofort erfüllt bekommt? Kann er überhaupt verzichten? Diese Fragen sind tatsächlich ernst und nicht rhetorisch gemeint, sie beinhalten keinesfalls eine vorgedachte Antwort in dem Sinne, dass der Egoismus das Ende des Abendlandes einleite.
Menschen haben sich schließlich immerfort verändert, sie haben sich neuen Gegebenheiten und Technologien angepasst, und sie suchen sich neue Ziele und Herausforderungen. Es ist durchaus möglich, dass Mark-Jason durch die Sicherheit, in die er hineingeboren wurde, und durch seine Internetkontakte später einmal zum nächsten Bill Gates oder Mahatma Gandhi wird.
Die Wertneutralität, der ich mich als Wissenschaftler verpflichtet habe, gebietet es, niemals die Aufmerksamkeit allein auf etwaige negative Konsequenzen zu richten (siehe die mühseligen und ideologisch aufgeladenen Debatten über die »Gefahr durch Medien«). Eine Psychologie, die Alltagsphänomene erklären will, muss vielmehr nach der Funktion eines Verhaltens suchen, um den Menschen – und damit das Menschliche – besser zu verstehen. Mark-Jason beispielsweise hat viel größere Freiheiten als seine Eltern in ihrer Kindheit. Vielleicht ist ihm ja seine individuelle Zeitgestaltung wichtiger, als mit seiner Schwester auf dem Sofa zu kuscheln. Außerdem könnte er sich jederzeit zu ihr setzen, wenn er wollte. Eventuell liebt er die Wahlfreiheit, mal das eine und mal das andere tun zu können: die Kindersendungen gemeinsam mit der Schwester zu schauen, aber die Jungs-Filme lieber allein in seinem Zimmer. Er hat jedenfalls bessere Möglichkeiten, sich vor verständnislosen Erwachsenen zurückzuziehen; etwas, was Erwin nicht konnte; er war permanent den elterlichen Launen (und langweiligen Fernsehsendungen) im patriarchalisch strukturierten Wohnzimmer ausgesetzt.[7] Gegebenenfalls hat Mark-Jason später ein Defizit, was Augenkontakte, Sprachfähigkeiten oder soziale Beziehungen angeht, aber wer würde das gegen ein früh erlebtes Gefühl von Freiheit und Autonomie aufwiegen wollen? Ich nicht.
Nehmen wir beispielsweise die Rechtschreibung: Früher war natürlich alles besser, weil wir vor der Rechtschreibreform alle richtig geschrieben haben. Jetzt...