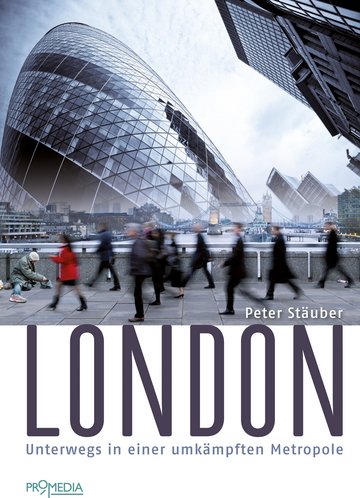Einleitung
Am 8. August 2011, es war ein warmer Abend, stand ich an der Ecke Dalston Lane und Clarence Road, im Zentrum des östlichen Stadtbezirks Hackney, und deutete einem Taxifahrer an, umzukehren. Er streckte den Kopf aus dem Fenster und fragte: “What’s going on?” – “There’s a riot!”, antwortete ich und dachte: Sieht man das denn nicht?
Schwarze Wolken qualmten aus einem brennenden Auto, Dutzende Jungs, einige vermummt, warfen Steine und Flaschen auf die Polizei, die sich in voller Krawallmontur am Eingang der Straße aufgestellt hatte. Ein Quartierladen etwas weiter nördlich wurde gerade geplündert. Immer wieder versuchten die Ordnungskräfte, die Kontrolle über die Straße zu gewinnen, doch jedes Mal, wenn sie vorstießen, verschwanden die Jungs in den Seitengassen und tauchten Minuten später an einer anderen Ecke des Quartiers wieder auf. Die Polizei war völlig überfordert. Bis in die Nacht hinein dauerte der Tumult, ständig begleitet vom Dröhnen der Polizeihelikopter im Londoner Nachthimmel.
Die Riots vom Sommer 2011 waren die schwersten Unruhen in London seit den 1980er-Jahren, und sie trafen die Stadt wie einen Schock. Unmittelbarer Anlass war ein tödlicher Zwischenfall, bei dem Mark Duggan, ein junger Schwarzer, im nördlichen Stadtteil Tottenham von der Polizei erschossen wurde. In der Folge informierte die Polizei dessen Familie nur bruchstückweise, Gerüchte über den genauen Hergang seiner Erschießung sorgten in der schwarzen Community für Empörung und Unsicherheit. An einer Demonstration vor der lokalen Polizeistation, bei der die Angehörigen Duggans und zahlreiche Lokalanwohner Aufklärung forderten, kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Ordnungskräften, die schnell zu einem Krawall eskalierte. Auf der Tottenham High Road brannten Autos, Scheiben wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert, und Jugendliche lieferten sich eine wilde Straßenschlacht mit der Polizei. In den folgenden Tagen griffen die Riots auf andere Stadtteile über, danach auch auf andere Städte Englands. Tausende Jugendliche beteiligten sich, es kam zu zahlreichen gewalttätigen Zwischenfällen. Insgesamt starben fünf Menschen.
In den folgenden Wochen und Monaten fragten sich die Londoner, woher diese sozialen Unruhen auf einmal gekommen waren. Sicher, die Finanzkrise des Jahres 2008 hatte Spuren hinterlassen, die Wirtschaft einen Einbruch erlebt und viele Leute waren verunsichert. Aber insgesamt war London dank der Rettungsaktion der Regierung relativ glimpflich aus dem Kollaps des Bankensektors hervorgegangen. Die City boomte weiterhin, überall wurden neue Bauprojekte aufgezogen, und die Stadt setzte ihr rasantes Bevölkerungswachstum ungemindert fort. Was war schiefgelaufen?
Für Konservative wie den Premierminister David Cameron war sofort klar, dass die Krawalle »schlicht und einfach Kriminalität« seien – und die Urheber entsprechend bestraft werden müssten. Tatsächlich fielen die Gerichtsurteile harsch aus: Laut Regierungsangaben wurden 1400 Menschen zu Freiheitsstrafen verurteilt, die über vier Mal länger ausfielen als die Strafen für ähnliche Vergehen im Vorjahr.1 Ein junger Mann, der Wasser für 3,50 Pfund hatte mitgehen lassen, wurde für sechs Monate ins Gefängnis gesteckt. Auch von der konservativen Boulevardpresse wurde hartes Vorgehen gefordert. Die Riots seien »sinnlose Aggressivität, die sich als Protest verkleiden«, schrieb ein entrüsteter Kolumnist in der Daily Mail, und eine solche »wilde Herrschaft des Mobs sollte keinen Platz haben in einer zivilisierten Gesellschaft.«2 Jegliche Versuche, die Krawalle als mehr als einen spontanen, isolierten und sinnentleerten Ausbruch des Vandalismus zu deuten, wurden damit von vorneherein abgewürgt.
Doch bei genauerem Hinsehen ließ sich der Verdacht, dass hinter den Riots auch soziale Ursachen stecken, nicht so einfach beiseite schieben. Nach Zahlen des Justizministeriums waren die Beteiligten überdurchschnittlich von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen, viele hatten in der Schule Probleme.3 Eine umfangreiche Studie des Guardian und der London School of Economics bestätigten die Vermutung, dass sozialer Ausschluss eine zentrale Rolle spielte: Die Beteiligten nannten Armut, Arbeitslosigkeit und Übergriffe seitens der Polizei als wichtige Faktoren für den Ausbruch der Unruhen.4 Die Interviewten sprachen von fehlenden Perspektiven, mangelnden Arbeitsplätzen und steigenden Mieten; »viele Leute haben das Gefühl, dass sie ersetzt werden durch Leute, die Geld haben, und das macht sie verbittert«, sagte einer.5
Solche und ähnliche Aussagen vernimmt man nicht nur von jungen Menschen aus unterprivilegierten Schichten. Ich höre sie fast immer, wenn ich mit Londonern auf das Leben in der Metropole zu sprechen komme: das Gefühl, dass ihnen ihre Stadt abhandenkommt. In den Jahren seit den Riots ist dieses Empfinden keineswegs schwächer geworden, im Gegenteil – die Ursachen, die dahinter stecken, haben an Intensität zugelegt: steigende Mieten und exorbitante Preise für den Kauf eines Eigenheims; die daraus resultierende Gentrifizierung in praktisch ganz Inner London;6 riesige Bauprojekte, die die ärmeren Bevölkerungsschichten aus der Stadt vertreiben; reiche Anleger, für die eine Londoner Wohnung nichts als eine Investition ist.
Wenn sich London auf den ersten Blick als eine dynamische Weltstadt präsentiert, die sich in punkto Internationalität, Coolheit und Aufregung nur mit New York messen muss, ist dies nur die halbe Wahrheit: Die Stadt ist geprägt von Gegensätzen, tiefer als die Tube. Freilich ist die Feststellung, dass London eine Stadt der Widersprüche ist, banal – jeder Ort, in dem Millionen von Menschen leben, ist zwingend von Gegensätzen geprägt. Ebenso klar ist, dass sich Gentrifizierung in vielen urbanen Räumen beobachten lässt. Auch sind die Entwicklungen in der britischen Hauptstadt nicht so extrem und makaber wie beispielsweise in Delhi, wie Rana Dasgupta in seinem Buch über die indische Metropole beschreibt.7
Aber dennoch muss jeder, dem eine nachhaltige und demokratische urbane Entwicklung am Herzen liegt, mit sorgenvollen Blicken auf die Stadt an der Themse blicken – nicht zuletzt aufgrund der wichtigen Rolle, die London auf der internationalen Bühne spielt: Viele Entwicklungen, die auch in anderen westlichen Städten zu beobachten sind, vollziehen sich hier schneller und uneingeschränkter als anderswo. Weil immer weniger Leute das Gefühl haben, an der Stadt teilzuhaben, wird London weniger vielfältig, weniger demokratisch und damit weniger aufregend. Das »Recht auf Stadt« geht hier zunehmend verloren – aus diesem Grund waren aufmerksame Beobachter von den Riots vom Sommer 2011 kaum überrascht.
Wer spricht den Londonern dieses »Recht auf Stadt« ab? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich mich in die Straßen Londons aufgemacht, habe mir verschiedene Quartiere angesehen, mit Anwohnern, Aktivisten, Immobilienhändlern, Ökonomen und Kulturschaffenden gesprochen, von Chelsea und Mayfair im Westen bis nach Tower Hamlets und ins Olympische Dorf im Osten. In einer Reihe von Rundgängen bin ich einigen Phänomenen nachgegangen, die in der Stadt derzeit für durchgreifende Veränderungen sorgen. Manche dieser Entwicklungen gehen zwei Jahrzehnte zurück, andere haben erst im neuen Millennium oder nach der Wirtschaftskrise von 2008 eingesetzt.
Der rote Faden, der sich quer durch die Stadt zieht, ist das Geld: Die urbane Entwicklung wird zunehmend dem Kapital übertragen, das ohne wirkungsvolle Schranken walten kann. London wird zu einer neoliberalen Stadt, die den Bürgerinnen und Bürgern das demokratische Mitspracherecht raubt und sich zu einer Investitionszone für das internationale Kapital formt. So kümmert sich die Weltstadt immer weniger um das Wohl der Gesamtbevölkerung und will stattdessen dem Kapital gefällig sein: Reichtum wird privilegiert, während die Ressourcen, die für die ärmsten Bürgerinnen und Bürger ausgegeben werden, laufend schrumpfen. Diese Neoliberalisierung ist durch die Austeritätspolitik noch verstärkt worden.
Gleichzeitig bringt die neoliberale Stadt den Widerstand hervor, der sich gegen diese Entwicklungen wehrt: Die Anwohner wollen einen demokratischen, vielseitigen Raum, in dem Normalverdiener leben können – und viele gehen für dieses Ziel auf die Straße, ziehen Kampagnen auf und besetzen Häuser. Um diese Londoner geht es hier im Buch genauso wie um die Kräfte des Kapitals, die ihnen die Stadt zu entreißen drohen.
Um etwas Ordnung in meine Rundgänge durch eine unordentliche Metropole zu bringen, ist das Buch geographisch und thematisch aufgeteilt: Jedes Kapitel befasst sich mit einer Gegend, in der ein bestimmtes Phänomen exemplarisch dargestellt werden kann – obwohl sich viele Entwicklungen in allen Stadtteilen abspielen. Wir beginnen in der City of London, deren Bedeutung für die Stadtentwicklung kaum überschätzt werden kann. Der Aufstieg des Londoner Finanzsektors zu einem der wichtigsten Hubs im globalen Kapitalismus hat nicht nur zu einer fatalen Abhängigkeit der britischen Wirtschaft vom Schicksal der Finanzinstitute geführt, die 2008 fast zu einem Totalschaden geführt hätte, sondern auch zu einem Hofieren des Geldes im Allgemeinen. Nirgendwo lässt sich dies besser beobachten als in Mayfair und anderen Luxusquartieren im Westen, wo sich Plutokraten aus der ganzen Welt ihre Parallelgesellschaft aufgebaut haben. Dieses Nobel-London bildet den Gegenstand des zweiten Kapitels. Die offensichtlichste Konsequenz, die der Zustrom von globalem Kapital für den Rest der Stadt hat, ist der dramatische Anstieg der Immobilienpreise, mit dessen Folgen wir uns anhand des...