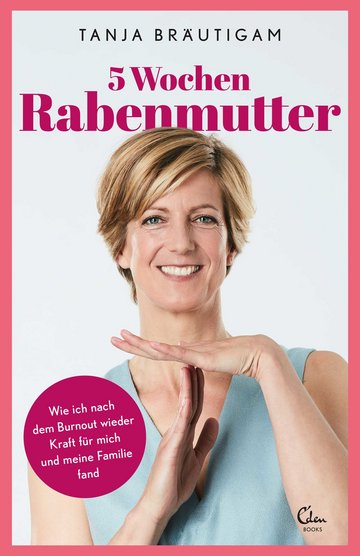Kapitel 2
Nichts geht mehr
Nun ist also eingetroffen, wovor ich immer so viel Respekt hatte. Ich erkenne mich nicht mehr wieder. Ich sitze in der Mama-Falle. Mein Sohn ist inzwischen 18 Monate, meine Tochter vier Jahre alt. Nach nun fast viereinhalb Jahren Windeln wechseln, 850 Mal Spülmaschine ein- und ausräumen, 1460 Nächten ohne durchzuschlafen, in der Summe, bei zwei Kindern, 15 Monaten stillen, zwanzig Monaten Schwangerschaft, über dreitausendmal Frühstück, Mittagessen oder Abendessen zubereiten und weit über 1.500 Abenden, die ich in den vergangenen viereinhalb Jahren zu Hause festsaß, bin ich unausgeglichen, über Monate niedergeschlagen, ohne Energie und Lebensfreude in mir.
Ich agiere rund um die Uhr als Mama und habe meine eigenen Bedürfnisse komplett aus den Augen verloren. Ich spüre mich nicht mehr. Ich fühle mich in meiner Rolle als Vollzeitmama lediglich als »Aufpasserin« und als »Putzfrau« ohne Selbstbewusstsein, bin gegenüber meinen Kindern und meinem Ehemann nur noch gereizt und kann mich selbst nicht mehr leiden.
Das kann der liebe Gott mir doch unmöglich mit meiner Aufgabe als Mama auf den Weg gegeben haben. Ich weiß wirklich nicht, wohin Gott mich führen möchte. Ich bin dafür auch nicht gläubig genug, aber wenn er weiterhin diese Richtung beibehält, dann schlage ich vor, er soll allein weitergehen.
In ihrem Buch Muscheln in meiner Hand stellt sich die Autorin Anne Morrow Lindbergh folgende Frage: »Wenn es die Aufgabe der Frau ist zu geben, so muss sie auch wiederbekommen. Aber wie?« Ihre Lösung scheint denkbar einfach: »Alleinsein«. Jeder Mensch, besonders jede Frau, sollte einmal im Jahr, einmal in der Woche, einmal am Tag allein sein.
Doch für mich – und wahrscheinlich auch für viele Frauen – scheint ein solches Vorhaben völlig unerreichbar. Es ist keine Kraft mehr vorhanden, nach Haushalt und Kindern auch nur eine Stunde Alleinsein sinnvoll zu nutzen. Dabei ist es doch Irrsinn. Jeder Arbeitnehmer erwartet einen freien Tag in der Woche und jährlichen Urlaub. Eigentlich sind wir Mütter und Hausfrauen die einzigen arbeitenden Menschen, die keine geregelte Freizeit haben.
Dann kommt der Zusammenbruch. Nervenzusammenbruch lautet die genaue Diagnose. Im Auto, vor meinen zwei Kindern, einfach so, nichts geht mehr. Ich will meine Tochter bei einem Freund abholen. Der Kleine ist natürlich dabei, weil mein Mann sich im Rahmen der Fußball-EM für drei Wochen in Polen aufhält. Ich schaffe es gerade noch, meine Tochter ins Auto zu verfrachten. Aber dann: Herzrasen, Tunnelblick, Verzweiflung. Mein Kopf sendet nur noch: Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mein Körper, mein Geist und auch meine Seele sind komplett aus der Balance.
Ein Freund ist Neurologe. Ich rufe ihn mit letzter Kraft an, und er schickt sofort ein Rezept für Tavor in unsere Apotheke. Tavor ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Benzodiazepine. Es wird als Beruhigungsmittel bei Angst- und Panikstörungen eingesetzt. Es ist eines der meistverordneten Psychopharmaka in Deutschland. Bei längerer Einnahme kann es abhängig machen. Ich schlucke es, um irgendwie wieder Luft zu bekommen.
Wie in Trance liege ich nun im Bett. Eine Nachbarin hat die Kinder übernommen, bis meine Mutter kommt, die bereits unterwegs ist. Das Mittel besitzt unter anderem auch eine sedierende und muskelrelaxierende Wirkung. Es haut mich komplett um. Ich gehöre zu den Menschen, die Medikamente nur im äußersten Notfall einnehmen. Vorher versuche ich, alle gängigen Hausmittel anzuwenden. Erst wenn keine Besserung eintritt, entscheide ich mich für die klassische Schulmedikation.
Meine beiden kleinen Mäuse sind total verwirrt, was mit Mama los ist. Meine Mutter kommt und meint, ich solle mich um der Kinder willen zusammenreißen. Mama, wenn du wüsstest, wie gern ich dies tun würde. Aber es geht nicht mehr. Ich schäme mich so sehr vor meinen Kindern. Ich bin an einem Punkt, an dem ich nie landen wollte. Ich möchte meinen Kindern ganz sicher nicht vermitteln, wie anstrengend das Leben ist. Aber im Augenblick ist es anstrengend. Mein Leben ist anstrengend und völlig aus den Fugen geraten. Lieber Gott, was soll ich bloß tun?
Einen Tag nach dem Zusammenbruch sitze ich beim Neurologen. Nach fünf Minuten ist für ihn klar, dass ich Antidepressiva nehmen soll. Nach nur fünf Minuten. Das menschliche Gehirn besitzt Schätzungen zufolge rund einhundert Milliarden Nervenzellen, welche durch etwa einhundert Billionen Synapsen eng miteinander verbunden sind. Das sind mehr als alle Atome im Weltall. Wie soll dann mal eben eine Handvoll Tabletten wieder Ordnung in meinem Gehirn schaffen?
Der Neurologe stellt keinerlei Fragen zu meinen Gedanken, meinen Ängsten, meinen Tätigkeiten, meinem familiären Hintergrund, meiner Ernährung, meinen sportlichen Betätigungen. Nur die Analyse: »Sie sind aktuell depressiv.« Ich sitze bei ihm im Zimmer, und alles in mir zieht sich zusammen. Ich habe solche Angst vor Psychopharmaka. Vor den Nebenwirkungen, vor dem, was die Tabletten im Körper anstellen, und davor, dass ich nichts mehr fühle.
Vor sechs Jahren habe ich eine ehemalige Kollegin in der geschlossenen Anstalt besucht. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Nicht ihren Anblick und nicht den der Menschen, die sich in der geschlossenen Anstalt aufgehalten haben. Sie war nicht mehr die Frau, die ich kannte. Vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln, aufgedunsen im Gesicht und kaum ansprechbar. Einige Menschen kauerten auf dem Boden, in Flurecken, andere sprachen mich wirr an, wieder andere waren an ihren Betten fixiert. Es war schlimmer als in jedem schlechten Film.
Für mich ist klar, wenn ich die Tabletten nehme, habe ich versagt. Keine Ahnung warum, aber es wehrt sich alles in mir. Vielleicht liegt es daran, dass es mir schwerfällt, mir Hilfe zu holen. Ich bin mit 1,89 Meter eine sehr große Frau. Durch meinen Sport, das Handballspielen, habe ich mit meiner Größe nie ein Problem gehabt. Allerdings hat die Größe früh dazu geführt, dass von mir immer verlangt worden ist, es allein zu schaffen. »Die Tanja ist groß genug, die kann das.« Die Begriffe »Hilfe bekommen« oder »Hilfe einfordern« gibt es in meinem Wortschatz nicht. Als großer Mensch wird man fast immer überfordert.
Unabhängig von meinem vielleicht falschen Verhaltensmuster können die Tabletten nicht die Lösung für mein Problem sein. Dann werde ich doch in ein paar Jahren wieder in dem gleichen Teufelskreis hängen. Wäre es auf der anderen Seite nicht toll, einfach wieder fröhlich zu sein? Wenn es doch so einfach wäre.
Meine Schwester Mara ist so lieb, mich mit den Kids bei sich aufzunehmen, bis mein Mann endlich nach Hause kommt. Selbst jetzt, als ich völlig am Boden liege und nicht in der Lage bin, mich um meine Kinder zu kümmern, ist es ihm nicht möglich, die Geschäftsreise abzubrechen. Wie kann das sein, dass Geld offenbar mehr zählt, als mir zu helfen? Wie ist das möglich? Wie weit sind wir gekommen in unserer Beziehung?
Zum Glück bin ich nicht allein, meine Schwester steht mir bei, meine Mama, mein Vater, meine Schwiegereltern, meine Freunde – alle sind für mich da. Alle auch mit einer anderen Meinung. Jeder redet auf mich ein und jeder ist geschockt, wenn ich von den vergangenen Monaten erzähle. Ich habe mich auf die Kinder gestürzt, mich um sie gekümmert, bei ihnen geschlafen und nichts mehr für mich gemacht. Ich habe keinerlei Zugang mehr zu mir. Eigentlich fühle ich mich genau so, als würde ich schon Antidepressiva nehmen. Ich stehe neben mir.
Abends liege ich mit meinen Kindern im Wohnzimmer meiner Schwester. Meine Tochter schläft auf dem Sofa, der Kleine und ich auf einer großen Matratze auf dem Fußboden. Mich packt eine unbeschreibliche Angst, dass ich es nicht schaffe, dass ich vollgepumpt mit Tabletten in der Psychiatrie lande. Mein ganzer Körper fängt an zu zittern, mein Herz rast, ich bekomme keine Luft mehr. Hilfe!
Mara hält mich ganz fest. Ich fühle, dass ich gleich zusammenbreche. Jetzt hat Mara genug. Sie ruft den Notarzt. Mitten in der Nacht werde ich ans EKG angeschlossen. Meine zwei Mäuse schlafen tief und fest und bekommen zum Glück nichts davon mit. Diagnose: Panikattacke.
Eine Panikattacke wird aus wissenschaftlicher Sicht als einzelnes, plötzlich und in der Regel nur einige Minuten anhaltendes Auftreten einer körperlichen und psychischen Alarmreaktion ohne objektiven äußeren Anlass bezeichnet. Herzrasen und Atemnot gehören bei einer Panikattacke zu den häufigsten Reaktionen. Umgangssprachlich erklärt ist die Angst innerhalb einer Panikattacke nichts anderes als eine Fehlinterpretation körperlicher Wahrnehmungen.
Der Rettungsdienst empfiehlt, Tavor einzunehmen und am besten zu versuchen zu schlafen. Ich bekomme noch vage mit, wie der Notarzt meiner Schwester erzählt, dass auch einer seiner besten Freunde im Augenblick mit solchen Attacken zu kämpfen hat. Das sei keine psychische Schwäche, sondern eine klare Reaktion des Körpers auf zu viel Stress. Aber ich weigere mich weiterhin, das Hammerzeug einzunehmen. Da muss ich jetzt so durch. Meine Schwester ist auf und an meiner Seite. Diese Angstattacke schaffen wir gemeinsam. Ohne Tavor. Sie hält mich einfach fest im Arm, die ganze Nacht, und ich beruhige mich wieder. Versuche tief ein- und auszuatmen, versuche, an die Kinder zu denken, versuche abzuschalten. Und irgendwann ist es geschafft. Ich schlafe. Ohne Tavor. Danke, Schwesterherz, du hast mir das Leben gerettet. Es fühlt sich wie ein kleiner Sieg an, dass die Angst vorübergeht. Dass sie nichts anrichten kann. Ein klitzekleiner Sieg.
Eine Woche noch, bis mein Mann wiederkommt. Eine...