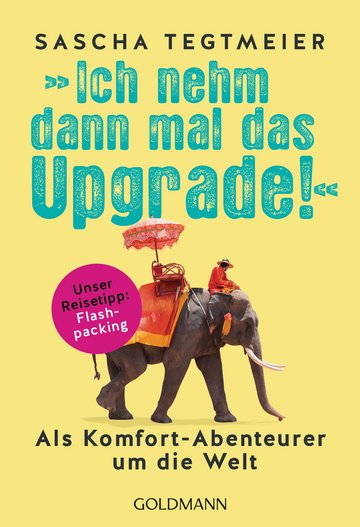Auf gar keinen Fall!
Paulinas Reaktion auf meinen Vorschlag, in Nepal wandern zu gehen, lässt wenig Interpretationsspielraum. Sie wischt mit der rechten Hand harsch durch die Luft, streicht mit der Linken ihr schwarzes Haar glatt, kneift die Augen zusammen und lehnt sich nicht ganz untheatralisch zurück. Selten sind Worte und Körpersprache eine so enge Verbindung eingegangen, wie an diesem Samstagnachmittag in einem Kreuzberger Café. Ich zücke möglichst lässig mein Smartphone, um einige Reiseblogger zu zitieren.
Als Argumentationshilfe sind diese Tagebuchschreiber im Netz ideal. Es muss ein Berufsethos geben, das besagt, dass in einem Reiseblog, jede noch so gottverdammte Gegend der Welt »atemberaubend« und für den Besucher »life changing« sein soll. Im Fall der von mir vorgeschlagenen zwölf zünftigen Tagesmärsche entlang des Annapurna-Gebirges kennt die Euphorie im Internet keine Grenzen. Die Menschen seien so unfassbar freundlich, die Landschaft ekstatisch schön und überhaupt: Es ist der H-I-M-A-L-A-Y-A, Baby! Außerdem kann man in einfachen Teahouses unterkommen, die wohl – und an der Stelle dachte ich, Paulina an Bord zu haben – auch über Duschen verfügen. Aber nichts kann sie angesichts der knapp zweiwöchigen Wanderung umstimmen. »No way«, sagt sie nun mit Nachdruck.
Meine Frau ist Mexikanerin – ein Volk, dem nicht nur Temperament, sondern auch Rigorosität nachgesagt wird. Ein Vorurteil, an dem etwas dran ist, wie Paulina an diesem Märznachmittag im Café »Goldmarie« unter Beweis stellt.
Wir sind dabei, unsere sechsmonatige Weltreise zu planen, von der wir seit Jahren an langen Arbeitstagen träumen. Die Aussicht auf eine Auszeit von unseren Jobs in der PR- und Werbebranche erfüllt uns mit Vorfreude. An diesem Nachmittag wird uns erst richtig bewusst, wie groß die Planungsaufgabe ist, die vor uns liegt. Das beginnt bei der Wohnung (untervermieten?), über den Job (kündigen?) bis hin zur Anschaffung einer wasserdichten Kamerahülle.
Wir blättern in der Broschüre vom Junge-Leute-Abenteuer-Reisebüro einige Straßen weiter. Als hätten wir das Wetter als Kontrast zu unseren tropischen Reisezielen bestellt, peitscht der Regen gegen die Fensterscheibe des Cafés. Und als hätten wir die anderen Gäste nur zu diesem Zweck gecastet, gucken sie alle gänzlich unexotisch und unabenteuerlich auf ihren Käse-Streuselkuchen. Einer lässt gerade seinen Cappuccino zurückgehen, weil ihm zu viel Schokopulver auf dem Milchschaum liegt.
Fünf Standardrouten des Around-the-World-Tickets werden in der Broschüre mit farbenfrohen Weltkarten vorgestellt. Diese Paketangebote von Flügen sollen sich besser verkaufen durch Namen wie »Sushi, Scheich, Riesenschlangen«, »Die Schnorchel Connection« oder »Bambus, Teebaum und Holz vor Onkel Toms Hütte«.
Wir wollen uns – inspiriert von »For Locos Only« – eine eigene Route für unsere Weltreise ab November zusammenstellen und verhandeln darüber nun im Stile von »Tausche Nepal gegen Myanmar« und »Wenn China, dann Cook Islands«. Jahrelang habe ich als Kind mit dickem Bleistiftstrich meine Wunschrouten in den Diercke-Weltatlas eingezeichnet, mir alle Inseln, Kontinente, Städte und Meeresstraßen eingeprägt. Und im Sommer ging es dann meist wieder nur an die Ostsee.
Während meine aktuellen Reiseplanungen also vor allem auf diesen Träumen der 80er-Jahre beruhen, ist Paulina besser auf die Realität vorbereitet: Sie weiß längst, dass man günstiger nach Fidschi kommt als zu der von mir präferierten Südseedestination Cook Islands.
Organisierte Mexikanerin trifft auf unstrukturierten Deutschen. Überhaupt fällt es Außenstehenden schwer, uns einzuordnen. Insbesondere im Ausland. Da ist dieser kräftige Mittdreißiger mit mitteleuropäischen Gesichtszügen, braunen Haaren, rotblondem Vollbart und der Körperlänge eines Latinos. Und da ist die etwas jüngere Frau, die als Vorbild für Disneys Pocahontas hätte dienen können: Die bronzefarbene Haut der mittelamerikanischen Ureinwohner vermischt sich mit dem Körperbau der südeuropäischen Eroberer. Dazu kommt, dass wir in einem babylonischen Mix miteinander sprechen: Unsere romantische Ausdrucksform ist Spanisch, denn in dieser Sprache haben wir uns bei einem Austauschsemester in Madrid 2002 kennengelernt. Deutsch bestimmt oftmals den Alltag (»Ich hab einen Strafzettel vom Ordnungsamt.«). Und falls die Situation stressig wird – und das passiert natürlich auf einer Weltreise immer mal wieder –, sprechen wir Englisch miteinander. Dann gibt es weniger Missverständnisse und bei auseinandergehenden Meinungen sind unsere verbalen Waffen gleich.
Es geht an jenem Samstag im März in dem Café jedoch nicht nur um unsere Reiseroute, sondern auch um die Frage: Wie wollen wir reisen? Ich habe meine Abenteuer mit 16, 20, 25 im Kopf, als ich durch Europa und Südamerika getingelt bin. Damals nach der Leitlinie: Krasse Sachen erleben, die sich später zu Hause in 1a-Abenteuergeschichten gießen lassen. Und auch mit Paulina bin ich vor mehr als zehn Jahren, jung und frisch verliebt, durch Mexiko gereist: hygienisch fragwürdige Strandhütten, Dschungelwanderung und ein Riesenfreiheitsglücksgefühl im Bauch.
Doch jetzt möchte Paulina mehr Komfort und Planbarkeit. Wir haben in den vergangenen Jahren viel gearbeitet und noch keine Kinder zu versorgen, da haben wir uns ein wanzenfreies Bett auf der Reise verdient, so ihre grobe Argumentationslinie. Was sie wohl auch meint: Wir sind zu alt für die klassischen Leiden des Backpackers.
»Du kannst ja gern bei 40 Grad auf Hostelsuche gehen, ich buche lieber übers Internet«, sagt sie. Hatte ich schon erwähnt, dass Mexikanerinnen rigoros sind?
Paulina rutscht und rubbelt mit dem Finger auf der Karte über das peruanische Hinterland und sagt angesichts der straßentechnisch besonders heiklen Strecke: »Von Cusco nach Lima können wir für wenig Geld fliegen und uns die 24 Stunden im Bus sparen.«
Erlaubt der Backpacker-Gott solch einen schmerzlosen Komfort überhaupt, frage ich mich. Kann man das eigentlich abends im Hostel erzählen, wenn die anderen Reisenden von der aufreibenden, aber auch irgendwie »total magischen« Busfahrt berichten?
Aber Paulina hat recht. Wir sind Mitte 30, seit acht Jahren verheiratet und wohl einfach aus dem Abenteureralter raus. Wer sich sein Ecksofa in die Wohnung liefern lässt, Versicherungen für alle Lebenslagen abgeschlossen hat und ein Dasein ohne Spülmaschine als möglich, aber sinnlos erachtet, kann so jemand – also ich – überhaupt noch als echter Backpacker reisen?
Kann man den Rollkoffer im Kopf noch gegen den Rucksack eintauschen?
Cut, Szenenwechsel. Wir springen neun Monate in die Zukunft und rund 11000 Kilometer gen Südwesten ins bolivianische Sucre – eine prächtige Kolonialstadt, die einiges über sich ergehen lassen musste. Das Sicht- beziehungsweise Hörbarste: Die meisten Besucher sprechen den Namen des Städtchens in den Anden falsch aus – so als wären französische und nicht spanische Kolonialherren für die herrlich weißgetünchten Gebäude in der Altstadt verantwortlich. Jedes Mal, wenn ein Besucher also von »Sücre« anstatt »Sucre« spricht, dreht sich vermutlich der Freiheitskämpfer und Namenspate Antonio José de Sucre in seinem Grab um.
Wohl wesentlich ärgerlicher für die heute 200000 Einwohner: Die Hauptstadt Boliviens hat im 19. Jahrhundert gewaltig an Bedeutung verloren. Weil der Abbau von Silber in der Region plötzlich nicht mehr so rundlief und Sucre mit seiner Lage auf 2800 Metern schon immer schwer zu erreichen war, ist die Regierung kurzerhand in die noch höher gelegene Stadt La Paz gezogen. Aber wer die Sucreños heute auf der Plaza mit der Ruhe eines sedierten Zen-Buddhisten flanieren sieht, gewinnt den Eindruck: Vielleicht sind sie hier auch ganz froh, dass alles genau so gekommen ist.
Eine der wichtigsten Einnahmequellen der regierungslosen Hauptstadt sind mittlerweile die Nordamerikaner und Europäer, die sich einige Wochen in der Stadt einquartieren, durch das UNESCO-Weltkulturerbe an kolonialen Gebäuden und unzähligen Kirchen vorbeischlendern und die Sprache lernen. Für im Vergleich zu Granada oder Barcelona sehr wenig Geld können Rucksackreisende die ansässigen Spanischlehrer in den Wahnsinn treiben.
Paulina und ich sind hier in Sucre, um uns von den Strapazen unserer Tour entlang der ausgetrockneten Uyuni-Salzseen zu erholen, die man angesichts der 4000 Meter Höhe wirklich als »atemberaubend« bezeichnen darf. Wir haben einige Nächte in der wohl beliebtesten Unterkunft der Stadt gebucht, im »Café Berlin«. Das ehemalige deutsch-bolivianische Kulturzentrum hat Klaus aus Karlsruhe mit seiner bolivianischen Frau zu einem Hostel für rund 80 Gäste umgebaut. Der blonde Mann Ende dreißig reiste vor einigen Jahren mit dem Rucksack durch Südamerika und kam nach Sucre, um Spanisch zu lernen. Aber nicht nur die koloniale Architektur mit Blick auf die umliegenden Berggipfel faszinierte ihn.
»Ich habe mich an einem meiner ersten Tage in eine Bolivianerin verliebt«, sagt er und erzählt mir bei einem Hefeweizen seine Geschichte in aller Kürze. Klaus blieb, heiratete, bekam Nachwuchs und nahm das große Projekt »Café Berlin« in Angriff.
In einem der geräumigen Innenhöfe seines Hostels lernen auch an diesem Tag die Gäste ihre Spanischvokabeln und essen Empanadas oder eben deutsche Currywurst. Hier hocken College-Mädels aus den USA, die ihre Hotpants aus der Heimat mit traditionellen Anden-Accessoires wie bunten Alpaka-Pullovern und den Indio-Bommelmützen kombinieren, die man noch von...