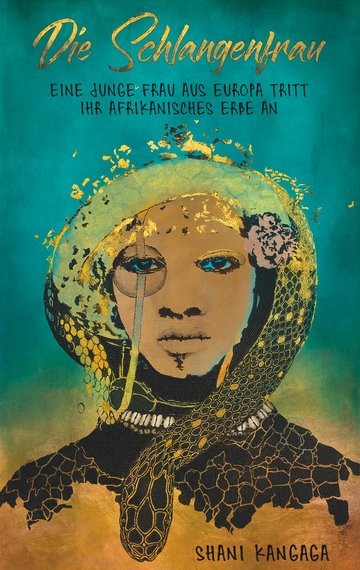Afrika
Kein Baum kann ohne Wurzeln stehen
(Kongo)
Ich startete meine Reise nach Afrika. Obwohl mich das Erlebnis mit Strong Bear gestärkt hatte, plagten mich Ängste und Zweifel. Ich wusste nicht, auf was ich mich wirklich einließ, nur, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Für meine Familie und Freunde war dies zum Teil schwer zu akzeptieren.
Drückende, schwüle Luft empfing mich in Mombasa und obwohl Trockenzeit war, atmete ich feuchte Luft ein. Eine angenehme salzige Brise Indischer Ozean streifte meine Haut und ließ meinen ganzen Körper prickeln.
Diese wunderschöne Küstenstadt war ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. In den zahlreichen schmalen Straßen tummelten sich Afrikaner, Inder und Araber. Hier herrschte reges Treiben. Sofort nach meiner Ankunft war ich von dieser neuen Umgebung verzaubert.
Eine Lebendigkeit pulsierte durch Mombasa, wie ich sie selten in Wien erlebt hatte. Ich fühlte mich rundum wohl und betrachtete aus meinem Taxi die vielen verschiedenen Menschengesichter.
Ich fuhr zu Freunden, die ich während meiner ersten Reise nach Kenia kennengelernt hatte. Sie lebten in Bamburi, einem kleinen, verschlafenen Dorf wenige Kilometer von Mombasa entfernt.
Die Freude war groß, als meine Freunde mich wiedersahen. In ihrem Zuhause fühlte ich mich sofort geborgen, und das, obwohl es alles andere als eine Luxusherberge war.
Das Haus war fensterlos, das Wellblechdach löcherig und der Putz an den Wänden war völlig hinüber. Er bröckelte unentwegt bei jedem Schritt.
Trotzdem zählte es zu den geräumigen Häusern, denn es besaß ein Schlafzimmer für die Eltern, ein Zimmer für die verheiratete Tochter samt Ehemann und Kind, je ein getrenntes Zimmer für die Frauen im Haus sowie für die Männer, eine Küche, einen großen Festraum, ein Esszimmer und … zumutbare Toiletten. Letzteres war und ist ein Geschenk in Afrika. Außerdem gab es vor dem Haus einen schönen Hof, in dem die Frauen im Freien das Mittagessen kochten.
Ich verschlang das köstliche afrikanische Essen, erzählte nach meiner Begrüßung alles Wichtige, was ich seit meinem letzten Besuch hier in Europa erlebt hatte, verteilte Geschenke und beschloss mich zurückzuziehen, auszuruhen und zu meditieren.
Normalerweise war ein einsames Plätzchen in Afrika nur im Traum möglich. Kaum wollte man alleine sein, fragte schon einer, ob man krank wäre. Doch diesmal hatte ich Glück.
Die Frauen mussten noch auf den Markt und die Männer gingen ihrer Wege. Allein Abude, die verheiratete Frau, blieb mit mir im Haus zurück, doch sie legte sich mit ihrem Kind nieder und machte anschließend ein Nickerchen. So hatte ich beinahe das ganze Haus für mich allein.
Den ganzen Nachmittag sprach ich meine Gebete. Ich dankte für all den Segen, den ich bisher erhalten hatte, und bat um Ausdauer und Kraft auf meinem Weg, der mir noch so unbekannt erschien. Die Lebensprüfung, die mir bevorstand, bereitete mir Angst. Ich hatte keine Erwartungen, doch ich wusste, dass etwas auf mich zukam.
Schon nach einem Monat in Kenia berichtete mir im Dorf ein junger Mann von einer Medizinfrau, die bereit sei, mich als ihre Schülerin aufzunehmen. Jener junge Mann wurde, während ich in Afrika lebte, mehr als ein guter Freund.
Er hieß Katana und war der Neffe eines verstorbenen, sehr bekannten Medizinmannes der Giriama, einer der vielen Stämme Kenias.
Oft saßen wir stundenlang am Meer und erzählten uns unsere Träume und Lebensziele. Wir gefielen uns. Katana war nur ein Jahr älter als ich. Er hatte einen schlanken, sehnigen Körper und sah sehr gut aus. Vor allem gefielen mir seine dunkelbraunen Augen, die mich neugierig beobachteten. Wenn Katana lachte, hielt er immer leicht eine Hand vor den Mund.
Auch wenn wir aus verschiedenen Kulturen kamen, hatten wir einen eigenen, speziellen Draht zueinander gefunden. Katana war offen und bereit, Neues zu lernen.
Er wuchs vollkommen traditionell auf. Seine Mutter hatte nach dem Tod ihres Ehemannes dessen Bruder geheiratet – keine Seltenheit in Kenia. Dies geschah deshalb, weil dieser nächste Verwandte sich am ehesten bereiterklärte, für die Kinder des Bruders zu sorgen.
Doch Katans Mutter war vom Pech verfolgt. Auch der Bruder starb. Und dessen Tod bedeutete, dass die Kinder auf verschiedene Familien verteilt wurden.
Katana selbst kam in eine einflussreiche muslimische Familie. Nachfahren der Swahili. Eine Ethnie Kenias, die wiederum aus zwei Ethnien, aus Arabern (Kaufleute und Aristokraten) und Einheimischen, entstanden ist.
Das Oberhaupt von Katanas Stieffamilie war ein Bürgermeister in der Region, wo mein Freund aufwuchs. In dieser Funktion besaß er sehr viel Macht. Er übernahm Katanas Schulkosten und behandelte ihn wie einen leiblichen Sohn.
Katana sprach fünf Sprachen fließend: Englisch, Suaheli und drei Bantudialekte. Seine aufmerksame Art half mir in der ersten Zeit hier in Afrika ganz besonders. Schnell hatte ich mich zurechtgefunden.
Außerdem fand ich durch Katana eine Medizinperson. Schließlich kannte er seit den Tagen am Strand meine Wünsche und Sehnsüchte. Ich wollte eine weise alte Frau werden, mein Leben als Medizinfrau führen, als Schamanin durch die Welten reisen und vieles mehr.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht sehr viel darüber, wie es ist, ein solches Leben auch zu führen, denn so einfach, wie ich mir das alles vorgestellt hatte, war es eben nicht. Ich träumte vor mich hin und baute mir ein Luftschloss.
Doch das Leben erzählte mir eine andere Geschichte.
Riesig freute ich mich über die Möglichkeit, die Schülerin einer Medizinfrau zu werden. Und meine Chancen standen sehr, sehr gut. Ganz anders als in den meisten Fällen.
Ethnologen, Wissenschaftler und Laien, also Menschen ohne Bezug zu Afrika oder Beziehungen, wie ich sie hatte, mussten monatelang warten, bis ein Stamm, die Ältesten und die Medizinpersonen sie als Schüler akzeptierten.
Dass in meinem Fall alles sehr schnell ging, war eine absolute Seltenheit.
Katana und ich fuhren schon am nächsten Tag in ein kleines Dorf nördlich von Mombasa. Dort angekommen, mussten wir eine halbe Stunde durch den Busch gehen. Zuerst durchquerten wir eine Anhäufung nebeneinandergebauter kleiner Häuser.
Überall lag Müll auf dem Boden, in dem sich allerlei Ungeziefer wie Kakerlaken tummelten. Anscheinend störte das die Einwohner nicht, denn sie kochten oder wuschen ihre Kleider neben dem Unrat. Selbst fett triefender Fisch wurde hier in heißen Pfannen gebacken und an Ort und Stelle verkauft.
Seltsamerweise ekelte mich dieser Anblick nicht. Ich sah nur in die Gesichter der Frauen und Männer und war ganz bezaubert von ihrer natürlichen Anmut und dem Respekt sich selbst und anderen gegenüber.
Katana und ich gingen weiter, bis wir nur noch von Bäumen und Sträuchern umgeben waren. Wilde Pflanzen bedeckten den Boden. Insekten schwirrten durch die Luft. Ich roch die Erde unter meinen Füßen. Sie fühlte sich frisch und lebendig an.
Der Ort, wo die Medizinfrau wohnte, war beinahe vollständig vom Busch eingehüllt. Als wir darauf zugingen, erspähte ich kleine traditionelle Häuser aus Lehm und Erde. Vor den Häusern gab es einen sandigen, kleinen und sauber gefegten Hof, auf dem Kinder umherrannten und mit den Hunden tollten. Hinter vielen Häusern befand sich ein kleines Maisfeld. Die Alten saßen auf Holzschemeln und unterhielten sich. Als sie uns sahen, streckten einige neugierig die Köpfe und erwiderten Katanas Gruß.
Wir bogen um eine Ecke auf einen eigentlich nicht vorhandenen Weg und gelangten zu einer kleinen Grünfläche, die kaum von Bäumen oder Schlingpflanzen überwuchert war. Ich hatte inzwischen komplett die Orientierung verloren. Meine Gefühle, all meine Emotionen überschlugen sich, so aufgeregt war ich.
Endlich wies Katana auf ein Haus und gab mir zu verstehen, dass dort die weise Frau lebe. Ihr Heim war aus Lehm und Erde errichtet, ein Palmenblätterdach schützte vor Wind und Wetter.
Als die spielenden Kinder vor dem Haus der Medizinfrau mich sahen, blickten sie mich erstaunt an, liefen dann auf mich zu und riefen immer wieder: »Mzungu, mzungu!«
»Was sagen die Kinder, ich verstehe sie nicht, Katana?«
»Sie sagen Weiße zu dir«.
Ich spürte einen kleinen Stich in meinem Herzen. Obwohl das Wort auch Europäerin bedeutete, wurde es auch für alle Weißen benutzt – ich hatte mich nie als europäische Weiße gesehen, sondern als eine süße Mischung aus Schwarz und Weiß: Ich war das Kind einer Slowenin und eines Kenianers.
Trotzdem lächelte ich die Kinder an, denn ihr strahlendes Lachen kam von Herzen.
Katana hatte mir zuvor erzählt, dass die Medizinfrau, die mich als ihre Schülerin akzeptieren wollte, Mama Fatuma hieß, dem Stamm der Kauma angehöre und mit einem Mann aus dem Digo-Tribe (Stamm der Digo) verheiratet sei.
Die vielen neuen...