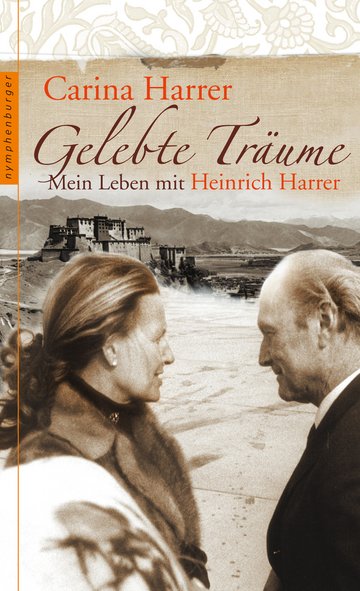Auf meine Art und Weise habe ich viel mehr erlebt als mein Mann. Das mag sehr gewagt klingen, fast vermessen, stimmt aber, wenn man meinen Lebensweg und den von Heinrich Harrer vergleicht. Heinrich hat in seinem Leben stets eine ganz klare Linie verfolgt. Auf die Welt gekommen ist er am 6. Juli 1912 in einem einfachen Bergarbeiterhaus in Obergossen in Kärnten, und als er zum ersten Mal bewusst seine Umwelt in Augenschein nahm, blickte er von seinem Elternhaus aus auf Berge, auf die Julischen Alpen. Sicher, dies ist eine wunderbare Bergkette, und dass Heinrichs erster entscheidender Gedanke meiner Ansicht nach der war, diese zu erklimmen, um mehr von der Welt zu erfahren, ist nur zu gut nachvollziehbar. Aber es gab bei ihm eben keinen anderen entscheidenden Gedanken.
Als ihm die Berge aus seiner unmittelbaren Umgebung nicht mehr genügten, musste ein größerer Berg aus seiner Kärntner Heimat kommen, dann die Eiger-Nordwand der Berner Alpen, bis er schließlich den Himalaya als Herausforderung im Blick hatte. Gut, nach der Expedition auf den Nanga Parbat kamen noch die prägenden Jahre in Tibet hinzu und die Forschungsreisen in Länder der verschiedensten Kontinente, aber immer ging es um einen Aufbruch, hinaus in die Welt, auf eine andere Ebene, auf eine andere Höhe.
Heinrich wusste stets, wie er leben wollte, was ihn interessierte und was er erforschen wollte. Nie wäre er von seinen Vorstellungen abgewichen. Nicht einmal für eine Frau. Eine solche Konsequenz hätte ich niemals an den Tag legen können, wenn ich auch heute, bei einem Rückblick auf mein Leben, zugeben muss, dass mir etwas mehr Zielbewusstsein ganz gut getan hätte.
Im Gegensatz zu meinem Mann bin ich ein Großstadtkind. Geboren wurde ich 1922 in Köln, mein Vater hieß Fritz Ferdinand Haarhaus, meine Mutter Trude, ihr Mädchenname lautete Dressel. In unserer Villa gab es Wasserleitungen und elektrischen Strom, wir mussten uns abends nicht um das spärliche Licht einer alten Petroleumlampe versammeln, um eine Handarbeit zu machen oder ein Buch zu lesen. Bei Heinrich spielte sich das gesamte Familienleben in dem einen Raum ab, in dem das Petroleumlicht stand. Mein Bruder, der auch Heinrich hieß, und ich, wir konnten uns in allen Zimmern unseres Elternhauses frei bewegen, auch wenn es draußen dunkel war, wir mussten einfach nur den Lichtschalter betätigen, und schon war es hell. Statt bunt bemalter Bauernmöbel und Holzstühle gab es in meiner großbürgerlichen Welt Polstersessel mit ausladenden Armlehnen, Glasvitrinen mit Unmengen von »gutem« Geschirr und kostbaren Gläsern. An den Wänden hingen Gemälde und auf den Anrichten hatten wertvolle Skulpturen oder Vasen ihren Platz gefunden. Es gab ein Musikzimmer mit einem Klavier und eine Bibliothek mit Regalen, die bis zur Decke reichten. Diese Bibliothek hatten bereits die Großeltern meines Vaters aufgebaut.
Alle in unserer Familie waren äußerst kunstsinnig und kunstverständig. Mein Onkel Eduard von der Heydt, ein Vetter meines Vaters, war Bankier und Kunstsammler. 1926 hatte er auf Anraten der russischen Malerin Marianne von Werefkin im Tessin, nahe bei Ascona, den Monte Verità erworben, auf dem sich eine lebensreformerische Künstlerkolonie ansiedelte. Nach dem Zweiten Weltkrieg überließ er seine Sammlung ostasiatischer Kunst dem Museum Rietberg in Zürich. Seine Gemäldesammlung mit deutschen Expressionisten (Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff) und französischen Impressionisten stiftete er dem Städtischen Museum in Wuppertal, das Anfang der Sechzigerjahre in »Von der Heydt-Museum« umbenannt wurde.
Onkel Eduard, den ich als sehr eigenwillig in Erinnerung habe, bekam ich nicht oft zu Gesicht. Er war damals mit Vera von Schwabach verheiratet, der Tochter eines Berliner Bankiers. Und da Eduard über sehr viel Geld verfügte, war es ihm möglich, Kunst zu sammeln. Er kaufte nicht nach bestimmten Kriterien, sondern einfach das, was ihm gefiel. Und genau auf diese Weise sammelte auch mein Mann: aus Freude, ganz nach dem Lustprinzip. Weder Onkel Eduard noch Heinrich trugen aus Gier, nur des Besitzes wegen Bilder oder Gegenstände zusammen. Das war auch etwas, was mir an diesen beiden Menschen sympathisch war. Onkel Eduard hat mich dann auch so fasziniert, dass ich später, nach dem Abitur, anfing, Kunstgeschichte zu studieren, dazu noch Philosophie. Vererbt hat er übrigens der Familie nichts von seinen Bildern und Kunstgegenständen, er wollte seine Sammlung geschlossen halten, was ich aber durchaus verständlich fand.
So leidenschaftlich mein Mann auch sammelte, war doch bei ihm im Gegensatz zu Onkel Eduard eine größere Gradlinigkeit zu erkennen. Heinrich brachte überwiegend Objekte asiatischen Ursprungs nach Hause, viele Dinge aus Tibet, mit denen er sich gezielt beschäftigte. Wenn ich ihn zum Beispiel fragte: »Wollen wir nicht nach München fahren, da wird gerade eine wunderbare Manet-Ausstellung gezeigt, die hätte ich zu gern gesehen?«, antwortete er: »Fahr doch bitte alleine. Warum soll ich mir das Zeug anschauen? Es interessiert mich nicht. Lieber lese ich in der Zeit etwas über Neuguinea, Borneo oder die Andamanen. Da kann ich mein Wissen sinnvoll vertiefen.« Natürlich kam er auch hin und wieder mit, aber er war schon sehr auf die Länder konzentriert, in die ihn seine Expeditionen gebracht hatten oder noch bringen sollten. Und natürlich war er durch seinen siebenjährigen Aufenthalt in Tibet besonders an der Kunst dieses Landes interessiert. Und genau das meinte ich damit, wenn ich anfangs behauptete, dass ich im Grunde mehr erlebt habe als Heinrich. Noch heute kann mich alles faszinieren. Da war ich vielseitiger, »Heini«, wie mein Mann von Freunden genannt wurde, nahm ich in dieser Hinsicht als viel eingegrenzter wahr. Dafür war er gründlich, was ich von mir nicht gerade behaupten kann. Ich wuchs eben in einem Elternhaus auf, in dem es viele Möglichkeiten gab. Da dies bei meinem Mann nicht der Fall war, richtete sich sein Interesse immer auf ganz bestimmte Aspekte, die er dann aber mit aller Konsequenz in Angriff nahm und ebenso stringent zu Ende führte. Wie gesagt: Nach dem ersten Berg kam der nächsthöhere und so ging es weiter bis zum höchsten.
Aber ich will noch etwas von mir erzählen, denn ich denke, dass mein biografischer Hintergrund auch etwas über Heinrich aussagt, zumindest darüber, warum zwei Menschen, die aus so unterschiedlichen Welten stammten, dennoch fast 50 Jahre zusammenblieben. Als Kind besaß ich alles, was man mit einer großbürgerlichen Herkunft verbindet: Kindermädchen, Klavierunterricht, gepflegte Umgangsformen – nur Berge gab es in meiner Welt keine. Und ich kann nicht behaupten, dass ich sie vermisst hätte. Der Bruder meiner Großmutter Emma Haarhaus – Emma war die Mutter meines Vaters – war im Krupp-Vorstand. Rudolf Hartwig war eng befreundet mit dem deutschen Industriellen Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Als Ingenieur soll er zusammen mit anderen Wissenschaftlern die »Dicke Bertha« konstruiert haben, ein 42-Zentimeter-Geschütz, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.
Als ich davon einmal einer Journalistin en passant erzählte, gab sie mich in ihrem Artikel als Nichte von Alfried Krupp aus, dem ältesten Sohn von Gustav und Bertha Krupp von Bohlen und Halbach. Nachträglich gab ich der Reporterin deutlich zu verstehen: »Die Krupps, die noch leben, werden sich sicher darüber beschweren, eine weitere Verwandte angedichtet zu bekommen.« Mir war das Ganze sehr unangenehm. Dass jemand bewusst eine solche Verfälschung vornimmt, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Doch zurück zu meiner Kindheit. Es war eine schöne Zeit, mit zwei sehr liebevollen, wenn auch in ihrer Art ganz unterschiedlichen Großmüttern, Emma Haarhaus und Katharina Dressel. Besonders Katharina, die Mutter meiner Mutter Trude, hatte ich sehr ins Herz geschlossen. Ama, wie ich sie stets nannte, besaß kostbarstes Porzellan. Ab und an passierte es und ich ließ aus Ungeschicklichkeit ein Stück auf den Boden fallen, das dann natürlich in tausend Scherben zerbrach – sehr zum Entsetzen meines Vaters, der sofort mit mir zu schimpfen anfing. Doch Ama meinte nur begütigend: »Lass deine Tochter. Ich konnte das Ding sowieso nicht leiden. Ich bin froh, dass ich es auf diese Weise los bin.« Natürlich wollte auch ich die väterliche Schimpftirade nicht einfach auf mir sitzen lassen. Zu meinem Vater gewandt meinte ich altklug: »Siehst du, die Ama mochte das Porzellan gar nicht.«
Für meinen Vater war alles nur eine Frage der Disziplin. Ständig hieß es: »Man muss diszipliniert sein, bei allen Dingen im Leben. Man muss das so sehen wie beim Autofahren – da darf man sich auch keinen Fehler leisten.« Und so versuchte er mich streng zu erziehen, was ihm aber letztlich nicht richtig gelang. Besonders viel Wert legte er auf Tischmanieren. Da ich keinen Fisch mochte, aber wahnsinnig gern Süßspeisen, erklärte er mir kategorisch, sobald er sah, dass ich meinen Fisch wieder einmal nicht essen wollte: »Wenn du den Fisch nicht isst, bekommst du auch keinen Nachtisch!« Ich kaute dann so lange auf dem ungeliebten Fisch herum, bis ich ihn hinten in den Backentaschen deponiert hatte. Das Dessert habe ich dann am Fisch vorbei hinuntergeschluckt – und das Zusammengekaute im Nachhinein später heimlich ausgespuckt.
Eines Tages kam ich auf die Idee, ich müsste unbedingt reiten lernen, Pferde fand ich einfach zu schön. Also ging ich zu meinem Vater, der daraufhin nur meinte: »Gut, du darfst Reitunterricht nehmen, aber eines sage ich dir gleich, deine Reitstiefel werden nicht von unseren Hausangestellten geputzt, die machst du selbst sauber.« Das alles sind vielleicht nur Kleinigkeiten, die aber zeigen, dass er eine ganz bestimmte Einstellung zum Leben hatte.
...