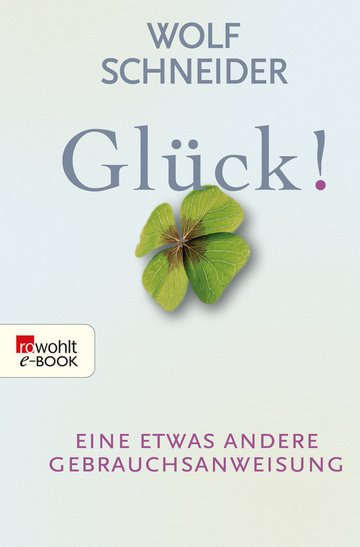2
Macht Geld glücklich?
Wann sitzt man schon mit einem leibhaftigen deutschen Milliardär an einem Tisch und sieht ihm beim Geldverdienen zu? Ich hatte die Chance vor ein paar Jahren in Madrid, und der Eindruck war nachhaltig.
Seine Frau, vom verspäteten Flug erschöpft, verlangte nach Champagner. Ihr Mann, auf fünf Milliarden Euro geschätzt, studierte die Weinkarte und sprach die goldenen Sätze: «Champagner kostet fünfmal so viel wie spanischer Sekt. Er kann unmöglich fünfmal so gut sein. Wir nehmen spanischen Sekt.» Zu diesem erstaunlichen Tischgespräch drängen sich vier Gedanken auf:
1. Die Entscheidung des Milliardärs war rechnerisch durchaus vernünftig.
2. Unfehlbar provoziert sie die Großmutter-Weisheit «Seht ihr – so kommt man zu Geld!» Doch eine Weisheit ist das nicht. So bringt man es nämlich allenfalls zu einem Bausparhäuschen. Wenn das beispielsweise 300 000 Euro kosten würde, ließen sich für fünf Milliarden mehr als 16 000 solcher Häuschen errichten; und nicht einmal Großmütter würden behaupten, dass die allesamt aus Champagnerverzicht finanziert werden könnten. Zu Milliarden bringt man es niemals durch Sparsamkeit – sondern durch glückliche Umstände und den Riecher für sie, durch Riskieren und Investieren, durch Habgier und Brutalität.
3. Überdies ist die Korrektheit des Sektvergleichs höchst vordergründig. Denn angenommen, der Milliardär hätte damit 50 Euro eingespart, so hätte es sich um den einhundertmillionsten Teil seines Vermögens gehandelt – so, als packte ihn der Ehrgeiz, den Preis für eine Fünf-Millionen-Villa um fünf Cent zu drücken. Wenn es ihm jedoch gelänge, Tag für Tag bis an sein Lebensende 50 Euro auf die Seite zu legen, so würde er 273 972 Jahre leben müssen, um fünf Milliarden aufzuhäufen. Anders gerechnet: Bei einer Verzinsung mit nur fünf Prozent würden die fünf Milliarden jährlich 250 Millionen erbringen, das hieße 685 000 Euro pro Tag oder 50 Euro in ebenjenen sechs Sekunden, die das Lob des spanischen Sekts ungefähr gedauert hat.
Die 50 Euro sind also das, was man in der Mathematik eine zu vernachlässigende Größe nennt. Sich von einer solchen die Wahrung oder Mehrung eines Milliardenvermögens zu versprechen, ist etwa so sinnvoll, wie es die Absicht wäre, den Bodensee zu süßen, indem man ein Stück Würfelzucker in ihn würfe.
4. Warum dann, um Himmels willen, die Aktion spanischer Sekt, die die Mathematik bis zum Unsinn überreizte, die Ehefrau düpierte und dem Gast die Sprache verschlug? Weil man Milliardär nur wird, wenn man ein Besessener des Geldes ist; wenn man ein irrationales, ein erotisches, ein gefräßiges Verhältnis zu ihm hat; wenn man 50 Euro so wenig missen will wie der Sultan auch nur eine seiner hundert Haremsdamen. Auf ihre Mitmenschen wirken Milliardäre folglich nicht sehr angenehm.
Doch fehlt die Antwort auf die Frage: Macht das viele Geld wenigstens sie selber glücklich? Einerseits nein: Beim verweigerten Champagner zahlen sie den Preis für die Zwangsvorstellung, die sie in keiner Sekunde ihres Lebens loslässt: Geld ist Gott! Diese Gesinnung hat sie reich gemacht, und nun siegt sie über alle Lebenskunst, alle Lebensart, allen Sinn für Proportionen und das kleine Einmaleins. Andrerseits ja: Denn Geld demonstriert Lebenserfolg, Geld heißt Macht – und Macht zu haben ist, traurig zu sagen, eines der höchsten Glücksgefühle (Kapitel 18). Deshalb finden Leute wie Rupert Murdoch, George Soros, Bill Gates es so dringend, weitere Milliarden heranzuschaufeln.
Reichtum gleich Macht: Entspricht dies der populären Vorstellung? Die ist eher als mit dem Geldscheffeln mit dem Geldausgeben verbunden – mit der Fähigkeit und mit der Lust, sich Luxus zu leisten, all das, wovon die meisten nur träumen: drei Villen, vier Autos, eine Yacht, Weltreisen erster Klasse und dabei nie ein sorgenvoller Blick aufs Konto. Erst von da an abwärts wird die Frage, ob Geld glücklich macht, wirklich interessant.
Unstrittig unter Psychologen ist nur eine höchst indirekte Art des Glücks am Geld: jene, die in der Abwesenheit von Unglück besteht. Es ist schön, nicht hungern zu müssen, nicht zu frieren, eine saubere, regenfeste Wohnung zu haben und für jede Krankheit einen Arzt zu finden. Aber wer in Mitteleuropa würde solche Grundbefriedigungen als «Glück» einstufen? Er müsste schon zuvor durch die Slums von Kalkutta gestreift sein, um seinen Wohlstand zu genießen – oder sich lebhaft an Phasen der Not im eigenen Leben erinnern. Doch da sind wir mitten in einem Wald von Problemen.
Zum Ersten: Ist es vernünftig, ist es vermittelbar, das Fehlen von Unglück mit dem Etikett «Glück» zu versehen? Empfinden wir irgendetwas dabei? Und doch scheint es, als sei eben dies die häufigste Annäherung ans Wohlbefinden: dass kein Leiden uns plagt.
Dies führt zur zweiten Schlüsselfrage: Haben Menschen mit einer lebendigen Erinnerung an Krankheit, Zwang und Not vielleicht eine höhere Chance, sich des Wohlstands, der Freiheit, der Gesundheit zu erfreuen als solche, denen es immer gut gegangen ist? Kann die Freuden voll nur der ausschöpfen, der die Leiden kennt? Die Butter dick aufs Brot zu streichen und nach Belieben ein heißes Bad zu nehmen ist für viele von der langsam wegsterbenden Generation der Weltkriegsteilnehmer immer noch ein Hochgenuss; Jüngere haben davon keine Vorstellung mehr (wie schön), und als Glücksquell stehen ihnen (wie schade) Bad und Butter einfach nicht mehr zur Verfügung. Oder: Hatte ein Schweizer je die Möglichkeit, seine Freiheit so zu genießen, wie Millionen Bürger der DDR die ihre genossen haben, damals, 1989, in den Tagen nach dem Fall der Mauer?
Solches Glück ist also ein Kontrast-Erlebnis, nur eines von vielen: Denn der Gegensatz und ein frisches Gefühl für ihn gehören zu fast jedem Lebensgenuss, Kapitel 10 wird es demonstrieren. Das Geld macht aus dieser zwiespältigen Einsicht ein hochpolitisches Dilemma: Als reich empfindet sich ja nur, wer entweder mehr davon besitzt als früher – oder mehr als jene Zeitgenossen, an denen jeder sich unwillkürlich und fast unentrinnbar misst: Nachbarn, Freunde, Kollegen, Konkurrenten.
Mehr als früher: Das wiederum wird uns nur dann zum Erlebnis, wenn sich der Aufschwung in Riesenschritten vollzieht. Dem einzelnen Glückskind mag das gelingen; eine ganze Volkswirtschaft kann nur im Extremfall ein Tempo vorlegen, das ein kollektives Wohlgefühl begünstigt: die deutsche in den fünfziger Jahren beispielsweise – aber dieses «Wirtschaftswunder» geschah auf der Basis einer vorangegangenen Katastrophe. Im Abendland hat sich die Kaufkraft des Durchschnittsbürgers seit 1945 verdrei- oder vervierfacht, aber niemand behauptet, damit wäre eine Verdreifachung, ja auch nur eine spürbare Steigerung des durchschnittlichen Glücksempfindens einhergegangen.
Immer präsent dagegen und politisch viel brisanter ist der unvermeidliche horizontale Vergleich: der mit den Nachbarn, den Kollegen. Er ist eine Urtatsache des menschlichen Zusammenlebens, und er setzt einen unheimlichen Mechanismus in Gang: Der steigende Wohlstand aller hebt das Wohlbefinden nicht. Die Cornell-Universität im Staat New York hat dieses Grundgesetz des sozialen Wohlbefindens 2003 in einem Experiment erhärtet: Würden die Testpersonen lieber 100 000 Dollar im Jahr verdienen, wenn alle Vergleichspersonen nur 80 000 bekämen – oder 150 000, also 50 000 mehr, wenn die anderen es auf 200 000 brächten? Die Mehrzahl entschied sich für den ersten Weg: Lieber verzichteten sie auf 50 000 Dollar, als unter Reicheren der Ärmere zu sein.
Da ist es, das «Wohlstandsparadox», die Hedonic Treadmill, wie die amerikanischen Sozialforscher sagen, die Tretmühle der Lebenszufriedenheit: Weil einer sich nur dann wohlfühlt, wenn er mindestens so viel verdient wie die, mit denen er sich vergleicht, muss er umso heftiger in die Mühle treten, je wohlhabender die anderen werden. Das Wirtschaftswachstum, das die meisten Staaten als ihr Lebenselixier betrachten, trägt also zum Ideal des «größten Glücks der größten Zahl» überhaupt nichts bei (mehr über dieses Staatsziel in Kapitel 30).
Wachstum ist willkommen, solange eine Gesellschaft noch unterhalb der Armutsschwelle lebt; Wachstum ist wohl auch nötig, damit eine Volkswirtschaft sich in der globalisierten Welt behaupten kann; mit der Zufriedenheit der Bürger hat weiteres Wachstum in der Wohlstandsgesellschaft nichts zu tun. Doch die Volkswirtschaft, sagt der Harvard-Psychologe Daniel Gilbert, «kann nur dann gedeihen, wenn die Leute fälschlicherweise glauben, dass die Produktion von Wohlstand sie glücklich macht».
Zusätzlich gerät das Hamsterrad dadurch in Bewegung, dass bei fast allen Menschen im Gleichschritt mit der Vermehrung ihres Einkommens ihre Ansprüche steigen – bei vielen bis zu dem Grade, dass sie an eine permanente Ratenzahlung gekettet sind, nur später für eine schönere Couch, ein schickeres Auto als früher. In den fünfziger Jahren, ja: Da fand die deutsche Familie es selbstverständlich, dass sie sich keine Italien-Reise leisten konnte, wenn sie schon für ein Auto bezahlte, und keinen Fernsehapparat, bis der Kühlschrank abgestottert war. Heute lächeln wir darüber....