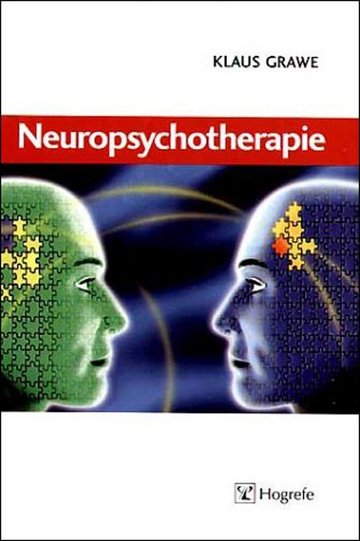3 Neuronale Korrelate psychischer Störungen (S. 142-143)
3.1 Was kann man heute schon über neuronale Korrelate psychischer Störungen aussagen?
Wir können auf Grund der in Kapitel 2 berichteten Befunde davon ausgehen, dass den differenzierten Facetten unseres Erlebens und Verhaltens ebenso differenzierte und damit korrelierte Facetten im neuronalen Geschehen zu Grunde liegen. Das Erleben und Verhalten ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Das gilt auch für Menschen, die psychische Störungen entwickelt haben und es gilt auch für die Störungen selbst. Zwei depressive Menschen müssen nicht sehr viel miteinander gemein haben. Das gilt auch, wenn sie z. B. den gleichen Testwert im Beck-Depressionsfragebogen haben und wenn sie beide die Kriterien für die Diagnose „Majore Depression" im DSM-IV erfüllen. Ihre Depression kann völlig unterschiedlich aussehen. Bei dem einen kann sie mit etlichen weiteren Störungen einhergehen, bei dem anderen auf die Hauptsymptome einer Depression beschränkt sein. Bei dem einen kann es sich um einen rechthaberischen, aufbrausenden, bei dem anderen um einen geduldigen und sanftmütigen Menschen handeln. Wie wahrscheinlich ist es, wenn wir die Hirnaktivität dieser beiden Menschen „im Ruhezustand" durch einen Scanner sichtbar machen, dass wir miteinander übereinstimmende Bilder erhielten? Das wäre höchst unwahrscheinlich. Das gemeinsame Label Depression und die Tatsache, dass man das Gehirn bei beiden ohne besondere Beeinflussung aufgenommen hat, ist eine recht schwache Gemeinsamkeit zwischen zwei Menschen. Wenn wir von zwei Depressiven ein fMRI oder ein PET machen, können wir nach dieser Überlegung realistischerweise nicht erwarten, dass die Hirnaktivität beider viel miteinander gemein hat. Noch mehr gilt das, wenn der eine Depressive in New York und der andere in Bern untersucht wurde. Die Scanner, die Methoden, mit denen die Aufnahmen aufbereitet werden, die Kompetenz und Erfahrung der Untersucher, die zeitlichen, räumlichen, interpersonellen und bedeutungsmäßigen Bedingungen, unter denen die Aufnahmen gemacht werden, – das alles kann sich an beiden Orten unterscheiden und Einfluss darauf nehmen, was die einen und die anderen Untersucher darüber berichten, was sie über die Hirnaktivität von Depressiven herausgefunden haben.
Wir werden daher im gegenwärtigen Stadium nicht erwarten können, dass verschiedene Untersuchergruppen, wenn sie das neuronale Geschehen bei Patienten mit einer bestimmten psychischen Störung untersuchen, zu ganz übereinstimmenden Ergebnissen gelangen. Wir werden schon zufrieden damit sein müssen, wenn wir sich wiederholende und bestätigende Gemeinsamkeiten in ihren Ergebnisaussagen finden. Das gilt umso mehr, als die untersuchten Stichproben wegen des hohen Untersuchungsaufwandes bisher zum Teil sehr klein sind. Da fällt die Individualität des einzelnen Patienten mehr ins Gewicht als bei sehr großen Stichproben. Hinzu kommt, dass die Diagnosekriterien im DSM und der ICD strikt deskriptiv sind. In sie ist zwar viel Expertenwissen eingegangen, aber letztlich beruhen sie auf Konventionen. Wir können nicht davon ausgehen, dass diesen Konventionen Krankheitsbilder mit gleicher Ätiologie entsprechen. Wenn wir psychische Störungen nach gemeinsamer Dieser Weg ist deshalb vorerst aufgegeben worden, weil die ätiologischen Vorstellungen (psychoanalytische, lerntheoretische usw.) zu unterschiedlich waren, als dass man sich auf etwas Gemeinsames hätte einigen können.
Es könnte sich aber eine neue Lage ergeben, wenn man Störungen nach ihrer gemeinsamen neuronalen Grundlage definiert. Wir kämen dann vielleicht mit der Zeit zu funktionalen Definitionen und über sie schließlich vielleicht sogar zu ätiologischen Definitionen. Die beobachtbaren Symptome im Erleben und Verhalten wären dann Ausgangspunkte für den diagnostischen Prozess, die eigentliche Grundlage für die Diagnosestellung wären aber die zu Grunde liegenden neuronalen Prozesse und Strukturen. Die nachfolgend berichteten Ergebnisse zu den neuronalen Korrelaten von fünf psychischen Störungen: der Depression, der Posttraumatischen Belastungsstörung, der Generalisierten Angststörung, der Panikstörung und der Zwangsstörung geben uns einige Hinweise, dass eine Neuabgrenzung von Subgruppen innerhalb der einzelnen Störungskategorien nach neuronalen Kriterien durchaus nützlich sein und in absehbarer Zeit realisiert werden könnte. Sie würden dann die bisherige relativ grobe deskriptive Unterteilung auf phänomenologischer Basis präzisierend ergänzen, in manchen Fällen vielleicht sogar längerfristig ersetzen. Wir werden auch Hinweise darauf erhalten, dass neuronale Merkmale bei einigen Störungen mit einiger Wahrscheinlichkeit zur Grundlage neuer differenzieller Indikationen werden könnten. Soweit sind wir aber noch nicht. Vorerst muss die Forschung und müssen auch wir von den vorhandenen Störungskategorien ausgehen. Mein nachfolgender Überblick orientiert sich also an den heute üblichen Störungskategorien. Ich habe diese Vorüberlegung vorangestellt, um realistische Erwartungen zu wecken, was wir erwarten können, wenn wir auf Grund der heutigen diagnostischen Abgrenzungen Aussagen über die neuronalen Korrelate der einzelnen psychischen Störungen zu machen versuchen. Die Forschung dazu ist seit etwa zehn Jahren im Gange. Für die meisten Störungen, die in der psychotherapeutischen Praxis besonders oft vorkommen, liegen erst wenige Untersuchungen vor. Deren Ergebnisse können aus den gerade genannten Gründen nur als erste Hinweise, aber noch nicht als gesicherte Fakten aufgefasst werden.