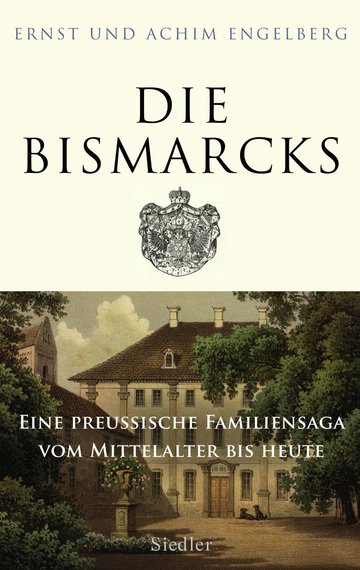Leseprobe Stendaler Patrizier