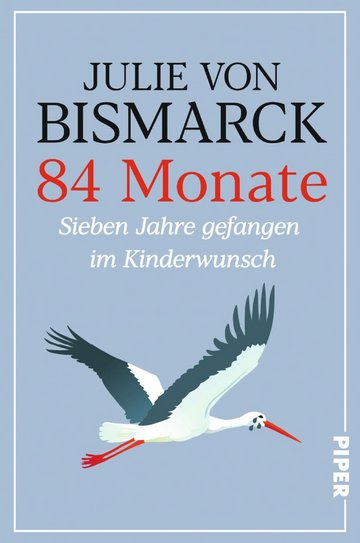1. Kapitel
Ich sehe zu, wie sich mein Blut in der Toilette verteilt. Hellrote Muster bilden sich, die zu ständig wechselnden Formen verschwimmen. Da ist ein Engel. Ein Engel aus Blut. Meinem Blut. Johns Blut. Vielleicht sind es auch nur die Flügel eines Engels. Dann könnten es ebenso gut die Flügel eines Vogels sein, schwer zu sagen. Mein Blut verläuft im Wasser, und ich starre gebannt und wie aus weiter Ferne auf die feinen roten Linien, die dort schwimmen. Wie ein Mandala, denke ich, diese Sandbilder, die buddhistische Mönche in wochenlanger Arbeit erschaffen, nur um sie dann in einem Ritual zusammenzufegen und in einen Fluss zu streuen. Als Symbol für die Vergänglichkeit. Meine Mandalas bestehen aus Blut statt aus Sand. Und ihre Zerstörung ist nicht meine Entscheidung, aber sie erfüllt ihren Zweck: Sie erinnert mich jeden Monat wieder daran, wie vergänglich all meine Mühen sind.
Ich brauche vier Wochen für ein solches Mandala. Dann kommt die Blutung wie ein böser Drache und fegt mein Bild mit einem einzigen Schlag des gezackten Schwanzes zusammen. Statt in einem Fluss enden die Überreste meiner Mandalas in der Toilette – aber Wasser ist Wasser, nehme ich an. Wie aus weiter Ferne starre ich unablässig auf die roten Muster. Es fühlt sich an, als hätte ich meinen Körper verlassen und als wäre das Blut dort auch nur noch Materie. Ich fühle nichts. Einfach nichts. Nur eine vollkommene Leere, die sich in meinem gesamten Körper ausgebreitet hat. Es fühlt sich an, als sei ich gelähmt, aber ich bin nicht gelähmt, nur leer. Diesmal scheint die Leere auch noch meine Kraft verdrängt zu haben, denn in meinen Muskeln ist nichts mehr. Ich versuche, den Arm anzuspannen, aber es ist einfach nichts mehr da. Vielleicht ist die Grenze überschritten. Vielleicht kann ich nicht mehr. Nicht mehr hoffen, nicht mehr bangen, nicht mehr leiden.
Heute ist es das 84. Mal, dass ich statt eines positiven Schwangerschaftstests einen Klumpen blutigen Toilettenpapiers in der Hand halte. Es ist der 84. Monat, in dem ich versucht habe, schwanger zu werden. Es ist das 84. Mandala, das von der Menstruation in die Toilette befördert wurde. Es ist das 84. Mal, dass sich größte Zuversicht und Hoffnung in größter Trauer und Verzweiflung auflösen. Sieben Jahre meines Lebens, die ich dem Wunsch nach einem Kind untergeordnet habe. Vergebens.
Ich lasse den blutigen Klumpen in meiner Hand zu den hellroten Mustern ins Wasser sinken und betätige die Spülung. Das Wasser rauscht, und die Überreste meiner letzten Anstrengungen verschwinden gemeinsam mit den letzten Resten meiner Hoffnung in der Kanalisation. Auch diese Embryonen werden im Chemiebad irgendeiner Kläranlage zersetzt werden. Die beiden perfekten Blastozysten aus meinem letzten IVF-Versuch.
Sekunden später ist das Wasser in der Toilette wieder so klar, als wäre es nie anders gewesen. Als wären dort nicht gerade vier Wochen meines Lebens verschwunden. Oder sieben Jahre.
Mir ist schlecht. Ich klammere mich mit weißen Knöcheln an das Waschbecken und versuche zu atmen. Mit der linken Hand drehe ich das kalte Wasser auf und wasche mir das Gesicht. Meine Arme zittern, das Handtuch hängt in unerreichbarer Ferne. Ich gebe auf und trockne mein Gesicht an meinem T-Shirt ab. Im Spiegel erscheint mein grün, blau, gelb und violett verfärbter Bauch. Das, was übrig bleibt von meinen Mühen. Keine Schwangerschaft. Kein Baby. Jeden Tag zwei bis vier Spritzen, wochenlang.
Mechanisch öffne ich die Schublade mit den Tampons und löse meinen Klammergriff vom Waschbecken. Als ich mich hinüberbeuge, sehe ich kurz mein Gesicht. Erschüttert wende ich den Blick ab und denke an meine preußischen Vorfahren. Ich muss mich zusammenreißen. »Das Leben geht weiter«, murmele ich mein Mantra, »es geht immer weiter, jetzt nur nicht zusammenbrechen.« Ich taumele aus dem Badezimmer ins Esszimmer.
Starken Kaffee kochen und dann etwas tun, ablenken, nicht darüber nachdenken. Etwas arbeiten, mit den Hunden rausgehen, irgendwann Abendessen machen, weil John nach Hause kommt …
Der Gedanke trifft mich wie ein Schlag. John wird nach Hause kommen. John, der immer noch daran glaubt, dass es diesmal geklappt hat. John, der noch glaubt, dass ich schwanger bin. John, der wie ich seit sieben Jahren alles diesem einen Wunsch unterordnet …
Jemand rammt mir ein Messer in Unterleib und Magen. Stöhnend krümme ich mich zusammen und greife nach der Tischkante. Preußen. Disziplin. Zusammenreißen.
Ich frage mich verzweifelt, was meine Großmutter getan hätte in einer solchen Situation. Sie hätte Haltung bewahrt und sich nichts anmerken lassen, denke ich – und richte mich von Schmerzen gepeinigt auf.
Da trifft mein Blick den meines Hundes, der mich aus seinen klugen braunen Augen von seinem Platz aus ansieht. Sein Blick ist so voller Trauer, Sorge und Kummer, dass Preußen mir nicht mehr helfen kann. Ich breche neben ihm zusammen, vergrabe mein Gesicht in seinem weichen Fell und weine bitterlich.
Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr.
Ich wache davon auf, dass mein Hund mir über die Hände leckt. Für einen Moment bin ich mir nicht sicher, was passiert ist, doch dann spüre ich die Krämpfe in meinem Unterleib toben und den schmerzenden Hohlraum in meiner Seele. Meine Augen brennen, mein Kopf hämmert, und ich bin unendlich müde. So müde, dass es sich anfühlt, als würden meine Arme und Beine jemand anderem gehören. Ich schiebe meine Hände unter die Vorderbeine meines alten Gefährten, in seine »Achselhöhlen«, wie John es nennt, um etwas zu fühlen, um mich zu vergewissern, dass es meine eigenen Hände sind.
Wie lange liege ich schon hier? Wie spät ist es? Ich müsste aufstehen und nachsehen, aber ich bin zu erschöpft. Es spielt auch keine Rolle mehr, es ist wieder alles umsonst gewesen. Auch diesmal, alles umsonst.
»Sie können jederzeit wieder schwanger werden!«, hatte der Arzt gesagt. Damals, einige Tage nach dem einen Tag. »Sie können jederzeit wieder schwanger werden!«
Ich hatte ihm geglaubt. In jedem Zyklus wieder. Auch in diesem letzten. Die Spritzen, die Hormone, die Nebenwirkungen, die Operationen, die Vollnarkosen, die brutalen Schmerzen. Die Hoffnung, diese immer wieder aufkommende riesige Hoffnung. Seit sieben Jahren hoffen, seit sieben Jahren zusehen, wie die Hoffnung zerstört wird, neue Hoffnung aufbauen. Immer und immer wieder. Immer umsonst. Sie können jederzeit wieder schwanger werden …
Und nun liege ich hier und blute und blute und bin es nicht. Wieder nicht. Noch ein Mandala, welches nach wochenlanger Arbeit in einem kurzen Moment zerstört wurde und verschwunden ist.
Vergänglichkeit. Die letzten 83 Male habe ich mich immer wieder aufgerafft und wieder von vorn angefangen. Heute scheint irgendetwas anders zu sein. Ich fühle mich so schwach und erschöpft wie an dem Tag damals. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich es schaffen soll aufzustehen. Ich bin froh, die Wärme der Hundearme auf meinen Händen zu fühlen, vertraut und lebendig – und nicht allein zu sein.
Mein Hund ist da, Henry. So, wie er in den letzten sieben Jahren immer da gewesen ist. Mein treuester und bester Freund. Vielleicht der Einzige, der dieses Wort verdient. Außer John natürlich. Ich ziehe meine rechte Hand aus seiner Achselhöhle und streiche ihm über das von meinen Tränen durchnässte Fell. Tausende weiche schwarze Haare bleiben an meiner Hand kleben. Wie oft ich mir den Kopf darüber zerbrochen habe, wie ich diese Haare wohl vom Mund meines Kindes fernhalten könnte …
Des Kindes, das nicht da ist.
Ich denke an meine Kindheit. An die Sommer, die erfüllt waren von dem Geruch frischen Heus, strahlend blauen Himmeln und weißen Wolken, dem leuchtenden Rot des Mohns und dem schönsten Kornblumenblau an den Feldrändern; dem betörenden Duft der wilden Kamille, von Blumenwiesen, Schmetterlingen und jubilierenden Lerchen, die so hoch in den sommerlichen Lüften schwebten, dass man nur ihren Gesang hörte und sie erst nach einigem Suchen als winzige Punkte in den weißblauen Höhen ausmachen konnte.
Die Sommer, die erfüllt waren von den gewaltigen Konzerten der Grillen in lauen Sommernächten, von Glühwürmchen zwischen den uralten knorrigen Linden der Allee, die zum Haus meiner Großeltern führte, dem Geruch von faulenden Aprikosen unter den Obstbäumen und dem einzigartigen Duft von Quitten und Rosen sowie dem aufziehenden Nebel über dem Moor, wenn es dunkel wurde.
Die Sommer, die erfüllt waren von taunassem Gras am Morgen, goldgelbem Stroh, das süßlich schmeckte, wenn man auf den Halmen kaute, dem Schnauben der Pferde, vom Schwimmen in sumpfigen Seen, Blutegeln, zerschundenen Knien und Armen, moosbewachsenen Bäumen, dem Spielen, Entdecken, Reiten, Pferde striegeln und Sattelzeug putzen – bis es irgendwann zu dunkel wurde, um noch draußen zu sein. Es waren die unbeschwertesten Tage und wir waren von morgens bis abends barfuß, schmutzig und glücklich.
Ich erinnere mich an das Basteln und Malen an verregneten Sommertagen. Vögel malte ich meist. Hunderte fliegender Vögel. Und Pferde. Gemeinsam mit meiner Cousine schrieb ich Gedichte in kleine Bücher, die meine Mutter uns kaufte, jede schrieb eines, und zu jedem Gedicht malten wir ein Bild in unser Buch. Oder wir dachten uns Geschichten aus, welche wir dann unseren kleinen Geschwistern vorlasen.
Wir gründeten Clubs für unsere Kuscheltiere. Da keine von uns mit Puppen spielte, saßen bei unseren Teestunden Krokodile, Affen, Löwen, Papageien, Bären und Pferde am Tisch und führten mit ihren Hufen, Tatzen, Pfoten und Klauen die kleinen chinesischen Porzellantassen an ihre Mäuler, Schnauzen und Schnäbel. Die Clubhäuser dieser exklusiven Gemeinschaft befanden sich meist in Bäumen und wurden von...