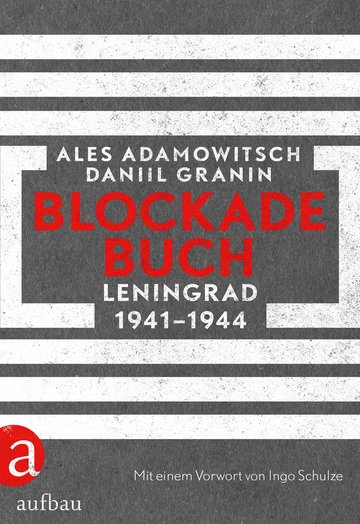Ingo Schulze
»Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht unsererseits nicht.«
Vorwort
Die Blockade von Leningrad konnte am 27. Januar 1944 durchbrochen und beendet werden. Ein Jahr später befreite die Rote Armee am 27. Januar 1945 das Konzentrationslager Auschwitz. Für den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2014 war Daniil Granin nach Berlin eingeladen worden, um vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen. Einen Tag zuvor besuchte er die Berliner Akademie der Künste, deren Mitglied er seit 1986 war.
Der Pulk an Fotografen und Kamerateams war dem 95-jährigen »Staatsgast« lästig. Daniil Granin hatte Fragen, er war neugierig. Dieses Berlin kannte er nicht. Er sprach deutsch, ein sehr schönes Deutsch. Sein freundliches, offenes Gesicht konnte sich jedoch von einem Augenblick auf den anderen verfinstern, wenn er sich durch die Journalisten gestört fühlte.
Daniil Granin hielt es für ein unwahrscheinliches Wunder, dass er den Krieg überlebt habe – als Freiwilliger an der Front der ersten Kriegstage, dem vorrückenden Aggressor unterlegen, dann im Leningrader Schützengraben, vor Hunger und Kälte kaum bei Bewusstsein, später als Kommandant einer Panzerkompanie. Aber von sich selbst wollte er gar nicht sprechen. »Sie kennen doch St. Petersburg ganz gut?«, fragte er.
Von 1984 an war ich mehrmals in Leningrad gewesen. Das Faktum der Blockade dieser Stadt war uns studentischen Touristen durchaus bewusst, allerdings war es bei unseren Besuchen unpersönlich geblieben. In der Gorbatschow-Zeit interessierte ich mich vor allem für Publikationen, die jetzt endlich möglich waren, meistens Memoiren oder Literatur, die die stalinschen Verbrechen zum Hintergrund hatten. Und ich weiß noch, wie sehr ich im Sommer 1989 die freiheitliche Atmosphäre im Land genoss – gerade im Unterschied zu jener in der DDR. Als ich im Herbst 1992 erneut in die Stadt kam, die sich nun wieder St. Petersburg nennen durfte, und kurz darauf begann, dort zu arbeiten, schloss ich Freundschaft mit einem Redaktionskollegen, der die Leningrader Blockade als Kind miterlebt hatte. Obwohl wir einander vieles anvertrauten – von den Blockadejahren zu sprechen, lehnte er ab. Die Pförtnerin unseres Gebäudes »gestand« mir nach einiger Zeit, als Zwangsarbeiterin in Deutschland gewesen zu sein, wobei sie im Erzählen bemüht war, die guten Momente herauszustreichen. Beim Reden liefen ihr die Tränen übers Gesicht, ohne dass sie dies zu bemerken schien. Sie tätschelte meine Wange. Ich kam aus jenem Land, das für den Tod von mehr als einer Million Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt verantwortlich war. Und nun, 1993, verdiente ich das Hundert- bis Zweihundertfache von dem, was meine russischen Kolleginnen und Kollegen erhielten, die sich nicht mal das Notwendigste zum Leben kaufen konnten. Das war der Hintergrund, vor dem ich die beiden Bände des »Blockadebuches« von Ales Adamowitsch und Daniil Granin in deutscher Übersetzung zu lesen begann. Ich begriff schnell: Dieses Buch führte mich in eine Welt ein, von der ich noch keine Kenntnis hatte. Es veränderte meinen Blick auf die condition humaine – und damit mich selbst.
»Der Führer hat beschlossen, die Stadt Petersburg vom Antlitz der Erde zu tilgen«, heißt es in einer geheimen Direktive des Stabes der deutschen Kriegsmarine mit dem Titel »Über die Zukunft der Stadt Petersburg« vom 22. 9. 1941. »Es besteht nach der Niederwerfung Sowjetrusslands keinerlei Interesse an dem Fortbestand dieser Großsiedlung. […] Es ist beabsichtigt, die Stadt eng einzuschließen und durch Beschuss mit Artillerie aller Kaliber und laufendem Bombeneinsatz dem Erdboden gleichzumachen. Sich aus der Lage der Stadt ergebende Bitten um Übergabe werden abgeschlagen werden. […] Ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht […] unsererseits nicht.«
Kein Interesse am Fortbestand der »Großsiedlung«, kein Interesse an der Erhaltung »dieser großstädtischen Bevölkerung«.
Was dies für die Bevölkerung der Stadt bedeutete, schien hinreichend dokumentiert und gestaltet zu sein. Die kaum zu zählenden Opfer, die Verhungerten und Erfrorenen, die getöteten Soldaten und Zivilisten, die zerbombte Stadt, in der von entkräfteten Musikern Schostakowitschs 7. Sinfonie uraufgeführt und durch Lautsprecher übertragen wird, sogar bis in die deutschen Schützengräben, die evakuierte Ermitage, in der die Angestellten durch die Säle führen und jene Bilder beschreiben, von denen nur noch die Rahmen hängen, und – kaum geflüstert – das Versagen Stalins und der meisten Parteiführer, die ihr Land wider besseren Wissens nicht auf den deutschen Überfall vorbereitet und so das Leiden noch vergrößert hatten.
Als Ales Adamowitsch und Daniil Granin Mitte der siebziger Jahre auf Adamowitschs Initiative hin ihre Befragungen von Überlebenden begannen, wussten sie noch nicht, »welch barbarische Dinge sich hinter dem gewohnten Wort ›Leningrader Blockade‹ verbergen. […] Denn diese Menschen haben uns all die Jahre geschont. Doch wenn sie jetzt erzählen, schonen sie vor allem sich selbst nicht mehr.« Es ist das alltägliche Leben unter Bedingungen, die mit Begriffen nicht zu beschreiben sind. Selbst konkrete Bezeichnungen bedeuten in unserem Sprachgebrauch etwas anderes. Das Brot war kein Brot mehr, auch wenn die Tagesration nur 125 Gramm betrug, das Wohnen hat alles Wohnliche verloren bei kaputten Fensterscheiben, ohne Heizung, ohne Strom, ohne Gas, ohne Wasser, bei zwanzig Grad minus und unter dem Beschuss von Artillerie und Flugzeugbomben. Deshalb braucht es diese Berichte, Berichte, die auch nicht einfach als Beispiel zitiert werden können, auch das wäre unangemessen. Es braucht das Ganze, das aus den zahlreichen alltäglichen Notwendigkeiten bestand.
»Vor allem ging es gar nicht um Heroismus. Schließlich war es für viele ein erzwungener Heroismus gewesen. Das wahre Heldentum bestand in etwas anderem. Es war jenes, das sich in den Familien, in den Wohnungen abspielte, wo die Menschen litten, fluchten und starben, wo es zu unwahrscheinlichen Taten kam, die Hunger, Kälte und Beschuss verursachten.
Die Blockade war ein Epos menschlichen Leidens. Das war nicht die Geschichte von neunhundert Tagen Heldentaten, sondern von neunhundert Tagen unerträglicher Qualen.«
Diejenigen, die diese unerträglichen Qualen überlebt haben, können aber auch Zeugnis ablegen von Solidarität und Würde, von intellektuellem und künstlerischem Leben und Widerstand. Deshalb erschüttert und schockiert dieses Buch nicht nur durch Art und Ausmaß des Leidens, von ihm geht auch eine seltsame Ermutigung aus. Es ist das Staunen darüber, wozu Menschen trotz alledem fähig sind.
Die jeweiligen Erzählungen und Dokumente des »Blockadebuchs« benennen zudem stets den physisch-psychischen Ort der Erinnerung. Adamowitsch und Granin beschreiben, was die Erfahrungen dieser neunhundert Tage in jenen anrichteten, die die Blockade überlebt haben. Es wird einem vor Augen geführt, welch fragiles Gebilde Erinnerungen sind und wie ganz und gar nicht selbstverständlich es ist, dass sie ausgesprochen und anderen anvertraut werden, obwohl es doch für die Betroffenen selbst notwendig ist, diese Erinnerungen zu teilen. Darüber hinaus ahnt man, welch unwahrscheinlichen Glücksfall es bedeutet, wenn es gelingt, das Erinnerte zu fixieren und weiterzugeben.
Dieses Buch hat viele Autorinnen und Autoren, hinter denen wiederum andere sichtbar werden, die nicht überlebt haben. Die Leistung von Ales Adamowitsch und Daniil Granin besteht darin, das Vertrauen ihrer Gesprächspartner gewonnen und deren Erfahrungen erzählbar gemacht zu haben. Sie selbst beschreiben, was das für sie persönlich zur Folge hatte. Die Qualen als auch die vielen Arten der Auflehnung gegen die Vernichtung werden in diesem Buch auf eine für Leser mögliche Weise nachvollziehbar. Deshalb gehört das »Blockadebuch« zu jenen Büchern, die für mich eine Art Fixpunkt darstellen, zu denen ich immer wieder zurückkehre.
Adamowitsch und Granin war es gelungen, die Veröffentlichung, wenn auch unter Einbußen, durchzusetzen. 1984, also vor fast 35 Jahren, erschien die erste Ausgabe des »Blockadebuchs«. In ihren Kommentaren ist auch die Zeit der Recherche anwesend. Dass es die Sowjetunion bald nicht mehr geben würde, war selbst 1984 unvorstellbar. Seither haben sich die politischen Verhältnisse nicht nur einmal verändert. Schon wenige Jahre nach dem Erscheinen des »Blockadebuches« war der Freiraum für Autoren ungleich größer geworden. Daniil Granin hat ihn in jeder Form genutzt.
Leningrad war die einzige Stadt im Zweiten Weltkrieg, der eine Blockade, eine Belagerung, widerfuhr. Heute denkt man an Sarajevo – und an die Aufzeichnungen von Dzevad Karahasan in seinem »Tagebuch einer Aussiedlung«. Die Blockadebücher aus Syrien und dem Irak stehen uns noch bevor.
Daniil Granins Rede im Bundestag war im eigentlichen Sinne keine Rede, sondern ein Bericht über die Blockade. Und doch war es eine der wichtigsten Reden im deutschen Parlament. In seinem schon etwas zu groß gewordenen Anzug, ohne Krawatte, wollte er am Rednerpult stehen und wehrte mehrfach die seine Rede unterbrechenden Versuche ab, ihm einen Stuhl anzubieten. Der 95-Jährige sprach als Soldat vor den deutschen Abgeordneten. Er ersparte sich und den Zuhörern nichts. Und er sprach von seiner Erfahrung mit dem Hass, ohne versöhnlerisch zu werden.
»Ich, der ich als Soldat an...