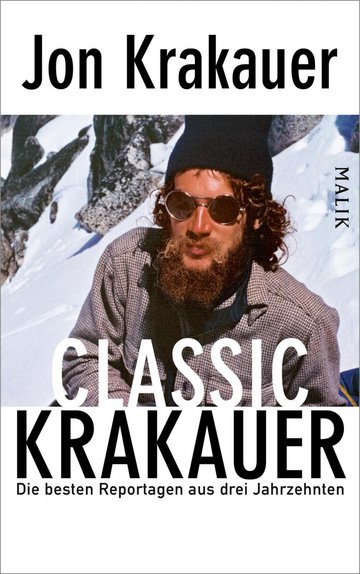Leben unter dem Vulkan
Auf 4394 Metern über dem Meeresspiegel muss ich nach jedem meiner schwerfälligen Schritte eine Atempause einlegen. Ich bin auf dem Gipfel des Mount Rainier angelangt, dem höchsten Berg der Kaskadenkette. In den vergangenen dreißig Jahren habe ich diesen gewaltigen Vulkan etliche Male bestiegen – aus Spaß, zum Training oder um dem Alltagstrott in der Großstadt zu entkommen. Diesmal aber ist mein Antrieb eine morbide Neugierde.
Neuere geologische Untersuchungen haben ergeben, dass der Mount Rainier für Tausende von Menschen, die im Schatten des Vulkans leben – darunter auch ich –, eine ernsthafte Bedrohung darstellt, und zwar selbst dann, wenn er nicht ausbrechen sollte. Mit meiner Besteigung hoffe ich, ein wenig Licht in diese Angelegenheit bringen zu können. Zwei Tage habe ich gebraucht, um mühsam hier heraufzusteigen. Jetzt fegt ein harscher Wind über den Gipfelkrater, der mein Gesicht einfrieren lässt und meine Fäuste trotz der Handschuhe in Eisblöcke verwandelt.
Ich lasse den Blick über den Landstrich schweifen, der sich von Kanada bis nach Zentral-Oregon erstreckt, rund 300 Kilometer entfernt. Betrachtet man den zerklüfteten Grat der Kaskadenkette, dann fällt einem sofort auf, dass diese Gegend besonders üppig mit Vulkanen gesegnet ist: Von meiner hohen Warte aus zähle ich nicht weniger als neun. Der faszinierendste von ihnen – zugleich auch der berüchtigtste – ist der Mount St. Helens, dessen gekappter Kegel gleich nebenan, in südwestlicher Richtung, kauert. Gerade stößt sein weit aufklaffender Krater eine Dunstglocke hinauf in die Troposphäre und bringt mir damit freundlich, aber unmissverständlich in Erinnerung, dass der Mount St. Helens – ebenso wie gut zwei Dutzend weitere Gipfel der Kaskadenkette – ein ziemlich aktiver Vulkan ist.
Am Sonntag, dem 18. Mai 1980, saß ich kurz vor neun Uhr morgens am Dock von Gig Harbor, Washington, und flickte ein Netz für den kommerziellen Lachsfang, als ich zufällig aufschaute und eine Art gigantische Kumulonimbuswolke sah, die sich dort auftürmte, wo eben noch nichts als blauer Himmel gewesen war. Was ich nicht wusste: Vom Gipfel des Mount St. Helens waren zeitgleich mehrere Lawinen aus Millionen Tonnen Fels und Eis weggebrochen und damit auf einen Schlag auch das geologische Deckgestein, das bis zu diesem Augenblick dafür gesorgt hatte, dass das flüssige Gestein und der heiße Wasserdampf im Innern des Berges blieben. Die resultierende Explosion ließ die oberen 400 Meter des Vulkans zerbersten und schleuderte sie in die Luft.
Der Ausbruch zerstörte die Pflanzen- und Tierwelt in einem Umkreis von 400 Quadratkilometern. Die Aschewolke, die ich sah, türmte sich bis in eine Höhe von mehr als achtzehn Kilometern auf, ließ es in großen Teilen Washingtons Nacht werden und überzog den Westen der Vereinigten Staaten mit 540 Millionen Tonnen vulkanischem Schutt. 57 Menschen kamen ums Leben, angesichts der Wucht des Ausbruchs eine vergleichsweise geringe Zahl, die auf die Evakuierungsmaßnahmen und die nur dünn besiedelte und weitgehend unerschlossene Umgebung des Berges zurückzuführen ist.
Jetzt, fünfzehn Jahre später, stehe ich auf dem Mount Rainier, betrachte die Landschaft ringsum, und schon ein flüchtiger Blick auf den Boden unter meinen Füßen macht mir bewusst, wie viel schwerwiegender die Folgen sein könnten, wenn eines Tages dieser Gipfel in die Luft fliegen sollte. Weit drüben, im Nordwesten, erstrecken sich die Stadtgebiete von Tacoma und Seattle mit ihren unzähligen Vororten. Ich erkenne deutlich die Space Needle und die Wolkenkratzer im Zentrum von Seattle, ebenso wie mehrere Boeing 747, die über dem Sea-Tac Airport zum Landeanflug ansetzen.
Angesichts der Tatsache, dass der Mount Rainier in der Vergangenheit einige Male zum Ausbruch kam (das letzte Mal vor nur 150 Jahren), ist die Nähe so vieler Menschen durchaus besorgniserregend. Geologen warnen, es gebe keine Möglichkeit, den nächsten Ausbruch des Berges vorherzusagen. Es könne in 10 000 Jahren so weit sein oder auch in zehn. Fest stehe nur, dass es irgendwann passieren werde.
Während ich am Gipfel des Mount Rainier hocke und beobachte, wie die Frachtschiffe und Fähren die gleißende Bucht des Puget Sound durchkreuzen, fällt es mir nicht schwer, mir vorzustellen, dass der Vulkan jeden Moment ausbrechen könnte. Der Rand des Gipfelkraters ist von unzähligen Fumarolen durchzogen, aus denen heiße Gase entweichen, die direkt aus dem Erdinnern kommen und meine Nasenlöcher mit einem beißenden Schwefelgeruch füllen. Die Temperaturen liegen zwar weit unter dem Nullpunkt, und der restliche Berg ist größtenteils von einer Gletscherkappe überzogen, doch der felsige Boden unter mir ist komplett schneefrei und fühlt sich beunruhigend warm an. Wissenschaftler haben am Kraterrand Oberflächentemperaturen von bis zu achtzig Grad Celsius gemessen. Die Hitze, die durch meine Thermohosen dringt, macht mir eindringlich bewusst, dass sich irgendwo nicht allzu weit unter mir eine Kammer mit glühend heißem Magma befindet, das nur darauf wartet, sich endlich einen Weg hinauf ans Tageslicht bahnen zu können.
In einem vollgestopften, fensterlosen Raum der University of Washington, knapp hundert Kilometer nördlich des Mount Rainier, zeichnen lange Reihen von Geräten jede seismologische Regung des Berges auf, um zu verhindern, dass ein Ausbruch die Region unerwartet trifft. Auf dem Dach des Gebäudes registrieren Antennen die Signale von rund dreißig Fernüberwachungsinstrumenten, die auf oder nahe bei den Vulkanen der Kaskadenkette stationiert sind. Telefone und Mikrowellengeräte übermitteln Signale von 120 weiteren. Allein der Mount Rainier wird von zwölf Messgeräten überwacht. Die unterschiedlich starken Erschütterungen werden in der Mitte des Raumes von mehreren Trommelschreibern als zittrige Linien aufgezeichnet.
»Die Geräte liefern durchaus brauchbare Daten«, erklärt Steve Malone, ein heiterer, bärtiger Geophysiker in Shorts und Sandalen, der das seismologische Forschungslabor leitet. »Aber letztendlich werden sie vor allem den Medien zuliebe betrieben. Damit die Fernsehteams ein Kameramotiv haben, wenn es irgendwo zu einem Beben kommt. Wir hier im Labor werfen nur gelegentlich einen Blick darauf und verlassen uns lieber auf ein ziemlich ausgeklügeltes Computersystem.« Sobald eines der Fernüberwachungsinstrumente ein seismisches Ereignis mit einer Stärke von mehr als 2,4 registriert, lösen die Computer automatisch ein Signal an den Piepser aus, den Malone an seinem Gürtel trägt. Bei einer Stärke von 2,9 oder mehr sendet das System zusätzlich per Fax und E-Mail eine ganze Flut an Meldungen an die Wissenschaftler und Katastrophenschutzbehörden der gesamten Region.
Dem gewaltigen Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980 war eine Reihe von kleineren Erdbeben vorausgegangen, gefolgt von einem Anstieg des Magmas im Schlund des Vulkans; vergleichbare Erschütterungen am Mount Rainier würden die Geologen mit größter Wahrscheinlichkeit rechtzeitig vor einem erneuten Ausbruch warnen. »Durch die Installation dieses Systems«, so Malone, »sollten die erfassten seismischen Daten einen bevorstehenden Ausbruch bereits mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate im Voraus ankündigen.«
Um die Wahrheit zu sagen, bezweifelt Malone, dass der Mount Rainier überhaupt ein Kandidat für eine Eruption ist, die mit der des Mount St. Helens vergleichbar wäre. Aufgrund der Erkenntnisse zu den zurückliegenden Ausbrüchen vermutet er, wie die meisten seiner Kollegen, dass es weitaus weniger theatralisch vonstattengehen werde, wenn der Mount Rainier einst »den Kopf verliert«, und es nicht zu einer verheerenden Detonation, sondern zu vergleichsweise gemäßigten Explosionen oder Extrusionen von Magma kommen werde.
Malone gibt jedoch zu bedenken, dass es ein schwerwiegender Irrtum wäre, deshalb zu glauben, von dem Berg ginge keine große Bedrohung aus: »Letztendlich ist der Mount Rainier deutlich gefährlicher als der Mount St. Helens. Das Beängstigende sind die verheerenden Schuttströme, zu denen es kommen kann – ein Risiko, das den meisten Menschen gar nicht bewusst ist.« Was Geologen mit dem indonesischen Namen »Lahar« bezeichnen, ist eine Sturzflut aus halb flüssigem Schlamm, Fels und Eis, die mit beängstigender Geschwindigkeit und verheerender Wucht in die Tiefe rauscht.
»Lahars hat es am Mount Rainier in der Vergangenheit immer wieder gegeben«, warnt Malone. »Sie können mehr oder weniger unvorhergesehen auftreten, auch ohne ein Anzeichen für eine Eruption, also völlig ohne Vorwarnung. Wir erinnern uns mit Schrecken daran, was in Armero geschehen ist, und machen uns Sorgen, dass hier etwas Ähnliches passieren könnte.«
Armero war einst ein wohlhabendes kolumbianisches Bauernstädtchen, das sich, nicht weit von Bogotá entfernt, an die Hänge der Anden schmiegte. Am Abend des 13. November 1985 spürten die Einwohner der Stadt, wie die Erde bebte, und hörten mehrere aufeinanderfolgende, von einem Grollen begleitete Explosionen, die vom Nevado del Ruiz ausgingen, einem 5321 Meter hohen, knapp fünfzig Kilometer entfernten Vulkan. Den Schilderungen der Bewohnerin Marina Franco de Huez zufolge erhob sich eine unheilvolle Wolke vom Kraterrand, aus der Asche auf Armero herunterregnete, »aber man erklärte uns, es sei nichts Ernstes«.
Obwohl der Vulkan ausbrach, schien es zunächst wenig Grund zur Beunruhigung zu geben. Spätere Zeitungsberichte nannten das Vorkommnis vielmehr eine »vergleichsweise unbedeutende Eruption, einen vulkanischen Rülpser«, der lediglich fünf Prozent der Eis- und Schneemassen in der obersten Gipfelregion abschmelzen ließ. Dieser »Rülpser« reichte jedoch aus, um einen steilen Felspfeiler unterhalb des Gipfelkraters zum Einsturz zu bringen und...