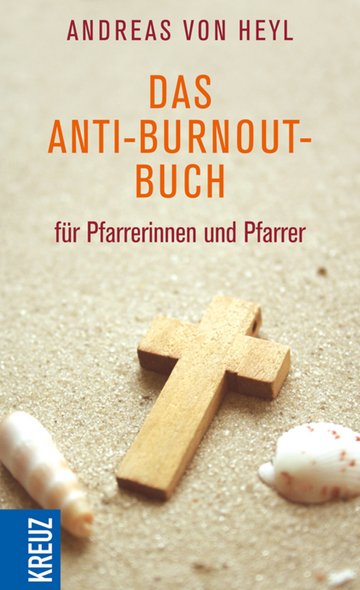Zur geistlichen Dimension von Brennen und Ausbrennen
Vor der Beschäftigung mit der Entstehung und den Auswirkungen des Burnout-Syndroms möchte ich zunächst einiges zur geistlichen Dimension der Thematik ausführen. Dabei wird sich zeigen, dass es für kirchliche Mitarbeitende noch eine andere, tiefere Auswirkung hat, wenn sie von »Burnout« betroffen sind, als beispielsweise für Krankenschwestern oder Lehrer.
Mit den Begriffen »Brennen« und »Ausbrennen« bewegen wir uns von vornherein im Umfeld zentraler biblischer Themen. Es geht um Leuchten oder Verlöschen, um Licht und Finsternis, ja letztlich um Leben und Tod. »Finsternis« ist der biblische Zentralbegriff für den Bereich des Todes, der Sünde, der von Gott abgewandten Welt, die in und an dieser Abwendung zugrunde gehen wird. Wo aber Gott ist, da ist »Licht«. 67 Mal spricht die Bibel vom Licht, 52 Mal von der Finsternis. 27 Mal verwendet sie das Wort Feuer im Blick auf Gott. Vor allem im Alten Testament ist dabei nicht nur von der belebenden, sondern auch von der verzehrenden und verheerenden Kraft des Feuers, das von Gott ausgeht, die Rede. Auffallend ist, dass gerade an herausgehobenen Stellen der Bibel immer wieder die Metaphorik des Feuers und des Brennens erscheint:
Im Alten Testament
Am Beginn der Geschichte Gottes mit Israel steht der brennende Dornbusch, aus dem heraus Gott zu Moses spricht (vgl. Ex 3,2).
Gott weist seinem Volk den Weg aus der Sklaverei in die Freiheit, indem er ihm tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule vorangeht (vgl. Ex 13,21).
Im kultischen Gesetz Israels wird explizit betont, dass »auf dem Altar des Herrn ständig das Feuer brennen und nie verlöschen« soll (Lev 6,5 – 6).
Einem der wichtigsten Propheten Israels, Elia, gab man den Beinamen der »Feurige«, nicht nur wegen seines ungestümen Wesens, sondern auch, weil er am Ende in einem feurigen Wagen, gezogen von feurigen Rossen, in den Himmel entrückt wird (vgl. 2 Kön 2,11). Im Buch Jesus Sirach heißt es über ihn wunderbar bildkräftig: »Er brach hervor wie ein Feuer, und sein Wort brannte wie eine Fackel« (Sir 48,1).
Im Neuen Testament
Im Neuen Testament setzt sich die Metaphorik fort. Johannes der Täufer weist auf Jesus hin mit den Worten: »Nach mir wird jemand kommen, der euch mit dem heiligen Geist und mit Feuer taufen wird« (Mt 3,11; vgl. Lk 3,16).
Jesus wiederum sagt über Johannes: »Er war ein brennendes und scheinendes Licht« (Joh 5,35).
Von sich selbst sagt Jesus: »Ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf Erden; was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde« (Lk 12,49).
Als ein Beispiel für die rechte Nachfolge stellt Jesus seinen Hörern das Bild von den zehn klugen und den zehn törichten Jungfrauen vor Augen (vgl. Mt 25). Die Klugen haben ein Reservefläschchen für ihre Öllampen dabei, sodass sie dem Bräutigam auch noch mit ihren Lichtern entgegenziehen können, als dieser sich verspätet. Aus diesem Gleichnis erhebt sich die direkte Frage an uns: Wie steht es mit unserem »Brennstoff«? Haben wir Reserven? Wo sind unsere Ressourcen? Pflegen wir sie? Übrigens ist die Öllampe in diesem Zusammenhang ein viel schöneres Symbol als das im Raum der Kirche gebräuchliche Sinnbild der Kerze. Eine Kerze verzehrt sich selbst, während sie leuchtet, und ist dann eines Tages nicht mehr da. Ein Öllämpchen kann man einmal heller und einmal schwächer leuchten lassen, je nach Bedarf. Und wenn es einmal ausgeht, ist es nicht weiter schlimm, denn es lässt sich jederzeit neu entzünden – wenn, ja eben wenn genügend Brennstoff vorhanden ist.
»Seid brennend im Geist!«, fordert Paulus die Gemeinde im Römerbrief auf (Röm 12,11).
Am Geburtstag der Kirche, an Pfingsten, begegnen wir erneut der Metaphorik des Feuers: »Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und sich auf jeden von ihnen setzten, und sie wurden alle mit dem heiligen Geist erfüllt …« (Apg 2,3 f.). Es hätte ja auch ein anderes Symbol sein können, ein Regenbogen vielleicht oder ein Sturmgebraus, aber nein, es ist wieder das Feuer. Das Feuer ist der Inbegriff jener Kraft, mit der das Göttliche auf Erden erscheint und Menschen entflammt, sodass sie »begeistert« werden, dass sie »entbrennen«, dass sie sich mit »Feuer und Flamme« und mit ganzem Herzen einsetzen für eine Welt, die so werden soll, wie sie Gottes Willen entspricht. Die Apostel waren solche »Brennenden«, vor allem Paulus, dem Jesus »in einem leuchtenden Licht vom Himmel« erschien und der dann die Frohe Botschaft des Evangeliums in ganz Kleinasien und Griechenland und bis hin nach Rom verbreitet hat.
Denn ich esse Asche wie Brot …
Das Wort »Ausbrennen« kennt die Bibel dagegen nicht. Sehr wohl jedoch den Sachverhalt.
Das eindrücklichste Beispiel ist wiederum die Person des Propheten Elia. Eben noch hat er mit einem Feuerwunder auf dem Berg Karmel die Massen begeistert und den König bloßgestellt, nun liegt er ausgepumpt und verzweifelt in der Wüste unter einem Ginsterstrauch und bittet Gott, ihn sterben zu lassen: »Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele« (1. Kön 19,4).
Vor allem in den Psalmen finden sich Formulierungen, in denen sich verzweifelte, zusammengebrochene, depressive Menschen mit ihrem ganzen Elend wiederfinden und verstanden fühlen können. Zum Beispiel in Psalm 22,18: »Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst; mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gaumen.« Oder, besonders bildstark, in Psalm 102,4 – 10: »Meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen.«
Aber denken wir auch an Hiob, wie er da in der Asche sitzt und mit einer Scherbe seine eitrigen Schwären schabt, nachdem ihm nicht nur sein Besitz und seine Familie, sondern zuletzt auch noch die Gesundheit genommen war. Oder an den späten, finster gewordenen König Saul. Oder an die Weinenden an den Wassern von Babylon, die sich völlig ohne Kraft und Hoffnung fühlten.
Im Neuen Testament sind es vor allem die Emmausjünger, die zunächst, vor ihrer Begegnung mit Jesus, den Inbegriff des Ausgebranntseins, der Trost- und Hoffnungslosigkeit verkörpern. Der expressionistische Künstler Karl Schmidt-Rottluff hat ihren Seelenzustand in einem Holzschnitt meisterhaft zum Ausdruck gebracht. Auf dieses Kunstwerk werde ich im letzten Kapitel näher eingehen. Die beiden Jünger sind am Boden zerstört, aber Jesus richtet sie wieder auf. Als sie ihn endlich erkennen, durchströmt sie neues Leben. Sie sehen sich an und es bricht aus ihnen hervor: »Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Wege redete und uns dabei die Schrift öffnete?« (Lukas 24, 32).
Verlöschen oder leben?
Wir müssen uns eingestehen: Wir sind Verlöschende – vom ersten Atemzug an. Unweigerlich kommt für uns alle der Punkt, an dem unser Lebenslicht auslöschen wird. Die Bibel spricht darüber ganz nüchtern. Der Psalmbeter hält fest: »Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr« (Ps. 103,15 f.). Wäre das aber das Letzte, was über unser Leben zu sagen ist, so stünde über diesem Leben ein dunkler Stern, und alles, was sich in unserem Leben ereignet, alles, was wir in diesem Leben tun, was wir erleiden, was wir an Liebe geben und empfangen, wäre flüchtig, ja genau besehen nichtig. Dann hätten die französischen Existenzialisten des vorigen Jahrhunderts Recht mit ihrer Aussage: Das Leben ist absurd.3 Zwar kann man versuchen, das Absurde mannhaft, ja sogar heldenhaft zu ertragen, so wie uns Albert Camus die antike Sagenfigur des Sisyphos, der unentwegt immer wieder den Stein den Berg hinaufrollt, als einen Helden vor Augen stellt. Aber dieses Leben würde etwas von der Trostlosigkeit der Beckettschen Dramen atmen, wo die Helden leidvoll erfahren müssen, dass der ersehnte Godot einfach nicht kommt.4 Der Schrecken einer Welt ohne die Auferstehungshoffnung wurde schon 250 Jahre früher in der von Jean Paul verfassten »Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab« vorwegempfunden.5 Nicht wenigen von denen, die viel Leid ertragen müssen, würde sich jedenfalls die Frage stellen, ob es sich lohnt, dieses Leben überhaupt anzunehmen und zu leben, die Schmerzen, den Kummer jeden Tag aufs Neue zu ertragen.
Nun sagt uns aber die Bibel, dass der Tod nicht das letzte Wort hat über uns. Wir sind zum Leben geboren, nicht zum Sterben. Uns ist von Gott das Leben angeboten in seiner ganzen Fülle – schon vor dem Tod und dann, jenseits der Todesgrenze, in einer Weise, die wir mit unserem begrenzten Verstand jetzt nicht begreifen können. Und zwar »in« ihm, in diesem Christus Jesus, dem Auferstandenen. Paulus führt in seinen Briefen immer wieder aus, dass wir »in Christus« die Fülle des Lebens...