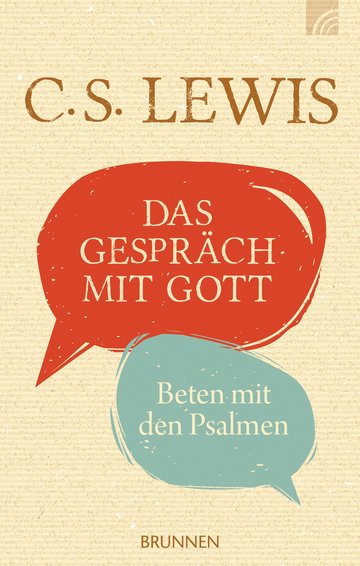2 Das Gericht in den Psalmen
Wenn ein Gedanke einen Christen erzittern lässt, dann ist es der Gedanke an das „Gericht“ Gottes. Der „Tag“ des Gerichts ist „der Tag des Zorns, jener schreckliche Tag“, wie es in einem mittelalterlichen Choral heißt. Wir beten, Gott möge uns „in der Stunde des Todes und am Tag des Gerichts“5 erlösen. Die Schrecken dieses Tages sind seit Jahrhunderten ein Thema der christlichen Kunst und Literatur. Dieser Aspekt des Christentums geht zweifellos auf die Lehre unseres Herrn selbst zurück, insbesondere auf das erschreckende Gleichnis von den Schafen und den Böcken. Davon kann kein Gewissen unberührt bleiben, denn darin werden die „Böcke“ ausschließlich wegen ihrer Unterlassungssünden verdammt, wie um uns ganz klar zu machen, dass der schwerste Vorwurf, der jeden von uns treffen wird, nicht an den Dingen hängt, die jemand getan, sondern an denen, die er nie getan hat – und die ihm vielleicht noch nicht einmal eingefallen sind.
Darum hat es mich sehr überrascht, als mir zum ersten Mal auffiel, wie die Psalmisten über die Gerichte Gottes reden. Nämlich so: „Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest“ (67,5). Oder: „Das Feld sei fröhlich …; denn er kommt, denn er kommt, zu richten das Erdreich“ (96,12-13). Offenbar ist das Gericht ein Anlass zu allgemeiner Freude. Die Leute bitten sogar darum: „Herr, mein Gott, verhilf mir zum Recht nach deiner Gerechtigkeit“ (35,24).
Der Grund dafür wird bald deutlich. Die jüdischen Psalmbeter sahen, wie wir es ja auch tun, in Gottes Gericht so etwas wie einen irdischen Gerichtshof. Nur mit dem Unterschied, dass ein Christ sich vorstellt, dass dort ein Strafprozess verhandelt wird, bei dem er selbst auf der Anklagebank sitzt. Ein Jude denkt eher an einen Zivilprozess, bei dem er der Kläger ist. Der eine hofft auf einen Freispruch oder besser eine Begnadigung; der andere erhofft sich einen spektakulären Triumph mit saftigem Schadensersatz. Darum bittet er Gott, „mir Recht zu schaffen und meine Sache zu führen“ (35,23).
Und obwohl unser Herr, wie ich gerade eben sagte, im Gleichnis von den Schafen und den Böcken das typisch christliche Bild gezeichnet hat, zeigt er sich an anderer Stelle ganz typisch jüdisch.
Achten Sie einmal darauf, was er mit einem „ungerechten Richter“ meint. Die meisten von uns würden darunter jemanden verstehen wie Richter Jeffreys6 oder die Handlanger, die während des Naziregimes auf den deutschen Gerichtsbänken saßen: jemanden, der Zeugen und Geschworene drangsaliert, um unschuldige Menschen zu verurteilen und dann drakonisch zu bestrafen. Auch hier denken wir wieder an einen Strafprozess. Wir hoffen, nie als Angeklagte vor einem solchen Richter erscheinen zu müssen. Der ungerechte Richter im Gleichnis dagegen ist eine ganz andere Gestalt. Es besteht keine Gefahr, gegen den eigenen Willen vor seinem Gericht zu erscheinen; im Gegenteil, die Schwierigkeit besteht darin, dort erscheinen zu dürfen. Es geht eindeutig um eine Zivilklage. Der armen Frau aus Lukas 18,1-5 wird vielleicht ihr kleines Grundstück – gerade groß genug für einen Schweinestall und ein Hühnergehege – von einem reicheren und mächtigeren Nachbarn weggenommen (heute wären es vielleicht Stadtentwickler oder irgendwelche anderen „Interessengruppen“). Und sie weiß, dass das Recht eigentlich vollkommen auf ihrer Seite ist. Könnte sie nur vor den Richterstuhl gelangen und nach geltenden Gesetzen Klage erheben, so würde sie auf jeden Fall ihr Grundstück zurückbekommen. Aber weil niemand ihr zuhört, bringt sie kein Verfahren zustande. Kein Wunder, dass sie sich nach dem „Gericht“ sehnt.
Hinter alledem steht eine uralte und fast weltweit verbreitete Erfahrung, die uns erspart geblieben ist. Fast überall und zu allen Zeiten war es für den „kleinen Mann“ äußerst schwierig, seiner Sache Gehör zu verschaffen. Der Richter (und zweifellos auch der eine oder andere seiner Untergebenen) muss erst einmal bestochen werden. Wer es sich nicht leisten kann, ihn zu „schmieren“, dessen Sache kommt nie vor Gericht. Unsere Richter lassen sich nicht bestechen (ein Segen, den wir wahrscheinlich viel zu selbstverständlich nehmen; er wird uns nicht automatisch erhalten bleiben).
Deshalb braucht es uns nicht zu überraschen, wenn die Psalmen und die Propheten voller Sehnsucht vom Gericht sprechen und es als eine gute Nachricht betrachten, dass das „Gericht“ kommt. Hunderte und Tausende von Menschen, denen alles genommen wurde, was sie besaßen, obwohl das Recht ganz und gar auf ihrer Seite war, werden endlich Gehör finden. Vollkommen klar, dass sie sich vor dem Gericht nicht fürchten. Sie wissen, dass ihr Anspruch unwiderlegbar ist – könnten sie ihn nur geltend machen. Wenn Gott kommt, um zu richten, werden sie endlich Gehör finden.
Dieser Punkt wird an zahlreichen Stellen deutlich. In Psalm 9 lesen wir, Gott werde „richten mit Gerechtigkeit“ (V. 8), denn er „gedenkt der Elenden und vergisst nicht ihr Schreien“ (V. 12). Er ist ein „Helfer“ (also ein „Anwalt“) „der Witwen“ (68,6). Von dem guten König in Psalm 72,2 heißt es, er „richte mit Gerechtigkeit“, indem er die „Elenden rette“. „Wenn Gott sich aufmacht zu richten“, wird er „allen Elenden auf Erden“ helfen (76,10), all den verängstigten, hilflosen Menschen, denen bisher Unrecht geschah, ohne dass es je wiedergutgemacht worden wäre. Wenn Gott irdischen Richtern vorwirft, dass sie „unrecht richten“, fordert er sie gleich danach auf: „Schaffet Recht dem Armen“ (82,2-3).
Der „gerechte“ Richter ist also vor allem jemand, der in einem Zivilprozess Unrecht aus dem Weg räumt. Zweifellos würde er auch in einem Strafverfahren gerecht urteilen, aber das ist kaum jemals das, woran die Psalmisten denken. Christen flehen Gott um Barmherzigkeit an statt um Gerechtigkeit; die Psalmisten flehten ihn um Gerechtigkeit statt Ungerechtigkeit an. Der göttliche Richter ist der Verteidiger, der Befreier. Wie ich von Theologen gehört habe, könnte das Wort, das wir im Buch der Richter so übersetzen, fast auch mit „Streiter“ oder „Kämpfer“ wiedergegeben werden; denn obwohl diese „Richter“ auch manchmal Dinge tun, die in den Bereich der Rechtsprechung fallen, sind sie viel mehr damit beschäftigt, die unterdrückten Israeliten mit Waffengewalt vor den Philistern und anderen Feinden zu retten. Sie haben mehr Ähnlichkeit mit Jack dem Riesentöter als mit einem modernen Richter in Robe oder Talar. Die Helden der Ritterromane, die ausziehen, um edle Damen und Witwen in Not vor Riesen und anderen Tyrannen zu retten, agieren fast so wie „Richter“ im alten hebräischen Sinn. Dasselbe gilt für moderne Anwälte (und ich kenne solche), die ohne Bezahlung für mittellose Mandanten arbeiten, um sie vor Unrecht zu bewahren.
Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, das christliche Bild vom Gericht Gottes als weitaus profunder und weitaus gesünder für unsere Seelen zu betrachten als das jüdische. Das heißt aber keineswegs, dass wir die jüdische Auffassung einfach verwerfen müssten. Zumindest ich glaube, dass ich davon immer noch reichlich zehren kann.
Denn sie ergänzt die christliche Vorstellung in einer wichtigen Hinsicht. Was uns an der christlichen Vorstellung aufschreckt, ist die vollkommene Reinheit des Maßstabes, nach dem unser Handeln beurteilt wird. Allerdings wissen wir auch, dass keiner von uns diesem Maßstab je genügen wird. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir alle müssen unsere Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes und das Werk Christi setzen, nicht auf unsere eigene Rechtschaffenheit. Das jüdische Bild eines Zivilprozesses nun ruft uns abrupt in Erinnerung, dass wir vielleicht nicht nur an einem göttlichen Maßstab scheitern (das versteht sich von selbst), sondern auch an einem ganz menschlichen Maßstab, den jeder vernünftige Mensch anerkennt und den wir selbst zumeist gern von anderen einfordern. Es dürfte ziemlich sicher sein, dass gegen jeden von uns Ansprüche bestehen, die wir nicht erfüllt haben – menschliche Ansprüche. Denn wer könnte schon ernsthaft glauben, er hätte es in seinem Umgang mit Vorgesetzten und Untergebenen, mit dem Ehepartner oder der Ehefrau, mit Eltern und Kindern, im Streit und in der gemeinsamen Arbeit nie an schlichter Ehrlichkeit und Fairness fehlen lassen (von Nächstenliebe oder Großzügigkeit ganz zu schweigen)? Natürlich vergessen wir das meiste von dem Schaden, den wir angerichtet haben. Aber die, denen wir geschadet haben, vergessen es nie, selbst, wenn sie es uns vergeben. Und Gott vergisst es auch nicht. Und selbst das, was wir noch wissen, ist schon erdrückend genug. Die Wenigsten von uns haben unseren Schülern oder Patienten oder Klienten (oder wie immer unsere jeweiligen „Kunden“ auch heißen mögen) stets im vollen Maße das gegeben, wofür wir bezahlt wurden. Wir haben nicht immer unseren fairen Anteil an irgendeiner lästigen Arbeit getan, wenn wir einen Kollegen oder Partner fanden, den wir beschwatzen konnten, den schwierigeren Teil zu übernehmen.
An unseren Streitigkeiten lässt sich sehr gut deutlich machen, worin sich die christliche und die jüdische Auffassung unterscheiden, auch wenn man beide im Blick behalten sollte. Als Christen müssen wir natürlich Buße tun für den Zorn, die Böswilligkeit und den Eigensinn, durch die die Sache von unserer Seite her überhaupt erst zu einem Streit wurde. Aber auf viel niedrigerer Ebene stellt sich auch die Frage: Abgesehen von dem Streit selbst (darauf kommen wir später noch), hast du fair gestritten? Oder haben wir vielleicht ganz unwissentlich die ganze Sache...