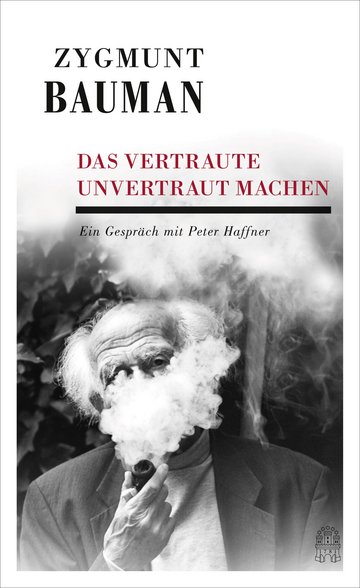Liebe und Geschlecht
Partnerwahl: Warum wir das Lieben verlernen
Beginnen wir mit dem Wichtigsten: der Liebe. Sie sagen, wir seien dabei, das Lieben zu verlernen. Wie kommen Sie darauf?
Der Trend, einen Partner im Internet zu suchen, folgt dem Trend zum Internetshopping. Ich selber gehe nicht gern in Läden, kaufe die meisten Sachen online, Bücher, Filme, Kleider. Wollen Sie ein neues Jackett, zeigt Ihnen die Webseite des Onlineladens einen Katalog. Suchen Sie einen Partner, zeigt Ihnen die Dating-Webseite auch einen Katalog. Das Muster der Beziehungen zwischen Kunden und Waren wird zum Muster der Beziehungen zwischen Menschen.
Was ist der Unterschied zu früher, als man die künftige Lebensgefährtin auf einem Dorffest oder Ball in der Stadt kennenlernte? Da hatte man doch auch seine Präferenzen?
Leuten, die unter Schüchternheit leiden, kann das Internet sicher helfen. Sie müssen sich nicht überwinden, eine Frau anzusprechen, weil sie fürchten, zu erröten. Sie können leichter eine Bindung knüpfen, sind nicht so blockiert. Doch im Onlinedating geht es um das Bemühen, die Eigenschaften des Partners zu definieren, die den eigenen Sehnsüchten entsprechen. Man wählt ihn aus nach Haar- und Hautfarbe, Größe, Figur, Brustumfang, Alter, Interessen und Hobbys, Vorlieben und Abneigungen. Dahinter steckt die Idee, man könne ein Liebesobjekt aus einer Anzahl messbarer körperlicher und sozialer Eigenschaften zusammensetzen. Dabei gerät das Entscheidende aus dem Blick: die menschliche Person.
Aber selbst wenn der Typus, auf den man steht, so definiert wird, ändert sich doch alles, sobald man der Person begegnet. Die ist ja viel mehr als die Summe solcher Äußerlichkeiten.
Die Gefahr ist, dass das Muster von Beziehungen so wird wie das Verhältnis zu einem Gebrauchsgegenstand. Einem Stuhl schwört man nicht Treue. Warum sollte ich schwören, ich werde auf diesem Stuhl sterben? Wenn er mir nicht mehr gefällt, kaufe ich einen neuen. Es ist kein bewusster Prozess, aber es ist die Art, in der wir lernen, die Welt und die Menschen zu sehen. Was passiert, wenn man jemanden trifft, der attraktiver ist? Es ist wie bei der Barbiepuppe. Kommt eine neue Version auf den Markt, tauscht man die alte gegen diese aus.
Sie meinen, man trennt sich voreilig.
Eine Beziehung geht man ein, weil man sich Befriedigung verspricht. Bekommt man das Gefühl, eine andere Person werde einem mehr geben, bricht man sie ab und beginnt eine neue. Um eine Beziehung zu beginnen, braucht es die Vereinbarung von zwei Personen. Um sie abzubrechen, nur eine. Das bedeutet, dass beide Partner in ständiger Angst leben, verlassen zu werden. Dass man weggeräumt wird wie ein Jackett, das aus der Mode ist.
Das liegt doch in der Natur jeder Vereinbarung.
Sicher, doch früher war es kaum möglich, eine Beziehung abzubrechen, selbst wenn sie nicht befriedigte. Eine Scheidung war schwierig, eine Alternative zur Ehe sozusagen inexistent. Man litt, blieb aber zusammen.
Und weshalb ist die Freiheit, auseinandergehen zu können, schlechter als der Zwang, unglücklich zusammenbleiben zu müssen?
Man gewinnt etwas, verliert aber auch etwas. Man ist freier, leidet jedoch darunter, dass der Partner das auch ist. Es führt zu einem Leben, in dem Beziehungen und Partnerschaften nach dem Muster des Mietkaufs geformt werden. Wer sich aus Bindungen lösen kann, muss sich nicht anstrengen, sie zu erhalten. Menschen sind nur so lange wertvoll, wie sie Befriedigung verschaffen. Dahinter steht der Glaube, dauerhafte Bindungen stünden der Suche nach dem Glück entgegen.
Und das sei ein Irrtum, schreiben Sie in Liquid Love, Ihrem Buch über Freundschaft und Beziehungen.
Es ist das Problem der »flüchtigen Liebe«. In turbulenten Zeiten benötigt man Freunde und Partner, die einen nicht hängenlassen. Die für einen da sind, wenn man sie braucht. Der Wunsch nach Stabilität ist wichtig im Leben. Die 16 Milliarden Dollar für Facebook kapitalisieren dieses Bedürfnis, nicht allein zu sein. Andererseits scheut man jedoch die Verpflichtung, sich auf jemanden einzulassen und sich zu binden. Man fürchtet, man verpasse etwas. Man will einen sicheren Hafen, aber gleichzeitig die Hände frei haben.
Sie waren 61 Jahre mit Janina Lewinson verheiratet, die 2009 starb. Nach ihrer ersten Begegnung, schreibt sie in ihren Erinnerungen A Dream of Belonging, seien Sie nicht von ihrer Seite gewichen. Sie hätten jedesmal gerufen, »Was für ein glücklicher Zufall!«, dass Sie auch dorthin müssten, wo sie hinwollte. Und als sie Ihnen mitteilte, dass sie schwanger ist, hätten Sie auf der Straße getanzt und sie geküsst, als uniformierter Hauptmann der polnischen Armee, was Aufsehen erregte. Noch Jahrzehnte nach der Heirat, schreibt Janina, hätten Sie ihr Liebesbriefe geschickt. Was macht wahre Liebe aus?
Als ich Janina sah, wusste ich sofort, dass ich nicht weiter zu suchen brauchte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Innerhalb von neun Tagen machte ich ihr den Heiratsantrag. Wahre Liebe ist jene schwer fassbare, aber überwältigende Lust am »ich und du«, am Füreinander da sein, am Einswerden. Das Vergnügen, dass es auf einen ankommt in einer Sache, die nicht nur für einen selber wichtig ist. Gebraucht zu werden oder gar unersetzlich zu sein ist ein beglückendes Gefühl. Es ist schwer zu erlangen. Und unerreichbar, wenn man in der Einsamkeit des Egoisten verharrt, der nur an sich selber interessiert ist.
Liebe verlangt also ein Opfer.
Wenn das Wesen der Liebe in der Neigung besteht, dem Liebesobjekt in allem beizustehen, es zu unterstützen, zu fördern und zu loben, dann muss der Liebende bereit sein, die Sorge um sich selbst zugunsten der Geliebten zurückzustellen. Bereit, das eigene Glück als eine Nebensache, eine Nebenwirkung des Glücks des anderen zu betrachten. Dem man, um es mit dem griechischen Dichter Lukian zu sagen, »sein Schicksal verpfändet«. In einer Liebesbeziehung sind Altruismus und Egoismus nicht, wie man immer annimmt, unvereinbare Gegensätze. Sie verbinden sich, verschmelzen und können schließlich nicht mehr voneinander unterschieden oder getrennt werden.
Die Amerikanerin Colette Dowling nannte die Angst der Frauen vor der Unabhängigkeit den »Cinderella-Komplex«. Die Sehnsucht nach Sicherheit, Wärme und Umsorgtsein sei eine »gefährliche Regung«, sagte Dowling und mahnte ihre Geschlechtsgenossinnen, sich nicht selber ihrer Freiheit zu berauben. Was stört Sie an dieser Mahnung?
Dowling warnte vor dem Impuls, für andere zu sorgen und damit die Möglichkeit zu verlieren, nach Belieben auf einen neuen Zug aufzuspringen. Es ist typisch für die privaten Utopien der Cowboys und Cowgirls des konsumistischen Zeitalters, dass sie einen enormen Freiraum für sich beanspruchen. Sie halten sich für den Nabel der Welt und sind auf Solovorstellungen aus. Davon können sie nie genug bekommen.
Die Schweiz, in der ich aufgewachsen bin, war keine Demokratie. Bis 1971 hatten die Frauen, die Hälfte der Bevölkerung, kein Wahlrecht. Noch immer gibt es keine Lohngleichheit für gleiche Arbeit, und in den Führungsetagen von Unternehmen sind Frauen untervertreten. Haben Frauen denn nicht allen Grund, sich von Abhängigkeiten zu befreien?
Gleichberechtigung in diesen Bereichen ist wichtig. Doch im Feminismus gibt es zwei Strömungen zu unterscheiden. Die eine ist, Frauen von Männern ununterscheidbar zu machen. Sie sollen in der Armee dienen und in den Krieg ziehen können, und die Frauen fragen: Warum ist es uns nicht gestattet, Leute zu erschießen, wie das die Männer dürfen? Die andere Strömung ist, die Welt femininer zu machen. Das Militär, die Politik, alles, was geschaffen worden ist, ist von Männern für Männer. Vieles, was heute falsch läuft, kommt davon. Gleiche Rechte, sicher. Aber sollen die Frauen nun auch Werten folgen, die von Männern kreiert worden sind?
Muss man in einer Demokratie diese Entscheidung nicht den Frauen selber überlassen?
Nun, ich erwarte jedenfalls nicht, dass die Welt sich sehr verbessern wird, wenn Frauen so funktionieren, wie das die Männer taten und tun.
In den ersten Jahren Ihrer Ehe waren Sie ein Hausmann »avant la lettre«. Sie kochten, hüteten die beiden kleinen Kinder, während Ihre Frau in einem Büro arbeitete. Das war ziemlich ungewöhnlich im damaligen Polen, nicht?
Das war nicht so ungewöhnlich, auch wenn Polen konservativ war. In dieser Hinsicht waren die Kommunisten revolutionär, da sie Männer und Frauen als gleichwertige Arbeitskräfte betrachteten. Die Neuheit im kommunistischen Polen war, dass sehr viele Frauen in die Fabrik oder in ein Büro arbeiten gingen. Um damals eine Familie durchzubringen, brauchte man zwei Löhne.
Das hatte eine Änderung der Stellung der Frau zur Folge und damit eine Änderung des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern.
Es war ein interessantes Phänomen. Die Frauen versuchten, sich selber als ökonomischen Faktor zu verstehen. Im alten Polen war der Ehemann der alleinige Versorger gewesen, verantwortlich für die ganze Familie. Tatsächlich aber war der Beitrag der Frauen zur Wirtschaft enorm. Frauen erledigten einen ganzen Haufen von Arbeiten, aber das zählte nicht und wurde nicht in marktwirtschaftliche Werte umgerechnet. Ein Beispiel: Als die erste Wäscherei in Polen eröffnet wurde und man seine schmutzige Wäsche hinbringen und waschen lassen konnte, sparte das enorm viel Zeit. Ich erinnere mich, wie meine Mutter zwei Tage in der...