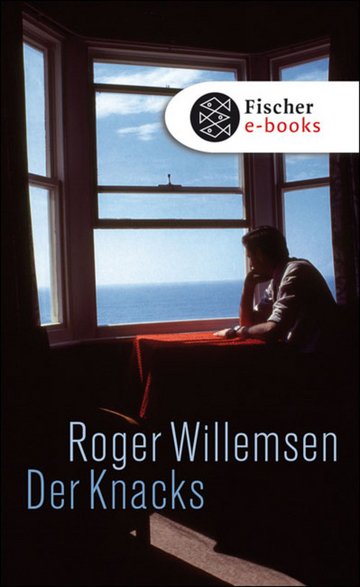Das weiße Huhn
Mein Vater starb letzten August. Das ist jetzt bald vierzig Jahre her.
Der Tag war so heiß, dass die Vögel unter den Blättern blieben und alles ringsum sich verlangsamte. Wir dachten an die Hitze des Krankenzimmers, des Krankenbetts, in dem der inzwischen zu einem dünnen Herrn zusammengeschmolzene Mann seinen Tod erwartete. Dass es Regen geben solle, war das Thema auf den Fluren. Erst für den Abend wurde er erwartet, als er endlich fiel, war er der erste Regen, den mein Vater nicht mehr erleben sollte.
In München nahmen an diesem Tag ein paar Männer die Kunden und Angestellten einer Bank als Geiseln und verlangten 500 000 Mark. Die Eilmeldungen im Radio überschlugen sich, dauernd gab es »neue Entwicklungen«, das Land blickte nach München. Wir nicht.
Mittags aß ich bei einem Freund, folgte aber dem Tisch gespräch nicht, bis ein Erwachsener eine längere Geschichte abschloss mit dem Seufzer:
»Unsere Familie wurde geboren, Gräber zu füllen.«
In die Pause, die folgte, schepperte das Gelächter, erst langsam, dann selbstbewusst. Man traute sich, die drastische Formulierung mit Ironie zu beantworten. Ein Aperçu war geboren. In die Pause, die diesem folgte, sagte ein anderer:
»So gesehen, dauert der Tod ein Leben lang.«
Die beiden Sätze standen unverbunden nebeneinander, und aus der Pause, die dann folgte, erhob sich kein Gelächter mehr.
Komische Art, sich zu unterhalten, war alles, was ich dachte.
In den Wochen davor war meine Mutter täglich ins Krankenhaus gefahren, einen Krebsbunker mit massiven Strahlungsapparaten, Kobalt Kabinen, dreißigjährigen Untoten auf den Fluren und diesem einen, nie mehr aufzulösenden Geruch. Nicht Kampfer, nicht Melisse roch so, unnatürlich, chemisch, strahlend roch es.
Die Gesichter der Patienten hatten etwas Unheilbares, sie trugen den Ausdruck offener Wunden im Gesicht und irrten herum auf der Suche nach einer Wunde, mit der sie hätten reden können. Wir Kinder hatten in diesem Augenblick das Leben vor uns, im Doppelsinn. »So ist das Leben« oder »Das Leben kann grausam sein«, sagten die Erwachsenen, das waren auch in Kinderohren keine besonders tiefsinnigen Sätze. Aber dass es immer ums Ganze ging, ängstigte uns, und so wurden zu unserem Schutz nur drei Krebsbunker Besuche pro Woche angesetzt.
Im Radio hörten wir das Wort »Geiseldrama« zum ersten Mal, und wir erfuhren auch noch, dass inzwischen zwei Menschen zu Tode gekommen waren. Eines der Opfer, eine schüchterne Bankangestellte, vielleicht auch erst eine Auszubildende, wirkte auf dem Porträtfoto in der Zeitung, als habe sie mit dem Gesicht, das zu ihrem Tod passte, schon länger gelebt.
Mein Vater lag im Sterben. Irgendjemand sagte, er habe jetzt seinen Geschmackssinn eingebüßt. Der sollte nicht wieder kehren. So war also der Tod über seinen Geschmackssinn in sein Leben gekommen.
Mein Vater lag im Sterben, ich dachte, dass selbst das an einem heißen Tag mühevoller ist, und ging in den Garten. Ganz hinten, wo ich mit zwölf Jahren versucht hatte, einen Zipfel Erde selbst zu bebauen, um es mit dreizehn wieder aufzugeben, irrte bei der Himbeerhecke ein weißes Huhn durch das hohe Gras, flatterte vom Boden auf, kam nicht über den Zaun, scheute die dornige Hecke und wusste nicht ein noch aus.
Ich ergriff also das Huhn mit beiden Händen, legte es, beschirmt von den Armen, an meine Brust und machte mich auf den Weg zu den umliegenden Bauernhöfen, den Besitzer des Tiers ausfindig zu machen. Das Huhn war ganz ruhig geworden, aber ich spürte den zerbrechlichen Brustkorb, die Wärme seines Blutes, das Schaudern, das über die Federn lief, ehe sie sich abrupt aufplusterten, und da alle Bauern über dem schneeweißen Tier die Köpfe schüttelten, lief ich weiter, bis hinab ins Unterdorf, und auf einer anderen Straße wieder aufwärts, bis ich auf halber Höhe an einen Hof kam, wo mir die Bäuerin freudestrahlend das Tor öffnete und das Huhn mit einem Schwall von Koseworten bedachte. Ich nahm es in beide Hände, legte es an den Busen der Bäuerin und ging heim.
In der Garderobe stand meine Mutter und sagte: »Der Vater ist tot.«
Es klang wie der Vater aller. Vater unser.
Dieser Moment hatte ein langes Leben.
Wir Kinder erschraken nicht, sondern gingen ins Zimmer, wo die vorsorglich angeschaffte Trauerkleidung schon bereit lag wie die Schwimmweste für den Schiffsreisenden. Meine Schwester erhielt einen schwarzen Faltenrock mit schwarzer Bluse und sah aus wie eine Pfarrhelferin. Wir Jungen bekamen schwarze Banilon Pullover mit Rollkragen, zu heiß, aber wer erwartet den Tod schon im Hochsommer? Wir fühlten uns gezeichnet von diesen Kleidern, entstellt.
Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht jung, wollte es aber später werden. Etwas veränderte, etwas verschob sich, nicht gleich, sondern im Lauf der nächsten Monate, etwas, das einen Namen suchte und nicht »Erwachsenwerden« heißen wollte und nicht »Halbwaise«. Es gab überhaupt keinen Namen für dieses langsame Hinübergleiten von einem Zustand in einen anderen. Ich meine nicht die Trauer, die abverlangte, ritualisierte Trauer, die eher Ironie herausforderte oder belastend wirkte, weil wir nicht auf Partys gehen durften, jetzt, da wir sie nach zwei Jahren an der Seite eines Sterbenden vielleicht am ehesten gebraucht hätten. Ich meine ein Abfallen der Lebens temperatur, ein erstes Verschießen der Farben. Etwas wie Appetitlosigkeit machte sich breit. An ihrem Anfang stand kein Schock und kein Trauma, es gab kaum mehr als einen Anlass – was folgte, war der Knacks.
Ich wollte einfach ein Kind sein, auf dem Land leben, mit dem Pferdewagen des Bauern zum Holzmachen in den Wald fahren. Ich wollte dem Schmied beim Beschlagen der Pferde zusehen, den Betrunkenen vom Bürgersteig vor dem Gast haus aus zuhören, und ich wollte ein weißes Huhn im Arm halten, es von Hof zu Hof tragen. Die Luft sollte frisch, nach Land duftend und appetitanregend sein, der Rittersporn sollte blühen.
Es wäre leicht zu sagen: An jenem Tag ging die Kindheit zu Ende. Aber nein, diese Kindheit hatte einen langen Bremsweg. Eher war meine Begegnung mit dem weißen Huhn ein katalysatorisches Ereignis: Wie bei einem chemischen Experiment kam hier etwas hinzu, das in die Reaktion der Stoffe nicht eintrat und diese trotzdem freisetzte. Dieses Dritte verbrauchte sich nicht. Das weiße Huhn wird immer dieses Huhn bleiben, aber der Tod meines Vaters wäre ein anderer gewesen, hätte ich nicht an jenem Tag das warme Lebewesen zwischen meinen Händen gefühlt, hätte ich nicht diese Seele heimgetragen.
Da mein Vater mitten in den Sommerferien gestorben war, sprach sich nach Schulbeginn die Nachricht erst langsam herum. Auf dem Lehrplan des Biologieunterrichts stand »der Mensch«. Das kam mir entgegen, dachte ich doch dauernd in Komplexen wie »das Leben«, »das Schicksal« oder eben »der Mensch«. Aber gleich in der ersten Stunde wurde ins Klassen zimmer ein Skelett gerollt, das unmenschlich wirkte. Ich sehe noch, wie es auf seinen Rädern vor der gefürchteten Lehrerin in der Tür des Klassenraums erschien, als ein Mitschüler zu mir herüberrief: »Schau mal, Roger, dein Vater kommt zur Elternsprechstunde!« Ich drehte mich nicht um, konnte aber hören, wie sie ihn prügelten, ihm die Schnauze stopfen wollten, dem Ahnungslosen, der erst am Vortag aus den Ferien heimgekehrt und nicht verständigt worden war, und da tat er mir so leid, wie ich mir selbst leidtat.
Doch andererseits: Was war diese Szene schon mehr als ein konventioneller Verstoß, die Pietätlosigkeit eines Unwissenden? Sie spielte sich auf der Ebene der Formen ab, und was haben die schon mit der Trauer zu tun? Jeden Tag gab es hundert Situationen, die mich ebenso eindringlich an meinen Verlust erinnerten. Ein Klavier musste nur von Dur zu Moll wechseln, ein Mann mit einer Zeitung unter dem Arm die Straße überqueren, jemand musste in einer Geste verharren, eine Schaufensterpuppe imitierend. Es reichte der Pfiff des Schiedsrichters vom benachbarten Fußballplatz oder eine Wolke aus Terpentin und Leinöl, ein Blend aus Wildleder und Zigarette – die ganze Welt war kontaminiert mit Begriffen, Namen, Aromen, lauter Dingen, deren Trägermedium das Leben meines Vaters gewesen war und die nun frei durch die Welt flogen – eine väterliche Welt, aus der es kein Ausbrechen gab.
Ein einzelner Lebenstag – und jeder spülte uns weiter heraus aus der Zeit, die auch seine gewesen war – steckte voller Verletzungen wie jene unabsichtliche Bemerkung des Mitschülers. Der entschuldigte sich nach der Stunde unter Tränen. Um ihn zu trösten, sagte ich, dass es nicht so schlimm sei – was er, sagte er zu den anderen zurückkehrend, »doch irgendwie schlimm« fand.
Dem Jungen erscheint der Vater meist erwachsener als die Mutter. Die Welt des Heranwachsenden ist deshalb fast zwangsläufig väterlich. Ich wurde wie von einem Laufband in eine Sphäre geschoben, in der seine Abwesenheit thronte wie eine Person. Der Verlust ersetzte mir den Vater. Ich adoptierte diesen Mangel wie einen Menschen, und was immer mir fehlte, war dem imaginären Patronat des Verlusts unterstellt. So etwa.
Es geht nicht um den Verlust, um die Entbehrung, die sich fühlbar macht, verbleicht und verschwindet. Es geht nicht einmal um den Verlust, der bleibt. Er könnte den Resonanzboden der Erfahrungen voluminöser klingen, die Konturen schärfer erscheinen lassen. Der Knacks aber ist nicht ein Riss mit Diesseits und Jenseits, mit Vorher und Nachher, er ist unmerklich: er teilt nicht, er prägt. Er ist die Zone, in die die Erfahrung eintritt, wo sie verwittert und ihre Verneinung in sich aufnimmt. Etwas soll nicht mehr, etwas wird nicht mehr sein....