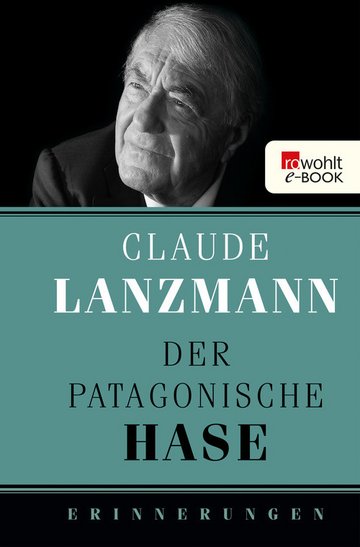KAPITEL I
Die Guillotine – und ganz allgemein die Todesstrafe und die verschiedenen Arten ihrer Vollstreckung –, das wird die wichtigste Angelegenheit meines Lebens gewesen sein. Früh ist es damit losgegangen. Ich war vielleicht zwölf Jahre alt, nicht älter; die Erinnerung an den Kinosaal in der Rue Legendre im XVII. Pariser Arrondissement mit seinen roten Polstersitzen und seinen matt gewordenen Vergoldungen ist in mir nach wie vor erstaunlich lebendig. Ein Hausmädchen hatte die Abwesenheit meiner Eltern genutzt und mich dorthin mitgenommen. Der Film, der an jenem Tag gezeigt wurde, hieß L’Affaire du courrier de Lyon, mit Pierre Blanchar und Dita Parlo. Den Namen des Regisseurs weiß ich nicht mehr, und ich habe auch nie versucht, ihn herauszufinden; er muss aber sehr gut gewesen sein, weil ich gewisse Szenen nie vergessen konnte: den Überfall auf den Rumpelkasten des Kuriers von Lyon in einem finsteren Wald, den Prozess gegen Lesurques, der unschuldig zum Tode verurteilt wird, das Schafott mitten auf einem großen Platz, der in meiner Erinnerung weiß ist, das herabsausende Fallbeil. Man guillotinierte damals, wie während der Revolution, in der Öffentlichkeit. Monatelang wachte ich gegen Mitternacht auf, von entsetzlichen Schreckbildern verfolgt, mein Vater musste aufstehen, in mein Zimmer kommen, mir über die Stirn und die vom Angstschweiß nassen Haare streichen, mir zureden, mich beruhigen. Man köpfte mich nicht nur, es kam auch vor, dass man mich «der Länge nach» zerschnitt, wenn ich es so sagen kann, so wie einen Baumstamm im Sägewerk, was mich jetzt an die erstaunliche Aufschrift «Männer 40 – Pferde (der Länge nach) 8» an den Türen der Güterwaggons erinnert, die 1914 Männer und Tiere an die Front und ab 1941 die Juden zu den fernen Kammern ihrer letzten Marter brachten. Man zersägte mich in Scheiben, flach wie Bretter, von einer Schulter zur anderen, dabei wurde auch der Schädel bis oben hin zerteilt. Die Albträume waren so heftig, dass ich als Jugendlicher und sogar noch als Erwachsener jedes Mal, wenn ich in einem Geschichtswerk, einem Buch, einer Zeitschrift eine Guillotine abgebildet sah, vor lauter Angst, die Bilder in mir wieder zum Leben zu erwecken, abergläubisch die Augen abwenden oder schließen musste. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir nicht auch heute noch so gehen würde. 1938 – ich war dreizehn Jahre alt – hielten die Verhaftung und die Geständnisse eines deutschen Mörders, der Eugen Weidmann hieß, ganz Frankreich in Atem. Noch heute erinnere ich mich, ohne dass ich groß nachdenken müsste, an die Namen einiger seiner Opfer (er tötete kaltblütig, weil er stehlen und keine Zeugen zurücklassen wollte): die Tänzerin Jean de Koven, einen gewissen Roger Leblond und noch andere, die er im Wald von Fontainebleau verscharrte oder in dem von Fausses-Reposes (ein sehr passender Name). Die Wochenschau im Kino zeigte mit verschwenderischen Details die Ermittler, die das Unterholz durchsuchten und die Leichen ausgruben. Weidmann wurde zum Tode verurteilt und vor dem Eingangstor des Gefängnisses von Versailles im Sommer vor dem Krieg mit der Guillotine hingerichtet. Von dieser Enthauptung gibt es berühmte Fotos. Ich habe sie mir erst sehr viel später ansehen wollen; ich habe es lange getan. Dies war die letzte öffentliche Hinrichtung in Frankreich. Danach wurde das Schafott – und zwar bis zum Jahr 1981, als die Todesstrafe auf Betreiben von François Mitterrand und Robert Badinter abgeschafft wurde – jeweils im Innenhof des Gefängnisses errichtet. Mit dreizehn Jahren ließ mich die gleichlautende Schlusssilbe seines und meines Namens – Weidmann, Lanzmann – ein verhängnisvolles Schicksal erahnen. Übrigens darf ich mir, obwohl ich diese Zeilen in einem doch schon fortgeschrittenen Alter schreibe, des guten Ausgangs keineswegs sicher sein: Die Todesstrafe kann jederzeit wieder eingeführt werden, eine Verschiebung der Mehrheit, eine Abstimmung, eine große Angst reichen dafür aus. Auch ist die Todesstrafe bei weitem nicht überall auf der Welt abgeschafft, das Reisen bleibt also gefährlich. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jean Genet, bei dem wir über meine alte Angst, unter der Guillotine zu sterben, sprachen (wir gingen aus von der Widmung seines Werkes Notre-Dame-des-Fleurs an einen mit der Guillotine hingerichteten Zwanzigjährigen: «Ohne Maurice Pilorge, dessen Tod mir immer noch das Leben vergällt …», und es war dort ja auch die Rede von Weidmann, da das Buch mit seinem Namen beginnt: «Weidmann, den Kopf in schmale, weiße Bänder gehüllt, als Nonne und als verletzter, zwischen Roggenähren gestürzter Flieger, erschien euch in einer Fünf-Uhr-Ausgabe …»). Er hatte mir trocken geantwortet: «Bis dahin ist noch Zeit.» Er hatte recht. Er mochte mich nicht, ich erwiderte dieses Gefühl.
Ich habe keinen Hals. In nächtlichen Momenten der Koenästhesie, in denen ich mir das Allerschlimmste ausmale, habe ich mich oft gefragt, wo genau das Fallbeil bei mir auftreffen müsste, um mir den Kopf regelrecht abzutrennen. Ich kam immer nur auf die Schultern, und die aggressive Verteidigungshaltung, die ich Nacht für Nacht in den Albträumen einnahm, welche der Urszene des Todes von Lesurques folgten, hatte diese zum morrillo, dem muskulösen Nacken eines Kampfstiers, werden lassen, so undurchdringlich, dass die Schneide abprallen und an ihren Ausgangspunkt zurückschnellen musste, von Rückstoß zu Rückstoß mit weniger Wucht. So scheint es, als hätte ich mich im Lauf der Zeit «kleingemacht», um der Klinge der Witwenmacherin keinen geeigneten Angriffspunkt und keine Gelegenheit zu geben, das Ihrige zu tun. In der Sprache der Boxer drückt man das anders aus: Ich bin im crouch herangewachsen, den Rumpf so stark gekrümmt, dass die Fäuste des Gegners abgleiten, ohne wirklich zu treffen.
In Wahrheit waren mein Leben lang – ohne Unterlass – die Abende (wenn ich wusste, was kam, wie oft während des Algerienkriegs) vor und die Tage nach einer Hinrichtung Zeiten des Schreckens, in deren Verlauf ich mich zwang, die letzten Augenblicke, Stunden, Minuten, Sekunden der Verurteilten vorwegzunehmen oder nachzuspüren, was auch immer die Gründe für das verhängnisvolle Verdikt gewesen sein mochten. Die lautlos gleitenden Filzpantoffeln der Aufseher in den Todesgängen, das plötzliche Rütteln an den Riegeln der Zelle, das jähe Hochfahren des verstörten Gefangenen aus dem Schlaf, der Direktor, der Staatsanwalt, der Anwalt, der Priester, das «Seien Sie tapfer!», das Glas Rum, die Auslieferung an den Scharfrichter und seine Gehilfen mit dem augenblicklichen Übergang zu nackter Gewalt und die brutale Beschleunigung der letzten Szene: gewaltsam nach hinten gebogene oder im Rücken gefesselte Arme, grob mit einem Seilstück zusammengebundene Fußgelenke, das mit einer Schere zerfetzte Hemd, um den Hals frei zu machen; unter Stößen und Zurufen wird der Mann mehr einhergezerrt, als dass er selbst ginge, seine Füße schleifen über den Boden bis zur Tür, die sich unvermittelt vor der Maschine auftut: steil aufgerichtet, hoch, wartend, in der fahlen Morgendämmerung des Gefängnishofes. Ja, ich kenne das alles. Jacques Vergès hatte Simone de Beauvoir und mich um neun Uhr abends zu sich bestellt und uns benachrichtigt, dass im Morgengrauen ein Algerier im Gefängnis von Fresnes, im Santé-Gefängnis von Paris, in Oran oder Constantine hingerichtet werden würde – und wir verbrachten Nächte damit, jemanden zu finden, der bei wiederum einem anderen telefonisch noch Fürsprache einlegen könnte, der es seinerseits … wagen würde, den General de Gaulle zu wecken und ihn anzuflehen, in letzter Sekunde den Unglücklichen zu schonen, dem er ja schon die Begnadigung verweigert und den er im vollen Bewusstsein seines Handelns auf das Schafott geschickt hatte. Vergès stand damals an der Spitze eines «Kollektivs» von Rechtsanwälten der algerischen Befreiungsfront, die etwas praktizierten, was sie «Verteidigung durch Nichtanerkennung» nannten: Sie sprachen den französischen Gerichten das Recht ab, über algerische Unabhängigkeitskämpfer Urteile zu fällen, mit der Folge, dass manche ihrer Mandanten umso rascher zur Guillotine befördert wurden. Eines Nachts, schon spät und in dem Bewusstsein äußerster Dringlichkeit, gelang es Castor und mir unter dem kalten Blick von Vergès, François Mauriac zu alarmieren. Ein Mensch sollte sterben, man musste ihn retten; was verfügt worden war, konnte noch rückgängig gemacht werden. Mauriac begriff das sehr wohl, aber er wusste, dass man de Gaulle nicht weckt und dass es ohnehin nichts genützt hätte. Es war zu spät, absolut zu spät. Für Vergès, dem die Vergeblichkeit unserer Bemühungen völlig bewusst war, gehörte unsere Anwesenheit in seiner Kanzlei während jener Hinrichtungsnächte zu einer politischen Strategie. Wir willigten in sie ein, weil wir uns seit Anbeginn für die Unabhängigkeit Algeriens eingesetzt hatten, aber das Gefühl der Ausweglosigkeit wurde für mich stärker als alles andere und steigerte sich ins Unerträgliche, je näher die Schicksalsstunde rückte. Die Zeit dehnte sich und widersprach sich selbst, wie ein Galopp in Zeitlupe: Dieser programmierte Tod hörte nicht auf zu geschehen. Wie in dem Raum, wo Achilleus niemals die Schildkröte einholen kann, teilte sich hier die Zeit mit ihren Sekunden ins Unendliche auf und steigerte die Folter durch das Bevorstehende bis zum Höhepunkt. Vergès, schließlich telefonisch informiert, machte der Sache ein Ende; wir standen am frühen Morgen draußen im Regen, Simone de Beauvoir und ich, niedergeschlagen, leer, von jedem Vorhaben abgeschnitten, als ob die Guillotine auch...