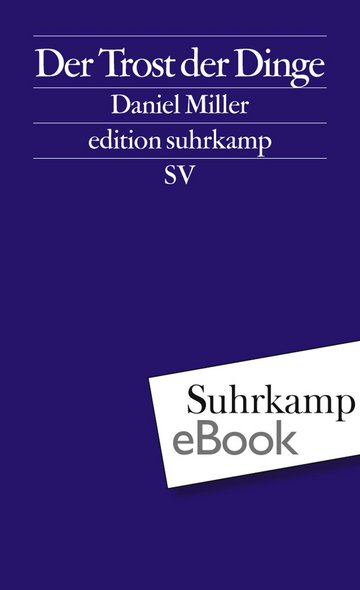VORWORT
Die in diesem Buch porträtierten Menschen wohnen in einer gewöhnlichen Straße in einem der südlichen Stadtteile Londons. Zusammen mit Fiona Parrott, die ihre Dissertation an meiner Fakultät vorbereitete, habe ich im Rahmen einer siebzehn Monate währenden Feldstudie insgesamt einhundert Haushalte in dieser Straße besucht. In der Studie ging es – wie in diesem Buch – um die Frage, wie sich die Persönlichkeit und die Lebensverhältnisse eines Menschen in den Dingen widerspiegeln, mit denen er sich innerhalb seiner eigenen vier Wände umgibt, anders gesagt: um die Rolle, die alltägliche Objekte für unser Verhältnis zu uns selbst und unsere Beziehungen zu anderen Menschen spielen. Wir leben in einer Welt voller Gegenstände und werden von Waren und Kaufangeboten regelrecht überschwemmt. Wir werfen uns selber vor, daß wir immer oberflächlicher und materialistischer würden, daß uns Dinge längst wichtiger seien als Menschen. Dieser Pauschalvorwurf ist derart gängig geworden, daß wir seine Stichhaltigkeit nicht mehr anhand der Realität überprüfen. Wer dieses Buch liest, wird allerdings feststellen, daß sehr oft das Gegenteil zutrifft: daß unser Verhältnis zu den Dingen keineswegs oberflächlich ist und daß es sich sogar förderlich auf unsere Beziehungen zu anderen Menschen auswirkt. Die extremen Pole des Umgangs mit den Dingen und ihre Folgen für das Beziehungsleben begegnen uns gleich eingangs in den mit »Leere« und »Fülle« überschriebenen Kapiteln.
Das London der Gegenwart zeichnet sich durch die beispiellose Diversität seiner Bewohner aus. Allerdings spielt sich deren Leben zu großen Teilen hinter verschlossenen Türen ab, in ihren Wohnungen und Häusern. Es scheint unmöglich, ihre Lebensverhältnisse, Erfahrungen und Überzeugungen kennenzulernen, etwas über die Dinge zu erfahren, die sie traurig oder glücklich machen – wenigstens solange es sich nicht um Fernsehstars, sondern um ganz normale Menschen handelt. Es gibt, so glaubt man, keine Möglichkeit, von Fremden solche Informationen zu erhalten.
Es gibt sie aber doch. Man klopft dazu einfach an die Tür einer Wohnung oder eines Hauses und fordert den Bewohner auf, einem etwas über sich zu erzählen. Wenn man ihm glaubwürdig versichert, weder Staubsauger verkaufen zu wollen noch im Auftrag Jehovas unterwegs zu sein, läßt er einen vielleicht ein. Wir jedenfalls wurden eingelassen. Direkte Fragen nach dem Privatleben haben wir allerdings tunlichst vermieden. Gerade Engländer kann man damit leicht in Verlegenheit bringen. Menschen aus anderen Ländern wiederum bringen manchmal uns in Verlegenheit, indem sie auf eine beiläufige Frage hin ihre ganze Lebensgeschichte referieren. Manchmal hat man dabei den Eindruck, einem eigens für solche Gelegenheiten auswendig gelernten Text zu lauschen, der eher Rechtfertigung oder Selbsttherapie als sachlicher Bericht ist. Sprachliche Mitteilungen sind zuweilen bewußt so gehalten, daß sie mehr verschleiern als enthüllen. Man kann also durchaus wildfremde Menschen nach ihren Lebensverhältnissen fragen, nur sind die Antworten oft weniger aussagekräftig als erhofft.
Wir haben daher einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben nicht nur die Bewohner der Häuser und Wohnungen in der – wie wir sie hier nennen wollen – »Stuart Street« befragt, sondern auch die Häuser und Wohnungen selbst. Wir befragten die Wandgemälde, die Kleidung, in der uns der Bewohner entgegentrat, den Stuhl und das Sofa, auf denen wir Platz zu nehmen gebeten wurden, das Badezimmer, in das wir zum Pinkeln gingen, die Photographien von Bekannten und Verwandten auf der Kommode, den Nippes auf dem Kaminsims. Auf den ersten Blick ein absurdes Unterfangen. Wie kann man denn Gegenstände befragen, die, wie jedes Kind weiß, stumm sind?
Oder gibt es doch eine Möglichkeit, sie zum Sprechen zu bringen? Was der Bewohner einer Wohnung oder eines Hauses über sich selbst, sein Leben und seine Beziehungen denkt, erfahren wir aus seinen Antworten auf unsere Fragen. Zugleich aber spiegeln sich seine Ansichten und Erfahrungen in der Einrichtung der Zimmer wider, im Wandschmuck und den Teppichen, den Möbeln, die er ausgesucht und angeschafft, in den Kleidern, die er am Morgen angezogen hat. Das eine oder andere Stück hat er womöglich nur geschenkt bekommen oder geerbt – aber er hat es immerhin nicht weggeworfen, sondern in seine minimalistisch karge Wohnung oder sein bis unters Dach vollgestopftes Haus aufgenommen. Jedenfalls befinden sich die meisten Gegenstände nicht zufällig hier, sondern weil sie in irgendeiner Beziehung zum Bewohner des Haushalts stehen. Wenn es uns gelingt, diese Gegenstände zum Sprechen zu bringen, geben sie ein zweites, nicht weniger authentisches Statement ab. Auch dieses Statement ist natürlich konstruiert, aber nicht nach den Regeln der Sprache.
Ich halte mich übrigens nicht für Sherlock Holmes oder Hercule Poirot, ich will auch nicht wie das Team von »CSI« nach Indizien schnüffeln, um Geheimnisse aufzudecken. Während Detektive und Forensiker in der Regel nach unabsichtlich hinterlassenen Spuren suchen, ging es mir um das, womit jemand ganz bewußt, und nicht selten mit der Leidenschaft eines Künstlers, seiner Persönlichkeit Ausdruck verleiht. Jede Wohnung ist ein mal mehr, mal weniger gewolltes Selbstporträt ihres Besitzers. Fünfzehn solcher Selbstporträts versuche ich in diesem Buch so getreu wie irgend möglich nachzuzeichnen.
Und es sind wahrhaft eindrucksvolle Bilder! Unsere einzige Ausgangshypothese lautete, daß wir nicht wußten, was uns in der Stuart Street erwarten würde. Sie erwies sich als vollkommen richtig. Wir ahnten nicht, daß wir eines Morgens einem Mann begegnen würden, der für den Tod Dutzender Unschuldiger verantwortlich war. Daß wir das bezauberndste Weihnachtsfest seit Fanny und Alexander erleben würden. Oder daß wir jemanden treffen würden, der mit Hilfe seiner CD-Sammlung vom Heroin losgekommen war. Vor unserer Studie wußte ich weder, daß bei Ebay ein schwungvoller Handel mit altem Fisher-Price-Spielzeug stattfindet, noch, daß es gute Gründe geben kann, die Happy Meals von McDonald’s in den Himmel zu loben. Auch hätte ich nicht gedacht, daß ein Laptop der Fortführung der Gebräuche australischer Ureinwohner dienlich sein, daß man sein Gedächtnis mit Hilfe von Tätowierungen steuern oder die Hauptstadt von Estland für einen entfernteren Vorort Londons halten kann. Man mußte wohl nicht unbedingt damit rechnen, in einer durchschnittlichen Londoner Straße auf einen manischen Exhibitionisten oder fanatische Anhänger des Feng Shui zu stoßen, aber wir hatten auch keine Vorstellung davon, mit welcher Zärtlichkeit man sich um einen Hund kümmern und aus welch zutiefst persönlichen Gründen man die unterschiedlichsten Dinge sammeln kann. Ich hatte weder erwartet, daß es Soziologielehrer gibt, die sich als Wrestler etwas dazuverdienen, noch daß einer unserer über einhundert Gesprächspartner meine Begeisterung für John Peel teilen oder daß ich soviel Neues über Pudding lernen würde. Ohne mir wirklich vorstellen zu können, wie und in welchem Ausmaß, erwartete ich lediglich eines, nämlich auf die Kümmernisse des Lebens und den Trost der Dinge zu treffen.
Dieses Buch handelt von Menschen, die in London leben. Keiner von ihnen verdient es, als Vertreter einer Gruppe oder Klasse behandelt und in eine Schublade gesteckt zu werden. London ist beispiellos. Nie zuvor konnten so viele Menschen unterschiedlicher Herkunft einander auf derart engem Raum begegnen – oder aus dem Weg gehen. Früher wurde sorgfältig zwischen Londonern und Zugezogenen unterschieden, man sprach von Multikulturalität und Minderheiten. Diese Phase hat die Stadt inzwischen hinter sich gelassen. Auch damals schon kam der Londoner von nebenan womöglich aus Griechenland oder den Vereinigten Staaten, heute trifft man immer mehr Osteuropäer in der Stadt – doch die Nachbarn können auch aus Südkorea, Brasilien oder Südafrika kommen, Iren, Pakistanis oder Israelis sein. Wir sollten uns allmählich daran gewöhnen, daß der typische Londoner Haushalt ebensogut aus einer Norwegerin und ihrem algerischen Ehemann bestehen kann. Was heißt also typisch? Wir sollten solche Kategorisierungen hinter uns lassen.
Und das betrifft nicht nur die Frage der Herkunft. Auch die Geschlechtszugehörigkeit und die sexuelle Orientierung können heute nicht mehr als eindeutig prägende Persönlichkeitsmerkmale gelten. Homosexuelle mögen inzwischen eine anerkannte Minderheit sein, aber deshalb sind sie einander noch längst nicht gleich oder auch nur ähnlich. Wir hatten nicht den Eindruck, daß die Schwulen und Lesben, denen wir im Rahmen der Studie begegnet sind, außer ihrer sexuellen Präferenz besonders viel miteinander gemein hatten. Ebenso verhält es sich mit der Klassenzugehörigkeit: Der Mann am Tresen, der wie das Inbild des maskulinen Arbeiters aussah, schien nichts mit dem Akupunkteur gemein zu haben, mit dem wir uns in der Eckkneipe unterhielten – bis sich herausstellte, daß der Akupunkteur im Arbeiterviertel Romford aufgewachsen war, während sich der vermeintliche Arbeiter als jobbender Student entpuppte. Schubladen erzeugen Vorurteile. Doch heute ziehen Senioren durch die Nachtclubs, während man auf gutbürgerlichen Partys Cockney hört. Ist sie nun sein Au-pair-Mädchen oder seine Frau?
Allerdings eröffnet London keineswegs allen denselben Freiraum. Für manche bestehen nach wie vor erhebliche Einschränkungen: Der soziale Hintergrund kann die Bildungsaussichten trüben, rassistische Vorurteile die Jobchancen. Auch werden nach wie vor Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Dennoch erscheint mir London als ein Ort, an...