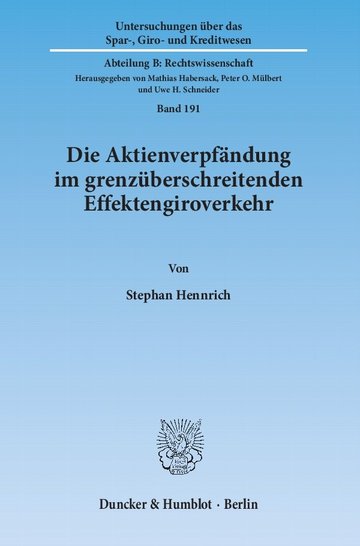| Geleitwort | 8 |
| Vorwort | 10 |
| Inhaltsübersicht | 12 |
| Inhaltsverzeichnis | 16 |
| Abkürzungsverzeichnis | 24 |
| A. Einführung | 28 |
| I. Problemstellung | 28 |
| II. Gang der Darstellung | 29 |
| B. Das System des Effektengiroverkehrs | 31 |
| I. Einleitung | 31 |
| II. Entwicklung des Effektengiroverkehrs | 32 |
| 1. Grundlagen | 32 |
| 2. Formen der Verwahrung von Aktien | 33 |
| a) Aktien im Eigenbesitz | 33 |
| b) Sonderverwahrung | 33 |
| c) Sammelverwahrung | 35 |
| aa) Grundlagen | 35 |
| bb) Haussammelverwahrung | 37 |
| cc) Girosammelverwahrung | 37 |
| (1) Begriff | 37 |
| (2) Entwicklung | 38 |
| 3. Die Globalurkunden: Immobilisierung und Entmaterialisierung | 40 |
| 4. Fazit | 44 |
| III. Funktionsweise des Effektengiroverkehrs | 44 |
| 1. Beteiligte Parteien | 44 |
| a) Anleger/Investor | 45 |
| b) Intermediäre | 45 |
| aa) Depotbank | 46 |
| bb) Zwischenverwahrer | 47 |
| cc) Zentralverwahrer | 47 |
| (1) Grundlagen | 47 |
| (2) CSD | 48 |
| (3) ICSD | 50 |
| 2. Internationalisierung des Effektengiroverkehrs | 51 |
| a) Einbeziehung ausländischer Wertpapiere in die inländische Girosammelverwahrung | 52 |
| aa) Unmittelbare Einbeziehung | 52 |
| bb) Zweitverbriefung | 53 |
| b) Gutschrift in Wertpapierrechnung | 54 |
| c) Internationale Vernetzung durch gegenseitige Kontoverbindungen | 57 |
| d) Fazit | 60 |
| 3. Systematik der Kontobuchungen | 60 |
| a) Beispielsfall | 61 |
| b) Mehrstufige Kontobeziehungen | 61 |
| 4. Verfügungen im Effektengiroverkehr | 63 |
| a) Vollrechtsübertragung | 63 |
| aa) Außerbörsliche Übertragung | 63 |
| bb) Börsliche Übertragung | 64 |
| b) Aktienverpfändung | 66 |
| aa) Die Bedeutung des Pfandrechts | 66 |
| (1) Verpfändung an einen Verwahrer | 66 |
| (2) Verpfändung an Dritte | 68 |
| bb) Vorteile gegenüber der Sicherungsübertragung | 68 |
| cc) Die Pfandrechtsbestellung in der Praxis | 70 |
| (1) Depotbuchhaltung des Drittverwahrers | 71 |
| (a) Allgemeines | 71 |
| (b) Depotarten | 71 |
| (c) Fazit | 72 |
| (2) Depotsonderformen auf Ebene der Depotbank | 72 |
| (a) Übertragung auf ein Depot des Pfandgläubigers | 73 |
| (b) Einrichtung eines Sperrdepots | 73 |
| (c) Einrichtung eines Und-Depots | 74 |
| (d) Einrichtung eines Pfanddepots | 75 |
| c) Fazit | 77 |
| IV. Zusammenfassung | 77 |
| C. Rechtlicher Rahmen der Verpfändung girosammelverwahrter Aktien | 79 |
| I. Grundlagen | 79 |
| 1. Typisierung | 79 |
| 2. Allgemeines zum (Vertrags-)Pfandrecht | 80 |
| a) Akzessorietät | 80 |
| b) Voraussetzungen | 80 |
| aa) Einigung | 80 |
| bb) Übergabe | 81 |
| cc) Verfügungsbefugnis und gutgläubiger Erwerb | 81 |
| c) Merkmale | 82 |
| aa) Rangfolge | 82 |
| bb) Schutz des Pfandrechts | 83 |
| cc) Verwertung | 83 |
| (1) Verfahren | 83 |
| (2) Insolvenzfestigkeit | 84 |
| 3. Die Aktie als Pfandgegenstand | 85 |
| a) Definition | 85 |
| b) Aktienarten | 87 |
| aa) Inhaberaktien | 87 |
| bb) Namensaktien | 88 |
| c) Anforderungen an die Verpfändung | 89 |
| II. Grundfall der Aktienverpfändung | 89 |
| 1. Wertpapierrechtliche Verpfändung | 90 |
| a) Abgrenzung | 90 |
| b) Inhaberaktien | 90 |
| c) Namensaktien | 91 |
| aa) Voraussetzungen | 91 |
| bb) Gutgläubiger Erwerb | 93 |
| d) Zusammenfassung | 94 |
| 2. Rechtsverpfändung | 95 |
| a) Zulässigkeit | 95 |
| b) Voraussetzungen | 97 |
| aa) Notwendigkeit einer Übergabe | 97 |
| (1) Allgemeines | 97 |
| (2) Namensaktien | 98 |
| (3) Inhaberaktien | 99 |
| (4) Fazit | 99 |
| bb) Gutgläubiger Erwerb | 99 |
| c) Zusammenfassung | 100 |
| III. Auswirkungen der Sonderverwahrung auf die Aktienverpfändung | 100 |
| 1. Grundlagen | 101 |
| 2. Besonderheiten bei der Verpfändung | 101 |
| 3. Fazit | 103 |
| IV. Auswirkungen der Girosammelverwahrung auf die Aktienverpfändung | 103 |
| 1. Grundlagen | 104 |
| 2. Voraussetzungen und Wirkungen der Verpfändung | 105 |
| a) Pfandgegenstand | 106 |
| b) Übergabe | 107 |
| aa) Besitzverhältnisse | 108 |
| (1) Grundlagen | 108 |
| (2) Stellung der Depotbank | 109 |
| (3) Stellung des Anlegers | 110 |
| (a) Anleger/Depotbank | 111 |
| (b) Anleger/Clearstream Banking AG | 112 |
| (aa) Besitzmittlungswille | 112 |
| (bb) Herausgabeanspruch | 113 |
| (a) § 7 Abs. 1 DepotG i.V.m. §§ 546 Abs. 2, 604 Abs. 4 BGB analog | 113 |
| (ß) §§ 8, 7 Abs. 1 DepotG | 115 |
| (4) Fehlendes besitzrechtliches Korrelat? | 117 |
| (5) Zusammenfassung und Fazit | 119 |
| bb) Konstruktion der Übergabe | 120 |
| (1) § 1205 Abs. 1 S. 1 BGB | 121 |
| (2) § 1205 Abs. 1 S. 2 BGB | 123 |
| (3) § 1205 Abs. 2 BGB | 124 |
| (4) § 1206 BGB | 125 |
| cc) Fazit | 126 |
| c) Gutgläubiger Erwerb | 127 |
| aa) Mitbesitz als hinreichender Rechtsscheinträger? | 128 |
| bb) Alternativen zum Mitbesitz als Rechtsscheinträger | 129 |
| cc) Fazit | 131 |
| d) Sonderproblem: Dauerglobalurkunde | 131 |
| aa) Besitzverhältnisse | 131 |
| bb) Verpfändung von dauerglobalverbrieften Aktien | 133 |
| cc) Gutgläubiger Erwerb? | 135 |
| dd) Fazit | 136 |
| V. Zusammenfassung | 137 |
| D. Das auf die Aktienverpfändung anwendbare Recht | 139 |
| I. Einleitung | 139 |
| II. Kollisionsrechtliche Grundlagen | 141 |
| 1. Schuldvertragsstatut | 141 |
| 2. Wertpapierrechtsstatut und Wertpapiersachstatut | 143 |
| a) Wertpapierrechtsstatut | 144 |
| aa) Umfang | 144 |
| bb) Gegenwärtiges Gesellschaftsstatut | 146 |
| cc) Ausblick: Reform des Internationalen Gesellschaftsrechts | 147 |
| b) Wertpapiersachstatut | 148 |
| 3. Insolvenzstatut | 149 |
| a) Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 | 150 |
| aa) Regelungsgehalt | 150 |
| bb) Begrenzter Anwendungsbereich | 151 |
| b) § 340 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 InsO | 152 |
| c) Fazit | 153 |
| 4. Sonderfall WR-Gutschrift: Zessionsgrundstatut | 154 |
| 5. Fazit | 157 |
| III. Die lex cartae sitae-Anknüpfung im grenzüberschreitenden Effektengiroverkehr | 157 |
| 1. Erfordernisse des grenzüberschreitenden Effektengiroverkehrs | 158 |
| a) Auslandsgeschäft in Wertpapieren | 158 |
| b) Einbeziehung ausländischer Wertpapiere | 159 |
| c) Gegenseitige Kontoverbindungen | 159 |
| d) Fazit | 161 |
| 2. Alternativen unter geltendem Recht | 162 |
| a) Wesentlich engere Verbindung, Art. 46 EGBGB | 162 |
| b) Außergesetzliches Wertpapierdepotstatut | 162 |
| 3. Zusammenfassung | 163 |
| IV. Sonderanknüpfung des § 17a DepotG – Europarechtliche Harmonisierung im Internationalen Wertpapierrecht | 164 |
| 1. Richtlinie 98/26/EG – Finalitätsrichtlinie | 164 |
| a) Anwendungsbereich | 165 |
| aa) Persönlicher Anwendungsbereich | 165 |
| bb) Sachlicher Anwendungsbereich | 167 |
| b) Regelungsgehalt | 170 |
| aa) Umfang der Verweisung | 170 |
| bb) Anknüpfungsmoment | 171 |
| c) Fazit | 173 |
| 2. Richtlinie 2002/47/EG – Finanzsicherheitenrichtlinie | 173 |
| a) Anwendungsbereich | 174 |
| b) Regelungsgehalt | 175 |
| c) Fazit | 177 |
| 3. Umsetzung durch § 17a DepotG | 178 |
| a) Anwendungsbereich | 178 |
| aa) Persönlicher Anwendungsbereich | 178 |
| bb) Sachlicher Anwendungsbereich | 179 |
| (1) Überschießende Umsetzung | 179 |
| (2) Erfordernis der rechtsbegründenden Wirkung? | 180 |
| (a) Wortlautorientierte Auslegung | 180 |
| (b) Gesetzgeberischer Wille | 182 |
| (c) Richtlinienkonforme Auslegung | 183 |
| (3) Erfassung von WR-Gutschriften | 185 |
| b) Regelungsgehalt | 186 |
| aa) Umfang der Verweisung | 186 |
| bb) Anknüpfungsmoment | 188 |
| 4. Fazit | 190 |
| V. Zusammenfassung | 191 |
| E. Die Entwicklung eines internationalen Rechts des Effektengiroverkehrs | 193 |
| I. Das Haager Wertpapierübereinkommen | 193 |
| 1. Entstehungsgeschichte | 193 |
| a) Die Haager Konferenz | 193 |
| b) Entwicklung und Status des Haager Wertpapierübereinkommens | 195 |
| c) Ausgangspunkt und Ziel des Übereinkommens | 197 |
| 2. Anwendungsbereich des Übereinkommens | 199 |
| a) Intermediär-verwahrte Wertpapiere | 199 |
| b) Folgerungen für den Anwendungsbereich | 201 |
| 3. Regelungsgehalt | 203 |
| a) Anknüpfungsgegenstände | 204 |
| b) Anknüpfungsmoment | 205 |
| aa) Das Anknüpfungsregime im Überblick | 206 |
| (1) Art. 4 HWpÜ | 206 |
| (2) Art. 5 HWpÜ | 208 |
| (3) Art. 6 HWpÜ | 209 |
| bb) Grundfragen der Anknüpfung | 210 |
| (1) PRIMA oder AAA? | 210 |
| (2) Vorteile der Rechtswahlmöglichkeit | 212 |
| cc) Page 37-Problem | 213 |
| (1) Problemstellung | 213 |
| (a) Bestimmung des maßgeblichen Intermediärs | 214 |
| (b) Statische Sachverhalte | 214 |
| (c) Dynamische Sachverhalte | 214 |
| (2) Behandlung nach dem Haager Wertpapierübereinkommen | 216 |
| (a) Stage-by-stage approach | 216 |
| (b) Super-PRIMA | 217 |
| (c) Lex creationis | 219 |
| (d) Fazit | 220 |
| (3) Auswirkungen des stage-by-stage approach | 220 |
| (a) Anwendung auf relative Berechtigungen | 221 |
| (b) Anwendung auf dingliche Berechtigungen | 223 |
| (aa) Statische Sachverhalte | 223 |
| (bb) Dynamische Sachverhalte | 224 |
| (4) Fazit | 225 |
| c) Insolvenzrechtliche Regelungen (Art. 8 HWpÜ) | 226 |
| 4. Zusammenfassung und Bewertung | 228 |
| II. Die UNIDROIT-Wertpapierkonvention | 230 |
| 1. Einführung | 231 |
| a) Die Organisation UNIDROIT | 231 |
| b) Entwicklung der Convention on Substantive Rules for Intermediated Securities | 232 |
| 2. Inhalt der UNIDROIT-Wertpapierkonvention | 233 |
| a) Grundlagen | 233 |
| b) Systematik | 234 |
| c) Regelungsgehalt der Konvention | 235 |
| aa) Definitionen, Anwendungsbereich und Auslegungsgrundsätze (Kapitel I) | 235 |
| bb) Rechte des Depotkunden (Kapitel II) | 236 |
| (1) Begriff | 236 |
| (2) Regelungsgehalt | 237 |
| (3) Fazit | 238 |
| cc) Verfügungen über Intermediär-verwahrte Wertpapiere (Kapitel III) | 239 |
| (1) Voraussetzungen einer Verfügung (Art. 11–Art. 13) | 239 |
| (a) Art. 11 UWpK | 239 |
| (b) Art. 12 UWpK | 240 |
| (c) Art. 13 UWpK | 243 |
| (d) Zusammenfassung | 243 |
| (2) Rangfolge (Art. 19 UWpK) | 244 |
| (3) Gutgläubiger Erwerb (Art. 18 UWpK) | 246 |
| (4) Insolvenzfestigkeit (Art. 14 UWpK) | 247 |
| (5) Fazit | 248 |
| dd) Weitere Regelungen (Kapitel IV und V) | 248 |
| 3. Einordnung der Konvention | 249 |
| a) Ergänzung des Haager Wertpapierübereinkommens | 250 |
| aa) Allgemeines | 250 |
| bb) Statische Sachverhalte | 250 |
| cc) Dynamische Sachverhalte | 251 |
| dd) Fazit | 253 |
| b) Vereinbarkeit mit deutschem Sachrecht | 253 |
| 4. Zusammenfassung | 254 |
| III. Europäische Bestrebungen | 255 |
| 1. Giovannini-Gruppe | 255 |
| 2. Kommissionsmitteilungen | 257 |
| 3. Legal Certainty Group | 260 |
| a) Mandat | 260 |
| b) Arbeit | 260 |
| c) Verhältnis zu UNIDROIT | 262 |
| 4. Ausarbeitung einer Wertpapierrechtsrichtlinie | 263 |
| 5. Fazit | 263 |
| IV. Zusammenfassung | 264 |
| F. Schlussbetrachtung | 267 |
| Literaturverzeichnis | 271 |
| Sachwortverzeichnis | 285 |