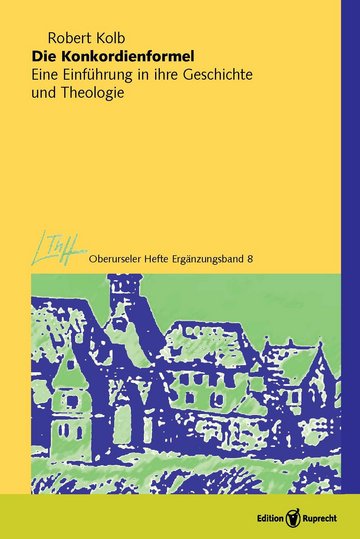Zur Einführung
Die in der Konkordienformel kodifizierte lutherische Theologie des konfessionellen Zeitalters stand in der protestantischen Kirchen- und Theologiegeschichte lange Zeit am Rande des wissenschaftlichen Interesses. Dies war nicht zuletzt Urteilen geschuldet, mit denen „die Orthodoxie“ seit dem späten 17. Jahrhundert von Theologen unterschiedlicher Richtungen bedacht worden war: Pietisten monierten, dass dem Eifer für die wahre, zumeist mit Mitteln scharfer Polemik verfochtene „Lehre“ kein entsprechender Einsatz für das „Leben“, für die Gestaltung der Frömmigkeit und der Gemeinschaft, entsprochen habe und dass sich die Orthodoxen vornehmlich auf die ‚öffentliche Religion‘ im konfessionell einheitlichen Territorialstaat bezogen, aber der persönlichen Lebensführung des verbindlich frommen Subjektes nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenkten. Die Aufklärer distanzierten sich im Namen der „vernünftigen Religion“ davon, dass die Orthodoxen dem Dogma der Verbalinspiration huldigten, partikulare Glaubenswahrheiten hypostasierten bzw. als heilsentscheidend behaupteten und die Abgrenzung von den innerprotestantischen Kontrahenten überstrapazierten. Sie drangen darauf, auch die kanonischen Urkunden des christlichen Glaubens historisch-kritisch zu verstehen und deren Geltungsansprüche in einer mit dem Selbst- und Weltverständnis des modernen Menschen vereinbaren Form zu kommunizieren. Für die Normativität eines historischen Lehrbekenntnisses ließ dies wenig Raum. Auf dieser Traditionslinie fortschreitend insistierten schließlich die liberalen Neuprotestanten des 19. Jahrhunderts darauf, die Dokumente der „altprotestantischen“ Tradition als nicht per se gültige Wahrheitsmanifestationen anzuerkennen sondern hinsichtlich ihres dem frommen Selbstbewusstsein plausiblen religiösen Gehaltes zu sichten und zu interpretieren. Pietisten, Aufklärern und Neuprotestanten war gemein, dass sie eher bei den Reformatoren – allen voran Luther – als bei seinen orthodoxen „Erben“ Ansätze für eine gegenwartsverantwortete Theologie zu finden meinten.
Auch die für die theologiegeschichtliche Entwicklung des 20. Jahrhunderts in mancher Hinsicht wichtig gewordene „Lutherrenaissance“ stand aufs Ganze gesehen in dieser Wertungstradition und verhielt sich gegenüber der als sklerotisiert geltenden Theologie des konfessionellen Zeitalters ausgesprochen spröde. Selbst da, wo man die in der Konkordienformel und in den orthodoxen Lehrsystemen thesaurierte theologische Gelehrsamkeit immer wieder einmal als Ausdruck achtunggebietender intellektueller Konsequenz bewunderte, widersetzte man sich dem Anspruch, dass sie die maßgebliche Normgestalt lutherischer Theologie enthielten. Der im Anschluss an die Konkordienformel gegebene Hinweis darauf, die Bekenntnisse seien im Vergleich zur Schrift als normierender Norm (norma normans) lediglich von abgeleiteter Bedeutung, nämlich „normierte Norm“ (norma normata), diente mit Vorliebe dazu, sich von ihnen zu distanzieren. Erst mit der an den Bekenntnisbegriff des Neukonfessionalismus anknüpfenden Dialektischen Theologie begann sich dies in gewissem Sinne zu ändern. Die pogrammatischen Abgrenzungen von den neuzeitlichen Transformationsgestalten des Protestantismus, die man hier inszenierte, schienen einen unmittelbareren Zugang zum „Altprotestantismus“ in seiner reformatorischen wie in seiner orthodoxen Gestalt nahezulegen und die Chance zu eröffnen, den vollen Sachgehalt der wahren Lehre jenseits ihrer historisierenden und relativierenden ‚Schwundformen‘ kennenzulernen. Ob aber der mit dem Schlagwort der „reformatorischen Theologie“ dann auf breiter Front und mit nachhaltigem Erfolg propagierte, tendenziell repristinative Gestus im ganzen mehr ist oder war als das Selbstmissverständnis einer gerade in ihren neuzeitkritischen Abwehrreflexen dezidiert neuzeitlichen Theologie, mag die weitere Theologiegeschichtsschreibung erweisen.
Eine andere Rezeptionsgeschichte der lutherischen Theologie des konfessionellen Zeitalters als die skizzierte, für den Hauptstrang des deutschen Protestantismus symptomatische, vollzog sich in seinen neokonfessionellen, ins „Freikirchliche“ tendierenden oder diesem zugehörenden Kontexten und Milieus. Bei den Altlutheranern etwa, auch in der US-amerikanischen „Lutheran Church – Missouri Synod“, suchte man das Gespräch mit den klassischen Bekenntnistexten und Lehrsystemen der lutherischen Tradition in einer Intensität und Direktheit, für die sich in der akademischen Universitätstheologie des deutschen Protestantismus des 19. und 20. Jahrhunderts nicht sehr viele Parallelen oder Analogien finden lassen. Das neokonfessionalistische Luthertum in der Vielgestaltigkeit seiner nationalen und institutionellen Formen wurde zu einem wichtigen Tradenten und Interpreten der „klassischen“ altprotestantischen Texte und Traditionsbestände und ist es bis heute geblieben.
Der Verfasser des vorliegenden Buches, Robert Kolb, emeritierter Professor für Systematische Theologie und Direktor des Institute for Mission Studies am Concordia Seminary in St. Louis, Missouri, steht in der spezifisch nordamerikanischen Tradition eines entschiedenen Luthertums, das den Bekenntnisschriften des 16. Jahrhunderts eine wichtige Orientierungsfunktion auch für die gegenwärtige theologische Urteilsbildung zuerkennt. Kolb kann als heute wohl bester Kenner der lutherischen Theologiegeschichte des konfessionellen Zeitalters in der englischsprachigen Welt gelten; sein literarisches Oeuvre ist so umfänglich, weit verstreut und reichhaltig, dass es auch kundigeren Forschern gelegentlich unterlaufen kann, die eine oder andere seiner Studien zu übersehen. Hinsichtlich des intellektuellen Profils freilich weist sein Oeuvre ein hohes Maß an Kohärenz, ja Homogenität auf. Auch in dem vorliegenden Werk sind einige der dafür charakteristischen Aspekte unübersehbar.
Für Kolb stellt sich die Entwicklung, die das Luthertum zwischen Luthers Tod und dem Abschluss der Konkordienformel nahm, als ein primär theologischer Vorgang dar. Nicht etwa die konfliktreichen Beziehungen zwischen den politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen „Sphären“, nicht die Konkurrenzen unterschiedlicher Stadt- und Territorialstaaten, nicht die Interessen weltlicher Obrigkeiten, die ihrer Verantwortung anvertrauten Gemeinwesen auch mit religiösen und disziplinatorischen Mitteln zu integrieren, nicht die kompetitiven Beziehungen zwischen unterschiedlichen Universitäten, „Netzwerken“ und „Wahrheitskartellen“, sondern die theologischen Sachfragen stehen für Robert Kolb vor allem anderen im Zentrum seines Bildes der theologischen Auseinandersetzungen zwischen 1546 und 1577/80. Zugleich verwendet er große Mühe darauf, die extensive lutherische Streitkultur eng an die Debatten der Reformatorengeneration heranzurücken. Der bei anderen Forschern zur Bezeichnung der Kirchen- und Theologiegeschichte vor allem der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts inzwischen aus der Mode gekommene Begriff der „Spätreformation“ ist deshalb durchaus programmatisch zu verstehen: Für Kolb geht die Reformation in den Klärungsdebatten der interimistischen, adiaphoristischen, synergistischen, antinomistischen etc. Auseinandersetzungen gewissermaßen weiter, ja vollendet hier ihren dogmatischen Gehalt. Im Kampf der Magdeburger gegen das Interim ein „Ende der Reformation“ zu sehen, weil die dortigen Akteure die Reformation „am Ende“ sahen und gerade im Bewusstsein dieses „Endes“ deren Reinszenierung ins Werk zu setzen suchten, geht nach Kolb nicht an; für ihn rundet sich die vera doctrina der Reformation erst in der Konkordienformel zu einem Ganzen.
Durch Impulse der Geschichtswissenschaft hat die Erforschung der „Konfessionalisierung“ in den letzten drei Jahrzehnten einen bemerkenswerten Aufschwung genommen. Das zentrale Anliegen dieses gesellschaftsgeschichtlichen Interpretaments und seines wichtigsten Protagonisten, des Frühneuzeithistorikers Heinz Schilling, besteht darin, den unauflösbar engen Zusammenhang herauszuarbeiten, der zwischen der Formierung der frühneuzeitlichen Konfessionen und den territorialen Staatsbildungsprozessen bestand. Im Zuge der Konfessionalisierungsforschung gerieten die drei frühneuzeitlichen Konfessionen also gleichsam als funktionale Momente eines kultur- und gesellschaftsgeschichtlichen Fundamentalvorgangs in den Blick, kaum jedoch als Entitäten, die um die theologische Wahrheit rangen und diese explizierten. An dieser Stelle setzen die Einwände Kolbs ein: Er versteht die theologischen Debatten des Luthertums gerade nicht als Elemente einer gesellschafts- und kulturgeschichtlichen Formierungsproblematik, sondern genau als das, was sie im Sinne ihrer Protagonisten zu sein beanspruchen, nämlich als Streit um eine theologische Wahrheit, der nachzudenken auch heute für lutherische Theologen als unveräußerliche Pflicht und reicher intellektueller Gewinn zu gelten hat. Kolb geht es also nicht primär um die zeitgenössische Gesellschaft und Kultur und die Frage der Rolle des Bekenntnisses in diesen Kontexten, sondern um die Kirche und die ihr eigene Kultur, die...