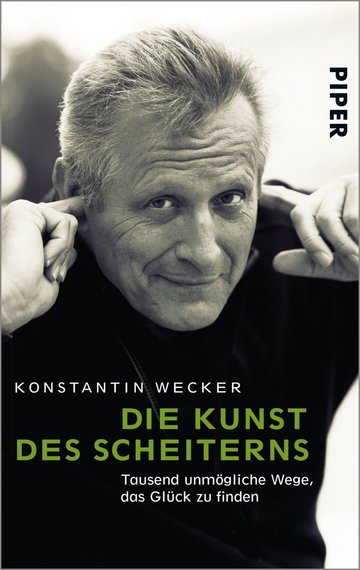begegnung mit dem wunderbaren
Bohr ein Loch in den Sand
sprich ein Wort hinein
sei leise
vielleicht
wächst dein kleines Vertrauen
irgendwann
groß in die Sonne.
(1965)
Als kleiner Junge fragte ich einmal meinen sanften, klugen Vater, ob es denn etwas gäbe, was ganz anders sei als alles, was man kennt. Anders als Menschen und Tiere und Dinge, anders als alle Farben und Klänge, ja sogar anders als das große, unbekannte Universum. Soweit ich mich erinnere, blieb mir mein Vater dieses Mal eine Antwort schuldig. Oder seine Antwort befriedigte mich nicht. Wie sollte er mir auch helfen? Selbst wenn er verstand, was ich meinte, wie sollte er Worte dafür finden?
Seitdem ließ mich die Sehnsucht nach dem ganz anderen nicht mehr los. Die Suche nach dem Unbekannten, Unerklärlichen, Unverfügbaren, Namenlosen. Die Suche nach dem Wunderbaren.
Diese verrückte Sehnsucht, etwas zu wollen, was man nicht kennt, hat mich wahrscheinlich dazu getrieben, Gedichte zu lesen und später dann selbst welche zu schreiben, hat mich dazu getrieben, stundenlang am Klavier zu improvisieren und mich später dann dem Leben und seinen Ausschweifungen hemmungslos hinzugeben.
Meine unvergessene Begegnung mit dem Wunderbaren bescherte mir Beethovens Violinkonzert.
Ich war gerade mal zwölf, allein zu Hause und lag auf dem Fußboden unseres Wohnzimmers vor dem Radioapparat.
Hatte ich vorher noch ohne ein bestimmtes Ziel einen einigermaßen rauschfreien Sender gesucht, so war ich schon nach wenigen Takten von der Schlichtheit des Geigenthemas berauscht.
Und schon bald konnte ich die Töne sehen, die Klänge schmecken und jedes einzelne Instrument des Orchesters deutlich unterscheiden. So plastisch hatte ich bis dahin noch nie Musik erlebt und so unabhängig von einem zeitlichen Ablauf.
Ich hatte damals wirklich das Gefühl, meinen Körper zu verlassen und mit den Tönen eins zu werden. Als wäre ich Komponist, Musiker und Zuhörer zugleich, nahm mich diese Musik mit auf eine Reise, die mich weg von der Realität und zugleich tief in mich hineinführte.
Nebenmotive sah ich als geometrische Linien um das Hauptthema kreisen, die Akkorde offenbarten sich mir als mathematische Formeln, und jeder Ton hatte seine eigene, unverwechselbare Farbe. Das D war orange, daran kann ich mich noch erinnern, in den tieferen Oktaven warm und dunkel, nach oben hin immer greller strahlend und von einer nie zuvor gesehenen Leuchtkraft.
Später, auf der Universität, habe ich einen Satz von Gottfried Wilhelm Leibniz gehört, der mir diese Schau der Töne auf eindrucksvolle Weise bestätigte: »Die Musik ist eine verborgene Übung der Seele, welche dabei nicht weiß, dass sie mit Zahlen umgeht.«
Mir war so warm und wohlig, und ich fühlte mich so aufgehoben in den Klängen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass dieser Augenblick der Verzückung jemals ein Ende finden würde.
Farben und Töne waren nicht mehr zu unterscheiden, die ganze Welt bestand aus Wellen, auf denen ich mich frei von körperlicher Schwere durch das Weltall treiben ließ.
Wahrscheinlich war es meine heimkehrende Mutter, die mich aus der Verzückung zurück auf die Erde brachte, oder vielleicht auch nur ganz banal das Ende des Konzertes – jedenfalls hatte Musik seitdem für mich eine andere Bedeutung.
Bis heute hoffe ich beim Musizieren ausschließlich dieses Erlebnis wiederzufinden.
»Die Spaltung, die mit dem Menschen in die Welt kommt und die er unvermeidbar als schmerzlich empfindet – die Trennung in Ich und Welt, Subjekt und Objekt, Sein und Bewusstsein, Endlichkeit und Unendlichkeit –, ist Schein, mangelnde Kunst; sie ist nur dadurch aufzuheben, dass die Welt von einem Nullpunkt her verstanden, das Differente als ein Auseinander desselben, als innere Aktion des Identischen bestimmt wird.«
Bei meinem (abgebrochenen) Studium der Philosophie in München habe ich leider nie etwas von Salomo Friedländer3 gehört. Vermutlich nur, weil ich ein ziemlich lausiger Student war.
Möglicherweise hätte mich dieser, zugegebenermaßen etwas komplizierte Satz, auf eine Fährte geführt, die mir an der Uni verschlossen blieb. Damals nämlich konnte mir die abendländische Philosophie nicht annähernd das geben, was ich suchte. Auch wenn ich dieses vorschnelle und jugendliche Urteil heute revidieren muss – damals schien die mir bekannte Philosophie eine ausschließlich die intellektuelle Eitelkeit befriedigende Hirngymnastik zu sein, eine Übung die meine wirkliche Sehnsucht nicht einmal im Ansatz befriedigen konnte.
Vielleicht auch war ich etwas verwöhnt durch meine Leidenschaft für die Musik, habe hier in Bereiche hineingehört, die sich mir durch das Denken nicht erschließen wollten.
Die Musik ist eine nonrationale Sprache, aber eben auch eine Sprache, mit deren Hilfe man sich verständigen kann, mit deren Hilfe man Antworten erhalten kann.
Gustav Mahler sagte einmal, beim Musikhören wie auch beim Dirigieren höre er ganz bestimmte Antworten auf all seine Fragen. Und empfinde dann ganz deutlich, dass es gar keine Fragen seien.
Das konnte mir die Philosophie nicht bieten, sie hatte keinen »Soul«, sie ging nicht ins Blut, sie hatte nichts mit mir zu tun.
Dann entdeckte ich, beim Stöbern in der Universitätsbuchhandlung, gut versteckt in der hintersten Ecke, ein verstaubtes Buch: »Auf der Suche nach dem Wunderbaren«. Peter D. Ouspensky4 versuchte, den Menschen die Notwendigkeit der Arbeit an sich selbst näherzubringen, denn den Erfahrungen der anderen zu folgen verstärke weder unser Verständnis noch verändere es uns. Der Mensch ist eine Maschine. Laut Ouspensky kann er aus eigener Kraft keinen einzigen Gedanken und keine einzige Handlung hervorbringen. Alles was er sagt, tut, denkt, fühlt – all dies geschieht.
Ein Beispiel aus diesem Buch wollte mir nicht mehr aus dem Kopf, es hat mich fasziniert, und ich habe bis heute kein besseres Bild gefunden für unsere Unzulänglichkeit, größere Zusammenhänge zu verstehen. Ich versuche, ohne Anspruch auf Werktreue, aus dem Gedächtnis zu zitieren:
Man stelle sich ein zweidimensionales kleines Wesen vor, das sich in einem dreidimensionalen Raum bewegt. Es wird immer nur eine Linie sehen. Einen Kubus kann es sich nicht mal denken. Und nun stelle man sich eine menschliche Hand vor, die ihre fünf Fingerkuppen auf einen Tisch legt.
Selbst wenn dieses Wesen alle Finger noch so akribisch untersuchte und die Beschaffenheit der Haut und Nägel erforschte, es würde doch nie erkennen, in welchem Zusammenhang diese Fingerkuppen miteinander stehen, zu welch großem Ganzen sie sich endlich verbinden. So können wir das, was uns und unsere Welt miteinander verbindet, nur erahnen und in seiner Ganzheit nie erfassen.
Hier begegnete ich auf intellektuellem Gebiet einem der tausend unmöglichen Wege, einem Weg, den mir die Musik in meiner Kindheit schon etwas nahegebracht hatte.
Caruso und Tauber, Callas und Tebaldi und tagaus, tagein der verführerische Schmelz der Tenorstimme meines Vaters, sein unschuldiges, fast kindliches Timbre – all diese Klänge verzauberten unsere Wohnung, ließen sie über die Dächer der Stadt hinausfliegen in italienische Opernhäuser und Palazzi. Ich lernte mit Verdi zu hoffen und mit Puccini zu weinen, ich starb tausend Tode mit Manon und träumte, mit dem Tode ringend, von einer letzten Reise mit Mimi nach Paris.
Es herrscht ein reges Frauensterben in den Belcanto-Dramen jener Zeit, und mir, dem die Oper das einzige Tor zur Wirklichkeit war, schienen Liebe und Tod untrennbar verbunden.
Grade mal fünf Jahre alt, trällerte ich, wie Mutter mir erzählte, die Arien nach, die mein Vater unermüdlich übte. Dann lernte ich Klavier spielen, und schon bald begann ich zu improvisieren und bescheidene Melodien zu komponieren. Die Jahre vor dem Stimmbruch sang ich mich mit meinem Vater quer durch die Klavierauszüge seiner Lieblingsopern. Was für ein ungewohnter Zusammenklang der verwandten Stimmen in den schönsten Liebesduetten der Musikgeschichte vereint!
Ich war Mimi, und mein Pathos ließ sich durch keine musikalische Leitung zügeln. Ich ließ mich von Puccini selbst leiten und von der Liebe, die seinen Melodien und harmonischen Progressionen entströmt. Und damals wenigstens war ich mir sicher: Wer noch nie bei Puccini geweint hat, kann nicht zur menschlichen Spezies gezählt werden.
[© Konstantin Wecker, Der Klang der ungespielten Töne, Ullstein 2004.]
Mit dem Verlust der engelsgleichen Knabenstimme verlor ich die künstlerische...