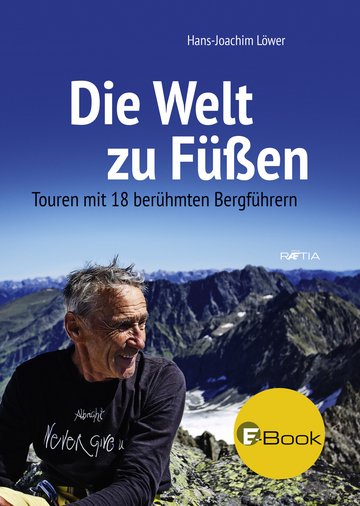Edi Bohren
Grindelwald, Schweiz
Ziel: Großer Simelistock
| 1
|
„Ich bin jeden
Tag ein
Anfänger“
Das Highlight, um das sich die Touristen scharen, lassen wir einfach mal hinter uns. Wir kehren der Eigernordwand respektvoll, aber entschlossen den Rücken zu. Natürlich beherrscht sie den Ort Grindelwald wie der Petersdom den Vatikan, ihr Anblick löst schaurige Fantasien aus, ihre Dramen von Heldentum und Tod haben Stoff für Bücher und Filme geliefert. Der Mann, der neben mir am Steuer sitzt, hat sie 1978 durchstiegen. Er war der erste Sohn Grindelwalds, der das Abenteuer wagte, bis dahin hatte ihr schrecklicher Mythos alle Einheimischen davon abgehalten. Ja, Edi Bohren erinnert sich noch gut, es war der dritte Sonntag im September, der eidgenössische Buß- und Bettag. Im „Götterquergang“ geriet er mit seinem Partner Fritz Imboden aus Ringgenberg in ein Schneetreiben, da hatten die Kirchenglocken, die sie von unten her läuten hörten, schon einen eigenartigen Klang. Aber man muss sich auch mal von dieser Wand befreien. Für mich ist sie ohnehin kein Thema. Rund um Grindelwald gibt es noch viele andere, spannende Geschichten.
Es ist sechs Uhr früh, wir fahren über die Große Scheidegg nach Osten in Richtung Meiringen. Das schmale, einsame Sträßchen ist für den Normalverkehr gesperrt, nur der Postbus und Leute mit Sondergenehmigung dürfen hier durch. Wir passieren das Hotel Rosenlaui, die berühmte Nostalgieherberge, in der es bis heute kein Fernsehen gibt, Toiletten und Duschen sich nur auf den Zimmerfluren befinden, und kommen in ein Jagdbanngebiet, wie der Schweizer Terminus heißt, in dem Steinadler kreisen, Hermeline auf Mäusejagd gehen, Birkhühner sich winters Schneehöhlen zum Schutz vor der Kälte graben. Mit einem Schlag ist der ganze Eiger-Trubel weg. Weniger ist mehr – wie fast immer im Leben.
„Der Mensch muss wissen, dass er gegen die Natur nie eine Chance hat.“
In früheren Zeiten zogen Säumer hier durch die Berge, so nach den Saumpfaden benannt, auf denen sie sich bewegten. Mit Pferden, Ochsen, Eseln und Maultieren transportierten sie Käse und Korn, Samt und Seide, Salz und Wein. Einheimische Rinderzüchter trieben Herden von Braunvieh, einer besonders geländegängigen Rasse aus dem Berner Oberland, auf zwei Routen nach Süden: Die eine lief über den Grimsel- und Griespass, die andere über den Susten und Gotthard. Im Durchschnitt waren sie zwei Wochen unterwegs, ihre Märkte lagen in Bellinzona und Mailand, von dort brachten sie Reis, Wein und Schnaps mit nach Hause. Erst nach dem Bau eines Schienenstrangs durch den Gotthardtunnel 1882 kamen diese Handelszüge zum Erliegen.
Wir reden über die Pionierzeiten des Alpinismus in Grindelwald. Über jene Revolution in den Köpfen, die sich im 19. Jahrhundert von England her ausbreitete. Die eingesessenen Älpler hatten bis dahin ihre Berge nur als Gegner betrachtet, als Quelle von Gefahr und Katastrophen; sie hatten weder die Zeit noch große Lust gehabt, sich den unheilschwangeren Gipfeln zu nähern. Nun kamen gebildete, vermögende Leute, Angehörige einer aus der Industrialisierung gewachsenen Bourgeoisie, und hatten nichts anderes im Sinn, als diese menschenfeindlichen Felsriesen zu erstürmen. Sie suchten mutige Leute mit Ortskenntnissen, denn es gab keine Karten und keine Literatur über die besten Anstiege. Tage-, wochen-, ja monatelang wollten die Engländer mit ihren Begleitern durch die Alpen ziehen, um Gipfel zu erreichen, auf die noch nie zuvor ein Mensch seinen Fuß gesetzt hatte. Sie taten es nicht, um Geld damit zu machen, die ganze Plackerei war scheinbar ohne jeden Sinn – ein reiner Zeitvertreib.
„Anfangs schüttelten die Einwohner von Grindelwald nur die Köpfe“, sagt mein Führer. „Sie verstanden nicht, dass sich Menschen freiwillig solchen Gefahren aussetzten und das auch noch als Vergnügen empfanden. Sehr schnell aber sahen sie, dass ein Führer, der sich von Engländern anheuern ließ, an einem Tag mehr Geld verdiente als ein Hirte im ganzen Monat.“ So kam, aus rein monetären Gründen, bei den Einheimischen die Wende im Kopf zustande. „Bald saßen Grindelwalder Männer in Scharen auf den Dorfbänken und warteten auf Gäste aus England. Und jeder versuchte, den Konkurrenten im Preis zu unterbieten. Das gab natürlich auch eine Menge Streit.“ So erlebte das arme Bauerndorf Grindelwald vor 150 Jahren auf eindrückliche Weise, dass Geld ein Segen und ein Fluch sein kann.
Edi Bohren ist ein Führer, mit dem es Spaß macht, nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Tiefe zu gehen. Als wir aufsteigen zur Engelhornhütte, diskutieren wir über riesige Steinquader, die sich unter uns in einem Bachbett angesammelt haben. Wir sehen breite Furchen im Boden, die unseren Pfad kreuzen, hier rauscht nach starken Regenfällen das Wasser zu Tal, reißt Erde und Felsen rücksichtlos mit. Menschen, die oft in den Bergen sind, erleben aus nächster Nähe, wie die Wucht solcher Naturphänomene wächst, wie der Klimawandel eine Landschaft verändert. „Früher zogen die Menschen, wenn die Lebensbedingungen sich verschlechterten, einfach in ein anderes Tal“, sagt Bohren. Diese Zeiten aber seien vorbei, denn unbewohnte Täler, in denen es sich leben lässt, gebe es heute in den Alpen nicht mehr. Was lernen wir daraus? „Der Mensch muss wissen, dass er gegen die Natur nie eine Chance hat“, antwortet er. „Also stell dich nicht gegen sie, sondern versuche, dich einzuklinken in ihre Prozesse. Nur so wirst du auf Dauer überleben.“ Im Gewühle der Stadt, wo der direkte Blick auf die Natur versperrt ist, kommen einem solche Einsichten schwerer. Am Berg aber, wo der Boden unter deinen Füßen bröckelt, glaubst du alles viel besser zu verstehen.
Es ist Mitte August, eine zweiwöchige Hitzewelle neigt sich ihrem Ende entgegen. Eine Kaltfront, warnen die Meteorologen, rückt aus Nordwesten vom Atlantik her an Europa heran. Heute Nachmittag, spätestens am Abend sollen heftige Gewitter niedergehen, mit Starkregen und Hagelschlag. Wir ziehen sozusagen auf den letzten Drücker los, in der Hoffnung, dem Wetter ein Schnippchen zu schlagen und trocken nach Hause zu kommen. Bohren äugt nach oben, noch ist dort alles blau, doch wir werden Blickkontakt mit dem Himmel halten müssen, um nicht unversehens in schlechtes Wetter hineinzurennen.
Er hat sich für eine Tour entschieden, die mir zunächst gar nichts sagt. „Wir gehen in die Engelhörner“, hatte er am Telefon vorgeschlagen. „Okay, meinetwegen“, sagte ich, er hätte auch Teufelshörner sagen können, ich wusste nichts darüber und wollte auch vorher gar nichts wissen. So verzichtete ich bewusst darauf, mir irgendwo Daten und Fakten anzulesen. Er wird seine Gründe haben, sagte ich mir, also lass dich einfach überraschen.
Wir trinken einen Kaffee auf der Hütte, füllen die Wasserflaschen, dann ziehen wir weiter. Der Pfad zum Einstieg für die Route auf den Kleinen Simelistock windet sich in Serpentinen über grasdurchsetzte Gratausläufer. Um uns herum wachsen Wände in die Höhe, dann legen wir unsere Wanderstöcke an einer Stelle ab, die wir auf dem Rückweg passieren werden. Wir seilen uns an, tasten uns die ersten Felsplatten hoch. Dies ist für ihn wie für mich eine Art Testgelände, denn wir sind noch nie miteinander gegangen. „Aber ich merke schon nach den ersten Metern, ob es gut gehen wird“, sagt der Führer. Einer wie er, mit vier Jahrzehnten Berufserfahrung, spürt durch die pure Bewegung des Seils, wen er da hinter sich hat. Wenn es leicht und locker durchhängt, wird es wenig Probleme geben. Wenn es ruckt und sich häufig strafft, ist es ratsam, noch einmal über alles nachzudenken. Es ist die letzte Gelegenheit, bevor es ernst wird.
Noch gut in der Zeit: Bohren mit einem Blick auf die Uhr
Bohren nickt und murmelt: „Wird schon gehen.“ Das macht Mut, und so bleiben wir auch weiterhin am kurzen Seil, das uns direkt, ohne weitere Sicherung, miteinander verbindet. „Gehen am kurzen Seil ist immer riskant“, sagt er. „Denn ich habe allenfalls begrenzte Möglichkeiten, einen Sturz von dir aufzufangen. Ein Führer tut das auch nur, wenn er sicher ist, dass nichts passiert. Der große Vorteil des kurzen Seils ist, dass man deutlich schneller vorankommt. Jede Sicherung, die ich anbringen muss, wirft uns in der Zeit zurück. Viel Zeitverlust aber lässt das Risiko wieder steigen.“
Alpinismus, wie er ihn versteht, ist keine Konkurrenz, sondern genau das Gegenteil. Es ist die Fähigkeit, im Team zu agieren, sich möglichst harmonisch einander anzupassen. „Im Grunde bin ich jeden Tag ein Anfänger“, sagt Bohren, Jahrgang 1951. „Wenn ich das vergesse, kann es mich auch im Alter von über 60 noch runterhauen.“ Bohren war immer...