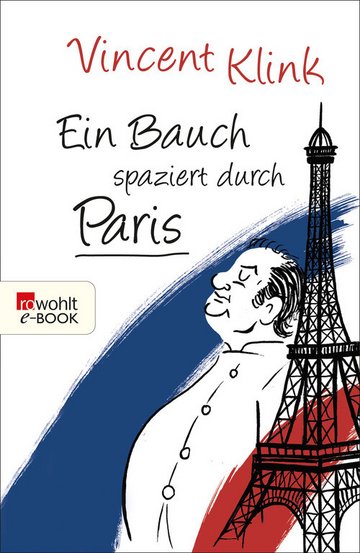Paris ist nicht nur «Mon Amour»
«Zwei Buchstaben zu Paris dazufügen, und es ist: le paradis, das Paradies.»
Jules Renard
Stuttgart, 19. August 2012: Es ist Sonntag früh, fünf nach acht – halt, sechs nach acht zeigt die Uhr. Einsam hocke ich am Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs und brüte vor mich hin. In einer Stunde, wenn der TGV keine Verspätung hat, müsste der Schnelltransport nach Paris beginnen. Eine meiner unzähligen Neurosen dürfte meine Überpünktlichkeit sein. Reisen, das ist mir ziemlich ungewohnt, sodass ich schon die Nacht zuvor wegen kommender Unwägbarkeiten vor Unruhe nicht die Augen zukriege. Unter den dreckigen Drahtglasdächern wabert schon um diese Zeit eine unglaubliche Hitze, die mich jedoch nicht stört. Eine Taube fällt besinnungslos auf den Bahnsteig. In mir kommt Mitleid hoch, zugleich wundere ich mich, dass meine Kondition robuster ist als die der dafür so gerühmten Bahnhofstauben.
Langeweile macht Hunger, und der ist bei mir völlig temperaturunabhängig. Die Vesperbrote werden schon mal ausgepackt. Meine Köchinnen haben sie abends zuvor superb mit Schinken, Salat und Käse zusammengebaut. Proviant dabeizuhaben, noch dazu selbst gebastelten, das hört sich sehr altmodisch an. Aber auf meinen ohnehin seltenen Reisen überlasse ich die Wegzehrung auf keinen Fall den ambulanten Verpflegungsverbrechern, schon gar nicht der Servicehölle der Bahn. Das, was sich im Zug so schön «Bistro» nennt, empfinde ich als eine Art Fegefeuer – um dort anzudocken, müsste die Not schon sehr groß sein.
Seit Jahren schwillt der Chor der Werbemarktschreier an, wir lebten in der wunderbaren Welt einer Dienstleistungsgesellschaft. Lug und Trug – Dienstleistung gab es, als niemand davon sprach. Ich erinnere mich: Mit dem Entstehen der Europäischen Union kam die staatliche französische Eisenbahngesellschaft SNCF 1986 auf die Idee, Europa-Parlamentariern und sonstigem gut zahlenden Volk das Pendeln zwischen Straßburg und Paris zu versüßen. «Nouvelle Première» nannte sich der Zug. Ich ließ es mir damals nicht nehmen, ihn auszuprobieren. Feine Herren in Schiffskapitänsuniform entwanden mir schon auf dem Bahnsteig den Koffer, und ich befürchtete zuerst einmal das Schlimmste: War das die neue Masche einer unverfrorenen Koffer-Entwendungsmafia? Sahen vielleicht irgendwelche Rosstäuscher in mir das leicht zu überwältigende Landei? Stattdessen geleitete man mich wie einen Potentaten an meinen Sitzplatz. Eine Speisekarte wurde gereicht, damit ich das Menü für später ordern konnte. Aus den Lautsprechern klang Keith Jarretts «Spain».
Als ich mich zur Toilette aufmachte, tat sich der übernächste Waggon als Salonwagen auf. An einer Bar kam ich vorbei, silberne Champagnerkübel standen herum. Mein Kiefer klappte herunter: Da saß doch tatsächlich ein echter Jazzer am Klavier! Man vergaß, dass man im Zug fuhr, stattdessen wähnte man sich in einem Drei-Sterne-Restaurant. Die SNCF nannte diese Unternehmung in Werbeannoncen den «Gipfel des savoir-vivre auf Schienen». Klar, billig war die Chose nicht, und so wurde der feudale Parlamentariertransport wegen des Neids der immobilen Beamtenschaft alsbald wieder abgeschafft.
Das ist jetzt über fünfundzwanzig Jahre her, und seitdem besingt man gebetsmühlenhaft den sogenannten «Service». Eingelullt durch verlogene Versprechungen merkt der deutsche Michel gar nicht, dass es wirkliche Dienstleistung, wie zum Beispiel einen Gepäckträger, mittlerweile immer weniger gibt. Stattdessen verwirren uns Automaten. Do-it-yourself-Ratschläge werden reichlich geboten, insbesondere der, wie man sich selbst vor den Karren seiner Wünsche zu spannen hat. Darin sind sich Demokratien und Diktaturen einig: Richtig gut darf es eigentlich niemandem gehen. Andererseits: Man kann ja froh sein, überhaupt heil durch den Tag zu kommen. Kürzlich erklärte mir ein Gast aus dem Libanon, wie wunderbar es hier in Deutschland sei: «Hier kann ich mich in ein Straßencafé setzen, ohne dass auf mich geschossen wird!» Seitdem halte ich mich mit dem Gejammere über die schlimmen Zustände in Deutschland etwas zurück. Reisen ins Ausland sind schon deshalb zu empfehlen, weil man oft bei der Rückkehr wieder froh ist, daheim zu sein. Paris bildet jedoch hoffentlich die Ausnahme. Als ich einem Schulkameraden einmal sagte, ich würde mit meiner Frau nach Paris fahren, konnte der es gar nicht fassen: «Nach Paris und dann die Frau mitnehmen? Das ist ja, als würde man Holz in den Wald tragen!» Jaja, Paris, die Stadt der Liebe – wer daran glaubt, ist reichlich hinterm Mond.
Aus meinen weitschweifenden Gedanken werde ich durch den Anblick der toten Taube gerissen. Könnte das ein Menetekel sein? Egal, ich sitze hier mit meinem Schinken-Käse-Brot und wundere mich über meinen Appetit. Vor mir, auch ohne Brille zu erkennen, jubelt ein Model auf einer Plakatwand irgendetwas Wundervolles über Ültje-Erdnusskerne. Das löst in mir augenblicklich nicht etwa Sehnsucht nach Knabberzeug, sondern nach einem kühlen Hefeweizen aus. Doch dafür ist es entschieden zu früh. Nach Minuten des Dahindämmerns werde ich jäh aus meiner Träumerei gekickt, als sich ein «echter Deutscher» in die Bahnhofsidylle schiebt. Der Mann in seiner halblangen Mimikrykampfhose wirft einen Schatten auf mich, in dem ich noch alle meine Verwandten unterbringen könnte. Früher nannte man einen rasierten Schädel mit den Ausmaßen eines Medizinballs schlichtweg «Mostkopf», heute muss man der politischen Korrektheit wegen das Maul halten und auch noch nett die Hand heben. Der archaische Flaneur, womöglich ein Hobbykoch, hat nämlich artig gegrüßt und mich offensichtlich als Kollegen erkannt.
Ich kriege die Augen von dem Mann nicht los: Die Waden der wandelnden Kampfmaschine sind rundum mit Totenköpfen ziseliert. Ich möchte mich nicht als Tattoo-Experte ausgeben, aber diese Art von Tintenstichelei nennt sich, glaube ich, «Gothic Tattoo». Puh, wie aggressiv es aus den Kampfstiefeln grüßt, und die strammen Waden erinnern an vertikal aufgestellte Zeppeline. Und da fällt es mir wieder ein, das Wörtchen «Toleranz». In Paris würde sich nach dem Typen überhaupt keiner umdrehen, aber wir Deutschen, besonders wir Schwaben, sind andauernd von Optimierungswünschen an die Adresse anderer Leute getrieben, dabei hätte man doch an sich selbst genügend zu reparieren. Bevor jedoch mein Sinnieren ins Unergründliche absackt, sehe ich erst ganz winzig, dann immer größer werdend, den blau gestreiften TGV leise wie eine Riesenschlange herangleiten.
Pünktlich hält der französische Superzug, der «Train Grande Vitesse», und ich steige in den kühl klimatisierten Wagen ein. Der Zug fährt hurtig an, doch das war’s dann auch schon – von «Grande Vitesse» ist nicht mehr viel zu spüren, denn das Geschoss kriecht nur noch dahin auf deutschen Gleisen, die bereits im «Tausendjährigen Reich» verlegt wurden. Dann aber, nach dem Halt in Straßburg, zieht die Kiste ab, und der anschwellende Fahrtlärm mildert das Kindergeschrei, das mich umgibt.
Verdammt, Ohrenstöpsel vergessen – ich hätte doch an meinem freien Tag wirklich ein Anrecht auf eine erholsame Fahrt! Aber Aufregen hilft nicht, die Mütter sind schlimmer dran als ich, die müssen das schließlich täglich ertragen. Ich muss an den Dalai Lama denken. Wie würde sich der famose Buddhist in dieser Situation wohl verhalten? Er würde natürlich sein berühmtes Lächeln einschalten, und so verordne auch ich mir hartnäckigen Altruismus. Und siehe da, es funktioniert: Man gewöhnt sich an alles, auch an Kinder, und die sich womöglich sogar an mich – sie hören jedenfalls auf zu brüllen.
Drei Sitze weiter vorn hebelt der Freizeitledernacken mit obszön appetitlichem Zischen eine Bierdose auf. Ich denke: Wirklich dumm, dass ich Bier vergessen habe, ob ich wohl eine Büchse gegen ein Sandwich tauschen soll? Es fehlt mir aber der Mut, so einen selbstsicheren Mann anzusprechen, und wenig später sacke ich weg und träume von Paris.
«Der heißeste Tag des Jahres», hat der Schaffner gesagt, aber erfreulicherweise ist davon nichts zu spüren. Es gibt nämlich Züge, da funktioniert sogar im Sommer die Klimaanlage. Als ich aufwache, zieht eine gewisse Vorort-Bahnhofstristesse an mir vorüber, Paris kommt näher. Der Zug wird immer langsamer und hält schließlich mit einem kleinen Ruck im herrlichen Gründerzeit-Bahnhof Gare de l’Est. Ich schnappe mir mein Rucksäcklein, und schon bin ich draußen. Heißer Dampf trifft mich wie ein Keulenschlag, aber ich sage mir: Wenn das Wochenende und mein Kurzurlaub vorbei sind, wird es am Dienstag in der Küche auch nicht viel anders sein. Als Nachkriegskind bin ich mit vielerlei fragwürdigen Tröstungen bei Laune gehalten worden: Hatte ich mir auf Rollsplitt die Knie aufgeschlagen, sagte Mama: «Hab dich nicht so, dem Onkel Robert hat der ‹Russ› ein Bein abgeschossen.» Also bete ich mir auch hier vor: Der Schutzpatron der Köche, der heilige Laurentius, hatte es schwerer; weil er an seinem Glauben festhielt, rösteten ihn die Römer gleich komplett auf Buchenholz. Seitdem führt er auf Heiligenbildchen immer einen Grillrost mit sich.
Die Bahnhofshalle erhebt sich wie eine Kathedrale. Der Gare de l’Est unterscheidet sich von den deutschen Abfertigungs- und Ramschhallen geradezu durch Eleganz. Nicht jeder Quadratmeter ist für Frittenbuden kommerziell ausgemostet. Rechts komme ich an einem Bistro vorbei, das ein Mobiliar präsentiert, als würde es sich um zwei Michelin-Sterne bemühen. Nirgendwo sehe ich Schmutz, ich glaube, die schwäbischen Dampfstrahler der...