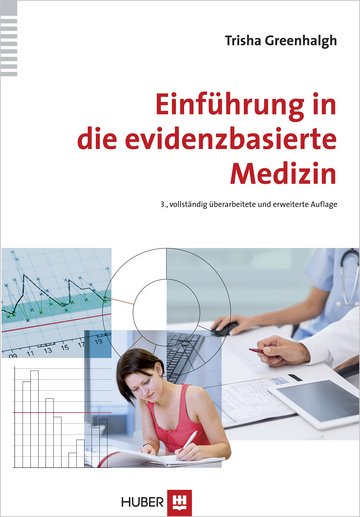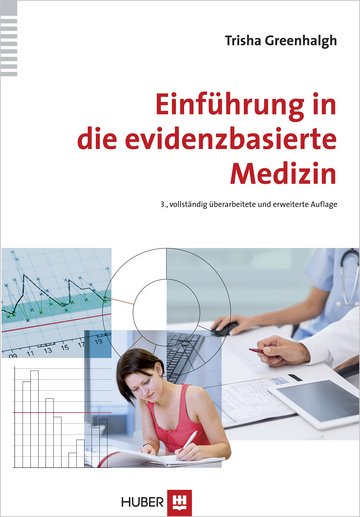1. Warum man wissenschaftliche Veröffentlichungen überhaupt lesen sollte
1.1 Bedeutet «evidenzbasierte Medizin» einfach nur «Fachliteratur lesen»?
Evidenzbasierte Medizin (EbM) ist mehr als bloß die Lektüre wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Nach der am häufigsten zitierten Definition ist EbM «der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten» (1). Diese insgesamt sehr brauchbare Definition lässt allerdings einen meiner Ansicht nach sehr bedeutenden Aspekt außer Acht, und zwar die Mathematik. Selbst wenn Sie kaum etwas über EbM wissen, wird Ihnen nicht unbekannt sein, dass dabei Zahlen und Verhältnisse eine große Rolle spielen! Anna Donald und ich sprechen dies in unseren Lehrveranstaltungen deshalb auch ganz offen an und schlagen alternativ folgende Definition vor:
Evidenzbasierte Medizin ist die Anwendung mathematischer Schätzungen des Nutzen- und Schadensrisikos, die aus hochwertigen Forschungsarbeiten über Bevölkerungsstichproben abgeleitet werden und die bei der Diagnostik, Untersuchung oder Therapie individueller Patienten in die klinische Entscheidungsfindung einfließen.
EbM zeichnet sich also dadurch aus, dass für die medizinische Entscheidung im Fall einzelner Patienten Zahlen herangezogen werden, die aus der Forschung über Bevölkerungsgruppen (Populationen) stammen. Das wirft natürlich die Frage auf, was Forschung ist. Eine halbwegs korrekte Antwort könnte z. B. lauten: «Forschung ist eine fokussierte systematische Untersuchung, durch die neues Wissen generiert werden soll.» In späteren Kapiteln werde ich erklären, inwiefern Ihnen diese Definition dabei helfen kann, zwischen echter Forschung (die Eingang in Ihre Praxis finden sollte) und minderwertigen Bemühungen wohlmeinender Amateure (die Sie höflich ignorieren sollten) zu unterscheiden.
Wenn Sie bei der klinischen Entscheidungsfindung evidenzbasiert vorgehen, dann werden alle möglichen Probleme, die sich in Bezug auf Ihre Patienten (oder wenn Sie im Public-Health-Sektor arbeiten, auf Bevölkerungsgruppen oder Populationen) ergeben, Sie dazu veranlassen, Fragen über die wissenschaftliche Beweislage zu stellen, in systematischer Weise Antworten auf diese Fragen zu suchen und Ihre Vorgehensweise in der Praxis entsprechend zu ändern. Sie könnten beispielsweise Fragen zu den Symptomen eines Patienten stellen:
- Wie groß ist bei einem 34-jährigen Mann mit linksseitigen Thoraxschmerzen die Wahrscheinlichkeit, dass er ein schwerwiegendes kardiales Problem hat? Wenn ein solches Problem tatsächlich vorliegt, zeigt sich das auch im Ruhe-EKG?
Vielleicht interessieren Sie sich auch für die körperlichen oder diagnostischen Zeichen:
- Muss der Zustand eines Säuglings schlechter eingeschätzt werden, wenn bei einer ansonsten komplikationslosen Geburt Mekonium (Zeichen für kindliche Darmbewegungen) im Fruchtwasser nachgewiesen wurde?
Oder für eine Frage zur Prognose:
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bislang gesundes zweijähriges Mädchen an Epilepsie erkrankt, wenn es in einem Fieberschub einen kurzen Anfall erleidet?
Oder für eine Frage zur Therapie:
- Wiegen bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom [Herzinfarkt] – unabhängig von Alter, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit – die Vorteile von Thrombolytika (Blutgerinnsel auflösenden Substanzen) schwerer als die mit dieser Behandlung assoziierten Risiken?
Oder zur Kosteneffektivität:
- Sind die Kosten dieses neuen Krebsmedikaments gerechtfertigt, wenn man sie in Relation zu anderweitigen Verwendungsmöglichkeiten der begrenzten Gesundheitsressourcen setzt?
Oder zu Patientenpräferenzen:
- Wiegen bei einer 87 Jahre alten Frau mit intermittierendem Vorhofflimmern und einer kürzlich stattgehabten transienten ischämischen Attacke die Unannehmlichkeiten einer Marcumar-Therapie schwerer als das mit dem Verzicht auf die Einnahme von Marcumar verbundene Risiko?
Oder auch zu vielen anderen Aspekten des Gesundheitswesens und der medizinischen Versorgung.
Im Editorial zur allerersten Ausgabe der Zeitschrift Evidence-Based Medicine hat Professor Sackett die wichtigsten Schritte des neuen EbM-Wissenschaftszweiges zusammengefasst (2):
- Übersetzung unseres Informationsbedarfs in beantwortbare Fragen (d. h. die Formulierung der Problems)
- möglichst effiziente Identifizierung der besten Beweise (Evidenz), mit denen sich die Fragen, die sich aus den klinischen und labordiagnostischen Befunden, der veröffentlichten Literatur oder anderen Quellen ergeben können, beantworten lassen
- kritische Bewertung (d. h. Abwägung) der Evidenz, um ihre Validität (Wahrheitsnähe) und Nützlichkeit (klinische Anwendbarkeit) beurteilen zu können
- Umsetzung der Ergebnisse dieser Bewertung in die klinische Praxis
- Beurteilung der eigenen ärztlichen Leistung
EbM verlangt von Ihnen also nicht nur, Fachliteratur zu lesen, sondern die richtigen Veröffentlichungen zur richtigen Zeit zu lesen, um dann Ihre Verhaltensweisen (oder was noch schwieriger ist, die Verhaltensweisen anderer Menschen) im Lichte Ihrer Rechercheergebnisse zu ändern. Ich fürchte, die «Wie funktioniert EbM?»-Kurse konzentrieren sich oft nur auf den dritten dieser fünf Schritte (nämlich die kritische Bewertung) und lassen die übrigen Aspekte außer Acht. Aber wenn Sie die falschen Fragen stellen oder die Antworten in den falschen Quellen suchen, dann können Sie das Lesen wissenschaftlicher Veröffentlichungen auch gleich ganz unterlassen. Genauso sinnlos ist es, Kurse in Suchtechniken und kritischer Bewertung zu besuchen, wenn Sie in die Umsetzung verlässlicher wissenschaftlicher Evidenz und die Messung Ihrer Fortschritte im Hinblick auf Ihre Zielsetzungen nicht mindestens ebenso viel Mühe stecken wie in die Lektüre des Artikels selbst.
Vor ein paar Jahren habe ich das Fünf-Stufen-Modell von Sackett um drei weitere Schritte ergänzt, damit auch die Sichtweise der Patienten Berücksichtigung findet: Die nunmehr acht Schritte, die ich «Kontextsensitive Checkliste für eine evidenzbasierte Praxis» genannt habe, sind in Anhang 1 nachzulesen (3).
Nähme ich es mit dem Titel dieses Buches allzu genau, dürften diese allgemeineren Aspekte der EbM hier überhaupt nicht zur Sprache kommen. Aber bestimmt (so hoffe ich wenigstens) würden Sie das Geld, das Sie für dieses Buch bezahlt haben, zurückverlangen, wenn ich Abschnitt 1.3 (Bevor Sie anfangen: Formulieren Sie das Problem), Kapitel 2 (Literatur suchen), Kapitel 15 (Evidenzbasierte Vorgehensweisen umsetzen) und Kapitel 16 (Die Evidenz auf Patienten anwenden) einfach weggelassen hätte. In den Kapiteln 3 bis 14 beschreibe ich den dritten Schritt des EbM-Prozesses, die kritische Bewertung, d. h., was Sie tun sollten, wenn Sie eine Veröffentlichung vor sich haben. Kapitel 16 beschäftigt sich mit den gegenüber EbM am häufigsten vorgebrachten Kritikpunkten.
Falls Sie sich gut mit Computern auskennen und zum Thema EbM im Internet recherchieren möchten, könnten Sie mit den in Tabelle 1-1 genannten Internetseiten anfangen. Falls nicht, muss Sie das jetzt nicht weiter kümmern; Sie sollten aber entsprechende internetbasierte Lern-und Anwendungsprogramme auf Ihre To-Do-Liste setzen. Auch die Feststellung, dass sich mehr als 1000 Internetseiten mit der EbM-Thematik befassen, sollte Sie nicht weiter beunruhigen: Sie enthalten ganz ähnliche Materialien, und Sie müssen sie mit Sicherheit nicht alle aufsuchen.
Tabelle 1-1: Internetbasierte Quellen über EbM.
1.2 Warum fangen die Leute manchmal an zu stöhnen, wenn man auf EbM zu sprechen kommt?
Kritiker definieren EbM gelegentlich als die «Neigung einer Gruppe von jungen, selbstbewussten, mathematisch begabten Medizinwissenschaftlern, die Leistungen erfahrener Ärzte zu schmälern, indem sie sich selbst eine Mischung aus epidemiologischem Fachjargon und statistischen Tricks zu eigen machen» oder als «das normalerweise mit nahezu apostolischem Eifer vorgetragene Argument, dass Ärzte, Pflegepersonal, Kosten- oder Entscheidungsträger keine gesundheitsbezogene Handlung vollziehen dürften, wenn bzw. ehe sie nicht durch die Ergebnisse mehrerer großer und kostenintensiver wissenschaftlicher Studien in Veröffentlichungen bestätigt und von einem Expertengremium gebilligt wurde».
Der Unmut, den manche Ärzte gegenüber der EbM-Bewegung empfinden, ist größtenteils eine Reaktion auf die Unterstellung, Ärzte (wie auch Pflegepersonal, Hebammen, Physiotherapeuten und andere Gesundheitsberufe) seien wissenschaftlich ahnungslos gewesen, bevor ihnen durch EbM der «Weg zum Licht» gewiesen wurde, und dass die wenigen, die mit Fachliteratur umzugehen verstanden, die publizierte medizinische Evidenz willentlich ignorierten. Jeder, der mit Patienten arbeitet, weiß, dass man sich oft neue Informationen beschaffen muss, bevor eine klinische Entscheidung getroffen werden kann. Seit es Bibliotheken gibt, haben Ärzte viel Zeit darin verbracht. Grundsätzlich verschreiben wir kein neues Medikament, wenn wir keine Belege dafür haben, dass es wahrscheinlich auch wirkt, ganz abgesehen davon, dass ein solches Vorgehen (die sogenannte Off-Label-Anwendung) streng...